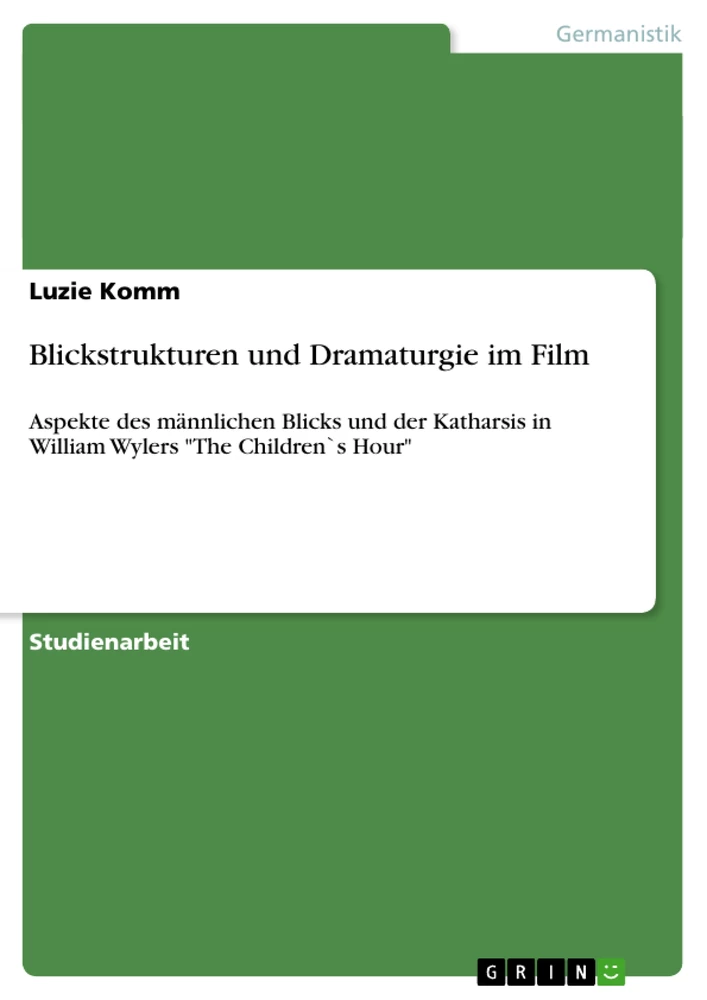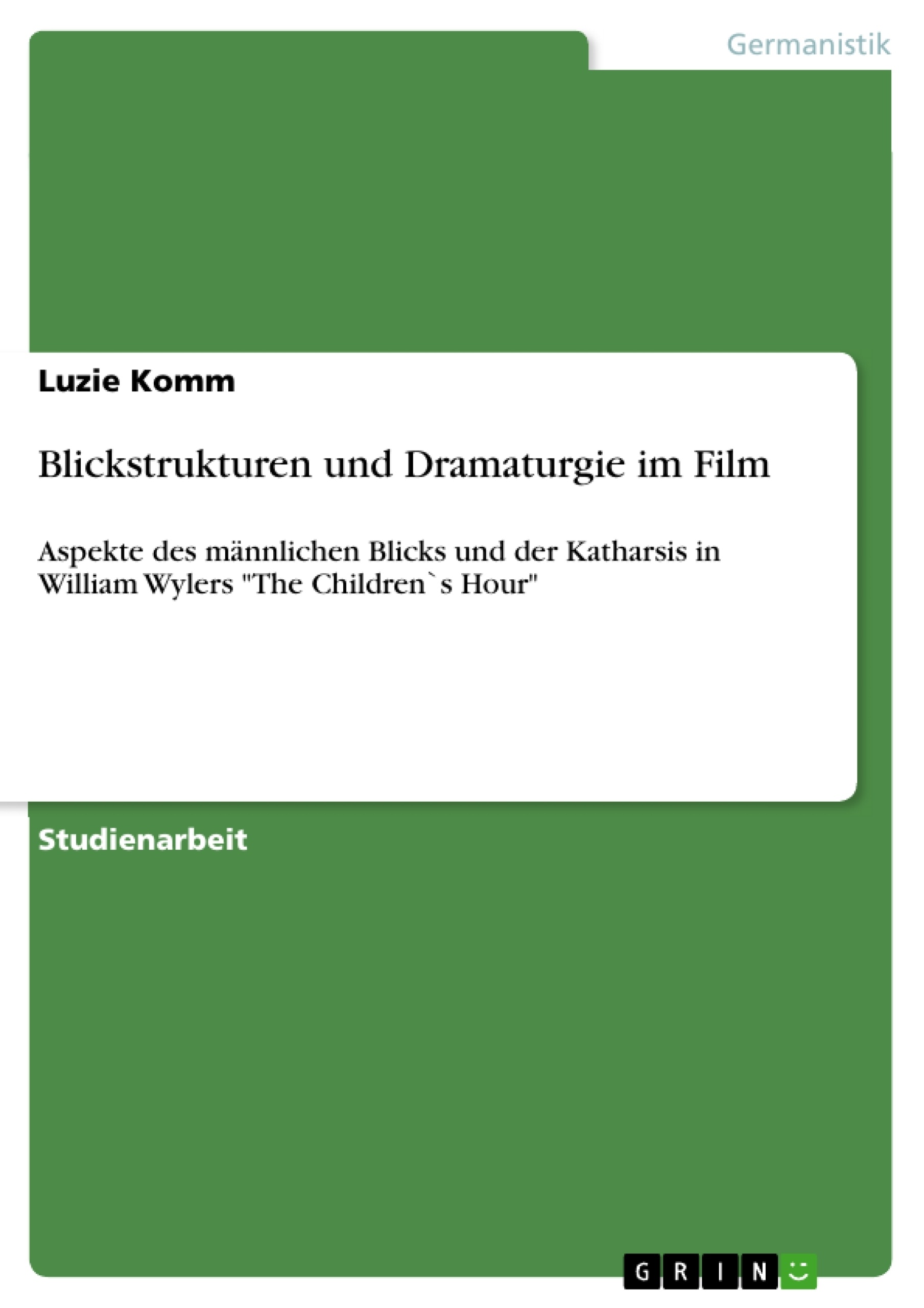Der Film "The Childen`s Hour" von William Wyler handelt von zwei eng befreundeten Frauen, Martha Dobie (Shirley MacLaine) und Karen Wright (Audrey Hepburn), die gemeinsam eine private Mädchenschule in Neuengland gegründet haben. Beide Lehrerinnen wirken routiniert und halten einen strengen aber liebevollen Umgang mit ihren Schülerinnen. Die Schülerin Mary (Karen Balkin nutzt ihren Erfindungsreichtum und das erpresste Wort einer Mitschülerin, um den beiden Lehrerinnen ein gesellschaftlich inakzeptables Verhalten unterstellen zu können. Unverzüglich informiert ihre besorgte Oma Mrs. Tilford (Fay Bainter) die gesamte Elternschaft, woraufhin alle Kinder von der Schule entfernt werden. Die zunächst unwissenden Frauen geraten in eine Lage, welche die Schattenseite einer konservativ genormten Welt zu Tage fördert. Ihre vermeintliche Andersartigkeit wird mit voyeuristischen Blicken aus einer Mischung von Verachtung und Neugierde der männlichen Gesellschaft bestraft.
An dieser Stelle bietet die feministische Filmtheorie von Laura Mulvey (*1941) einen interessanten Ansatz zur Analyse von „The Children`s Hour“. Mulvey kündigt in ihrem Artikel „Visuelle Lust und narratives Kino“ an, dem immer noch „dominierenden ideologischen Kinokonzept“ einer Analyse zu unterziehen, welche seinen klassischen Hollywood-Stil destruieren und „zu einer neuen Sprache des Begehrens“ verhelfen soll. Um dieses hier kurz zusammengefasste Vorhaben zu realisieren, zieht sie psychoanalytische Ansätze von Sigmund Freud (1856-1939) und Jaques Lacan (1901-1981) heran und entwickelt eine Theorie zum geschlechtlich bedingten Blickverhalten der Kinobesucher. Das Drehbuch im Hollywood-Format, so Mulvey, arbeite mit Faszinationsmustern, welche die nach Freud sexuell begründete Skopophilie (Schaulust) der Zuschauer nutze, um die Illusion einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung zu festigen. Diese Theorie soll im Folgenden genauer beleuchtet werden. Insbesondere wird dabei sowohl das durch die Kamera geleitete Blickverhalten der Kinogesellschaft als auch das der filmimmanenten Gesellschaft in William Wylers „The Children`s Hour“ eine Rolle spielen. Anschließend möchte ich noch einen alternativen Ansatz zum Verständnis von aktiver Zuschauermanipulation nach der Dramentheorie Gotthold Ephraim Lessings vorstellen und diese ins Verhältnis setzen zu Mulveys im Artikel zuletzt genannter Forderung „die[...] filmischen Codes und ihre Beziehung zu formativen äußeren Strukturen“ zu zerstören.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Laura Mulveys Theorie zum männlichen Blick
- 3. Die Katharsis im Film. G. E. Lessings Dramentheorie als mögliches Kinokonzept
- 4. The Children's Hour - Eine Katharsis für den Voyeur
- 4.1. Blickstrukturen
- 4.1.1. Der Blick der Kamera
- 4.1.2. Der innerfilmische Blickaustausch
- 4.1.3. Die Blicke des Zuschauers
- 4.2. Die Wirkung auf den Zuschauer durch dramaturgische Strukturen
- 4.1. Blickstrukturen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht William Wylers Film "The Children's Hour" ("Infam") im Kontext feministischer Filmtheorie (Laura Mulvey) und der Dramentheorie Gotthold Ephraim Lessings. Ziel ist es, die Wirkung des Films auf den Zuschauer hinsichtlich der Darstellung von Blickstrukturen und der Erzeugung von Katharsis zu analysieren. Die Interaktion von Kameraführung, innerfilmischen Blicken und Zuschauerrezeption wird im Hinblick auf Geschlechterrollen und die Konstruktion einer patriarchalischen Ordnung beleuchtet.
- Der männliche Blick in Hollywood-Filmen nach Laura Mulvey
- Die Katharsis als dramaturgisches Prinzip und ihre Anwendung im Film
- Die Darstellung von Voyeurismus und seine Auswirkungen auf die Rezeption
- Analyse der Blickstrukturen in "The Children's Hour"
- Die Rolle der Dramaturgie bei der Erzeugung von Mitleid und Furcht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt den Film "The Children's Hour" von William Wyler vor. Es beschreibt kurz die Handlung und den historischen Kontext des Films, der den Wertewandel der 1960er Jahre spiegelt und die gesellschaftliche Konfrontation mit einer homosexuellen Identität thematisiert. Der Bezug zur feministischen Filmtheorie von Laura Mulvey und zur Dramentheorie Lessings wird hergestellt, um den analytischen Rahmen der Arbeit abzustecken. Die Ambivalenz der gesellschaftlichen Reaktion auf die Darstellung von Homosexualität im Film wird angedeutet.
2. Laura Mulveys Theorie zum männlichen Blick: Dieses Kapitel erläutert die feministische Filmtheorie von Laura Mulvey, die psychoanalytische Ansätze von Freud und Lacan verwendet, um das Blickverhalten der Kinobesucher zu analysieren. Mulvey beschreibt den "männlichen Blick" als ein dominantes ideologisches Konzept im klassischen Hollywood-Kino, das die Schaulust (Skopophilie) der Zuschauer nutzt, um die patriarchalische Gesellschaftsordnung zu festigen. Die Theorie wird anhand der Konzepte der infantilen Sexualität, des Ödipuskomplexes und des Spiegelstadiums nach Lacan erläutert. Die Rolle der Frau im traditionellen Kino als passives Objekt des männlichen Begehrens wird diskutiert. Die zentrale These Mulveys, den "voyeuristischen, skopophilischen Blick" zu zerstören, um ein egalitäres Kino zu ermöglichen, wird vorgestellt.
3. Die Katharsis im Film. G. E. Lessings Dramentheorie als mögliches Kinokonzept: Dieses Kapitel untersucht Lessings Dramentheorie und ihre mögliche Anwendung auf das Kino. Es vergleicht Theater und Film als Kunstformen und betont die Rolle der Kamera und der Diegese im filmischen Erzählen. Die 3-Akt-Struktur des Hollywood-Films und die Konzepte der Szene und Einstellung werden erläutert. Lessings Konzept der Katharsis – die Reinigung der Leidenschaften durch Mitleid und Furcht – wird vorgestellt und als Gegenpol zu Mulveys Theorie positioniert. Der Unterschied zwischen der Distanzforderung Mulveys und Lessings Ansatz der Perspektivübernahme wird herausgestellt.
4. The Children's Hour - Eine Katharsis für den Voyeur: Dieses Kapitel analysiert "The Children's Hour" im Lichte der vorhergehenden theoretischen Ausführungen. Es wird die Geschichte des Films und seine Entstehung im Kontext von Zensur und gesellschaftlichen Normen beleuchtet. Die unterschiedlichen Rezensionen des Films werden erwähnt. Es beginnt mit einer Beschreibung der Handlung, der Charaktere und der filmischen Gestaltung. Die Analyse der Blickstrukturen (Kamerablick, innerfilmische Blicke, Zuschauerblick) sowie deren Auswirkungen auf die Rezeption wird vertieft. Die Rolle der dramaturgischen Strukturen bei der Erzeugung von Mitleid und Furcht und der Katharsis wird untersucht. Die Ambivalenz des Voyeurismus und der Frage nach der Identifikation des Zuschauers mit den Figuren wird diskutiert.
Schlüsselwörter
„The Children’s Hour“, William Wyler, Laura Mulvey, feministische Filmtheorie, männlicher Blick, Skopophilie, Voyeurismus, Katharsis, Gotthold Ephraim Lessing, Dramentheorie, Mitleid, Furcht, Identifikation, Patriarchat, Filmgenres, Melodrama, Blickstrukturen, Kameraperspektive, Psychoanalyse, Freud, Lacan, Diegese, Filmdramaturgie
Häufig gestellte Fragen zu "The Children's Hour" - Eine Katharsis für den Voyeur?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert William Wylers Film "The Children's Hour" ("Infam") unter Einbezug feministischer Filmtheorie (Laura Mulvey) und der Dramentheorie Gotthold Ephraim Lessings. Im Mittelpunkt steht die Wirkung des Films auf den Zuschauer hinsichtlich der Darstellung von Blickstrukturen und der Erzeugung von Katharsis.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf Laura Mulveys Theorie des "männlichen Blicks" im klassischen Hollywood-Kino, die psychoanalytische Konzepte von Freud und Lacan einbezieht. Zusätzlich wird Lessings Dramentheorie mit dem Konzept der Katharsis herangezogen und im Vergleich zu Mulveys Ansatz diskutiert.
Welche Aspekte des Films werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Interaktion von Kameraführung, innerfilmischen Blicken und Zuschauerrezeption im Hinblick auf Geschlechterrollen und die Konstruktion einer patriarchalischen Ordnung. Die Blickstrukturen (Kamerablick, innerfilmische Blicke, Zuschauerblick) und deren Auswirkungen auf die Rezeption werden vertieft untersucht. Die Rolle der dramaturgischen Strukturen bei der Erzeugung von Mitleid und Furcht und der Katharsis wird ebenfalls analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die Laura Mulveys Theorie des männlichen Blicks, Lessings Dramentheorie und deren Anwendung im Film, eine detaillierte Analyse von "The Children's Hour" und ein Fazit. Das Kapitel zur Analyse von "The Children's Hour" unterteilt sich weiter in die Analyse der Blickstrukturen und die Wirkung auf den Zuschauer durch dramaturgische Strukturen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Wirkung des Films "The Children's Hour" auf den Zuschauer zu analysieren, indem die Darstellung von Blickstrukturen und die Erzeugung von Katharsis untersucht werden. Die Interaktion von Kameraführung, innerfilmischen Blicken und Zuschauerrezeption wird im Hinblick auf Geschlechterrollen und die Konstruktion einer patriarchalischen Ordnung beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: "The Children’s Hour", William Wyler, Laura Mulvey, feministische Filmtheorie, männlicher Blick, Skopophilie, Voyeurismus, Katharsis, Gotthold Ephraim Lessing, Dramentheorie, Mitleid, Furcht, Identifikation, Patriarchat, Filmgenres, Melodrama, Blickstrukturen, Kameraperspektive, Psychoanalyse, Freud, Lacan, Diegese, Filmdramaturgie.
Wie wird der Film "The Children's Hour" im Kontext der Theorien eingeordnet?
Der Film wird als Fallbeispiel genutzt, um die Theorien von Mulvey und Lessing auf ein konkretes Werk anzuwenden und deren Anwendbarkeit und Grenzen zu überprüfen. Die Analyse beleuchtet, wie der Film Voyeurismus darstellt und wie er beim Zuschauer Mitleid und Furcht, sowie möglicherweise Katharsis erzeugt.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass "The Children's Hour" durch seine geschickte Inszenierung von Blickstrukturen und dramaturgischen Elementen eine kathartische Wirkung auf den Zuschauer erzielen kann, die jedoch im Spannungsfeld zwischen Mulveys Kritik am männlichen Blick und Lessings Konzept der Reinigung der Leidenschaften steht. Die Ambivalenz des Voyeurismus und der Frage nach der Identifikation des Zuschauers mit den Figuren wird dabei diskutiert.
- Citation du texte
- Luzie Komm (Auteur), 2012, Blickstrukturen und Dramaturgie im Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231093