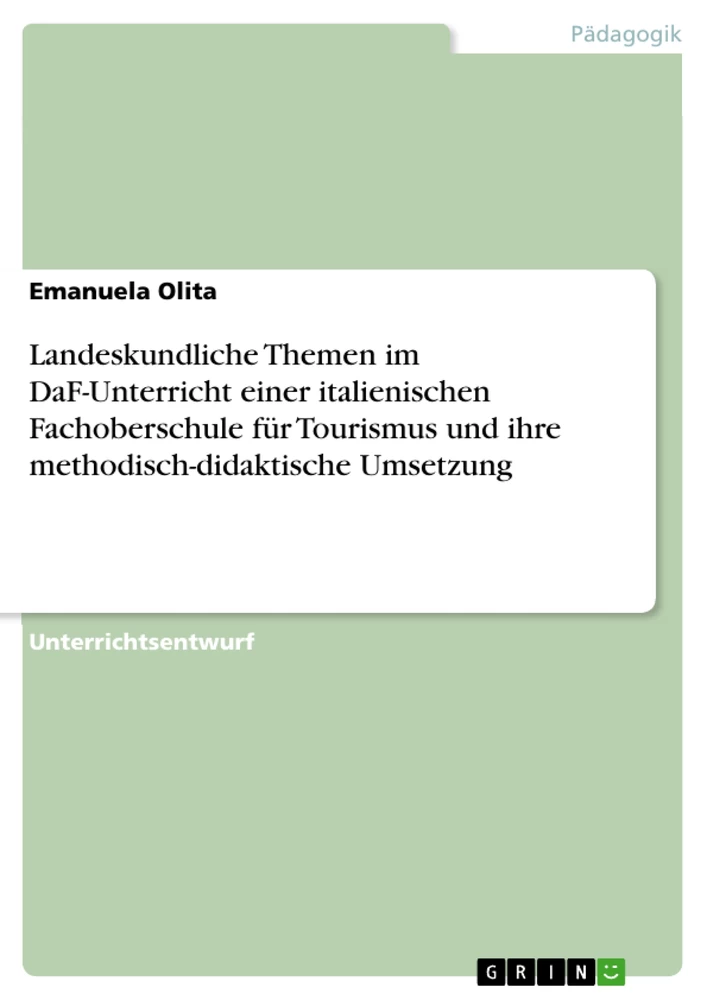Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine mögliche Umsetzung landeskundlicher und fachspezifischer Themen des Tourismus-Bereichs im Deutschunterricht einer Klasse des Istituto Tecnico per il Turismo „Andrea Gritti“ von Mestre vorzuschlagen, bei dem ich meinen Vorbereitungsdienst im Rah-men des Referendariats abgeleistet habe. Die Entscheidung, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, beruht auf zwei Gründen. Zunächst arbeite ich seit vielen Jahren als Rezeptionsleiterin in einem 4-sternigen Hotel und verfüge daher über eine umfangreiche Erfahrung im touristischen Bereich, die mir sehr geholfen hat, eine zielgerichtete Unterrichtseinheit aufzubauen, die vor allem der Förderung von im Hotelfach grundlegenden Schlüsselqualifikationen, etwa Kooperationsbereitschaft, Teamarbeit, Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl und Unvoreingenommenheit dient. Der zweite Grund, der mich dazu veranlasst hat, diese Entscheidung zu treffen, ist der Schulkontext. Ich habe nämlich meinen Vorbereitungsdienst in einer Fachoberschule mit zwei unterschiedlichen Fachrichtungen durchlaufen: wirtschaftliche und touristische Fachrichtung. Die Klassen, in denen ich sowohl die Hospitationsphase als auch die Unterrichtsstunden unter Anleitung meiner Mentorin gemacht habe, gehören alle zur touristischen Fachrichtung. Ein weiteres Element, das meine Entscheidung wesentlich beeinflusst hat, machen die Interessen der Lerngruppe aus. Die SchülerInnen sind im Laufe meiner Hospitationsphase aufgefordert worden, eine Tabelle mit einer Reihe von Bereichen zu ergänzen, in denen sie die deutsche Sprache be-nutzen möchten. Die Mehrheit hat folgenden Aspekten Priorität eingeräumt:
• Arbeit (an erster Stelle das Hotelfach)
• Freizeit (vor allem das Reisen)
• Lernen (mit Schwerpunkt auf Kommunikation)
• Alltag (mit Deutschsprechern in alltäglichen und konkreten Kommunikationssituationen interagieren).
Anhand der von den Lernenden aufgelisteten Elemente ist die unten beschriebene Unterrichtssequenz ausgearbeitet worden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kontext der Unterrichtseinheit
2.1 Analyse der Lerngruppe
2.2 Festlegung des Lehransatzes
2.3. Didaktische Methoden, Techniken und Strategien
2.4 Bestimmung der Lernziele
2.5 Lehrmaterialien und Hilfsmittel
3. Gliederung der Unterrichtseinheit
4. Evaluation
5. Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welches Ziel verfolgt die Arbeit zum DaF-Unterricht?
Die Arbeit schlägt eine methodisch-didaktische Umsetzung landeskundlicher und fachspezifischer Tourismus-Themen für den Deutschunterricht an einer italienischen Fachoberschule vor.
Welche Lerngruppe steht im Fokus der Unterrichtseinheit?
Es handelt sich um eine Klasse der touristischen Fachrichtung am Istituto Tecnico per il Turismo „Andrea Gritti“ in Mestre.
Welche Interessen gaben die Schüler für den Deutschunterricht an?
Die Schüler priorisierten Themen wie das Hotelfach (Arbeit), Reisen (Freizeit), Kommunikation (Lernen) und alltägliche Interaktionen mit Deutschsprachigen.
Welche Schlüsselqualifikationen sollen gefördert werden?
Gefördert werden grundlegende Kompetenzen für das Hotelfach, wie Kooperationsbereitschaft, Teamarbeit, Selbstständigkeit und Unvoreingenommenheit.
Welche Rolle spielt die praktische Erfahrung der Autorin?
Die Autorin bringt langjährige Erfahrung als Rezeptionsleiterin ein, was eine besonders praxisnahe und zielgerichtete Gestaltung der Unterrichtseinheit ermöglichte.
- Arbeit zitieren
- Emanuela Olita (Autor:in), 2013, Landeskundliche Themen im DaF-Unterricht einer italienischen Fachoberschule für Tourismus und ihre methodisch-didaktische Umsetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231098