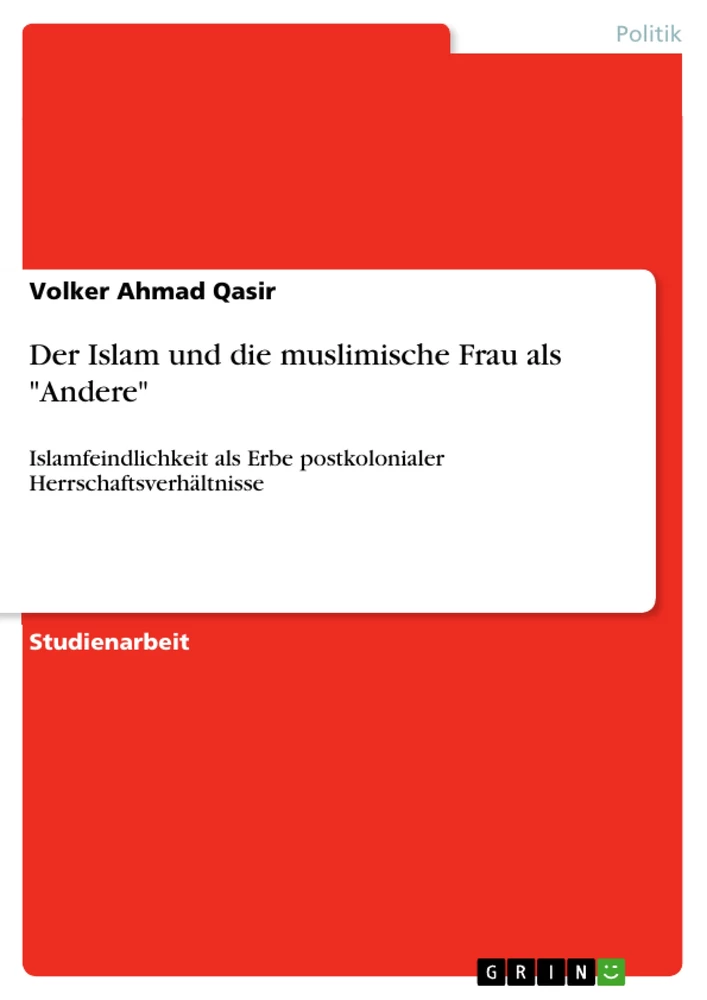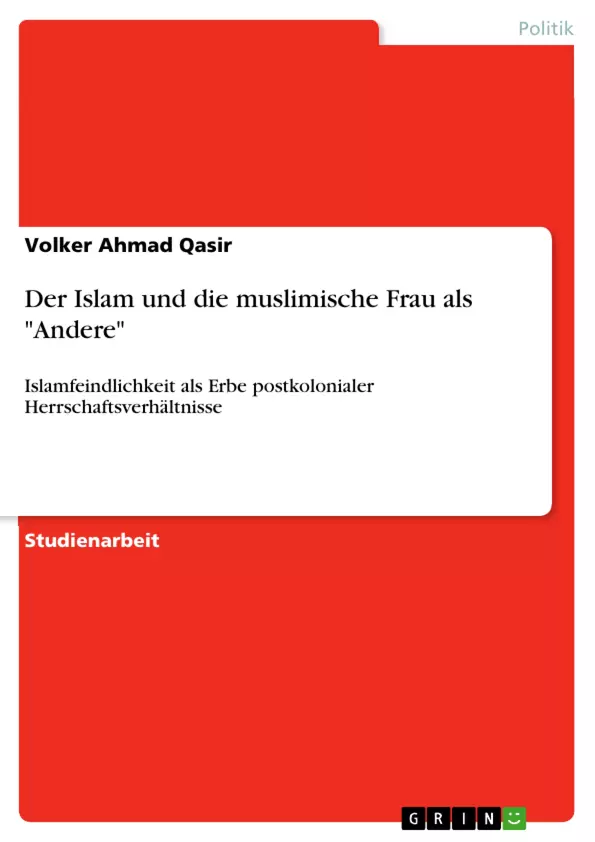Die während der Kolonialzeit entstandenen hegemonialen Herrschaftsstrukturen prägten zur damaligen Zeit nicht nur die Menschen in den besetzten Gebieten, sondern veränderten ebenso auch das Denken der Bürgerinnen und Bürger in den Mutterländern der Kolonialmächte. Die so entstandenen Ideologien hatten weitreichende Folgen auf die kulturelle Entwicklung und veränderten das Weltbild verschiedener Menschengruppen nachhaltig, sodass dieser Einfluss bis heute zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gemacht wird.
Bei Diskussionen um den Islam in Deutschland lässt sich beispielsweise einerseits beobachten, dass besonders islamkritisch auftretende Persönlichkeiten oder Gruppen meist keine theologische oder islamwissenschaftliche Qualifikation besitzen oder sich in ähnlich wissenschaftlicher Form hervorgetan haben. Im Gegenteil scheinen diese bestehende Stereotype und in der Gesellschaft vorherrschende Ängste gegenüber dem „Fremden“ lediglich zu reproduzieren. Andererseits sind es vornehmlich zwei Gruppen von Argumenten, die gegen den Islam als Religion und Kultur gleichermaßen hervorgebracht werden.
Die erste Kategorie betrifft den Islam als nicht mit deutschen Werten und Normen vereinbar. Die zweite Gruppe von Argumenten ist eigentlich ein Teil der ersten Gruppe und bezieht sich auf die Rolle der Frau im Islam. Seitens der Islamkritiker sei die Frau im Islam als „minderwertig“ gegenüber dem Mann anzusehen, was sich auch z.B. durch das Tragen des Kopftuchs als „Symbol der Unterdrückung“ äußert.
Im Rahmen der Hausarbeit wird zunächst beiden Gruppen von Argumenten eine postkoloniale Theorie der Politikwissenschaft gegenübergestellt. Dabei wird untersucht, ob die jeweilige Theorie hier praktisch zur Anwendung kommt und welche Schlussfolgerungen entsprechend daraus zu ziehen sind, bzw. welche Bedeutung diese Erkenntnisse für die Islam- und/oder Kopftuchdebatten in Deutschland haben und welche Schritte zur Befriedigung man seitens der zuständigen Institutionen ergreifen sollte. Damit soll die Frage beantwortet werden, ob heutige Argumente von Islamfeindlichkeit auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse während der Kolonialzeit zurückzuführen sind.
Inhalt:
Einleitung
Über die Abgrenzung von Islam und Orient
- Die „Anderen“ und der Orientalismusdiskurs
Postkolonialer Feminismus und die Unterdrückung der Frau
- Der Westliche postkoloniale Feminismus als Erbe der Kolonialherren
- Das System Kopftuch als sexuelle Barriere
Fazit
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Über die Abgrenzung von Islam und Orient
2.1 Die„Anderen“ und der Orientalismusdiskurs
3. Postkolonialer Feminismus und die Unterdrückung der Frau
3.1 Der Westliche postkoloniale Feminismus als Erbe der Kolonialherren
3.2 Das System Kopftuch als sexuelle Barriere
4. Fazit
Quellenverzeichnis
Bücher:
Magazine:
Internet:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Fokus dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht, ob heutige Argumente der Islamfeindlichkeit und die Debatte um die muslimische Frau auf Machtverhältnisse der Kolonialzeit zurückzuführen sind.
Was versteht man unter dem „Orientalismusdiskurs“?
Er beschreibt die Abgrenzung und Konstruktion des Orients als das „Andere“ durch den Westen, um eigene Überlegenheit und Herrschaftsstrukturen zu legitimieren.
Welche Rolle spielt der postkoloniale Feminismus in der Analyse?
Es wird kritisch hinterfragt, inwiefern westlicher Feminismus koloniale Denkweisen übernimmt, wenn er die muslimische Frau pauschal als unterdrückt darstellt.
Wie wird das Kopftuch in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit analysiert das Kopftuch im Spannungsfeld zwischen religiöser Praxis, sexueller Barriere und westlichem Symbol für Unterdrückung.
Was kritisieren die Autoren an der aktuellen Islamdebatte in Deutschland?
Es wird beobachtet, dass viele Islamkritiker keine wissenschaftliche Qualifikation besitzen und lediglich bestehende Stereotype und Ängste gegenüber dem „Fremden“ reproduzieren.
Welche Bedeutung haben koloniale Ideologien für das heutige Weltbild?
Die Arbeit argumentiert, dass die während der Kolonialzeit entstandenen Herrschaftsstrukturen das Denken in den Mutterländern nachhaltig verändert haben und bis heute Diskurse prägen.
- Quote paper
- Master of Education; Dipl. Kfm. (FH) Volker Ahmad Qasir (Author), 2011, Der Islam und die muslimische Frau als "Andere", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231218