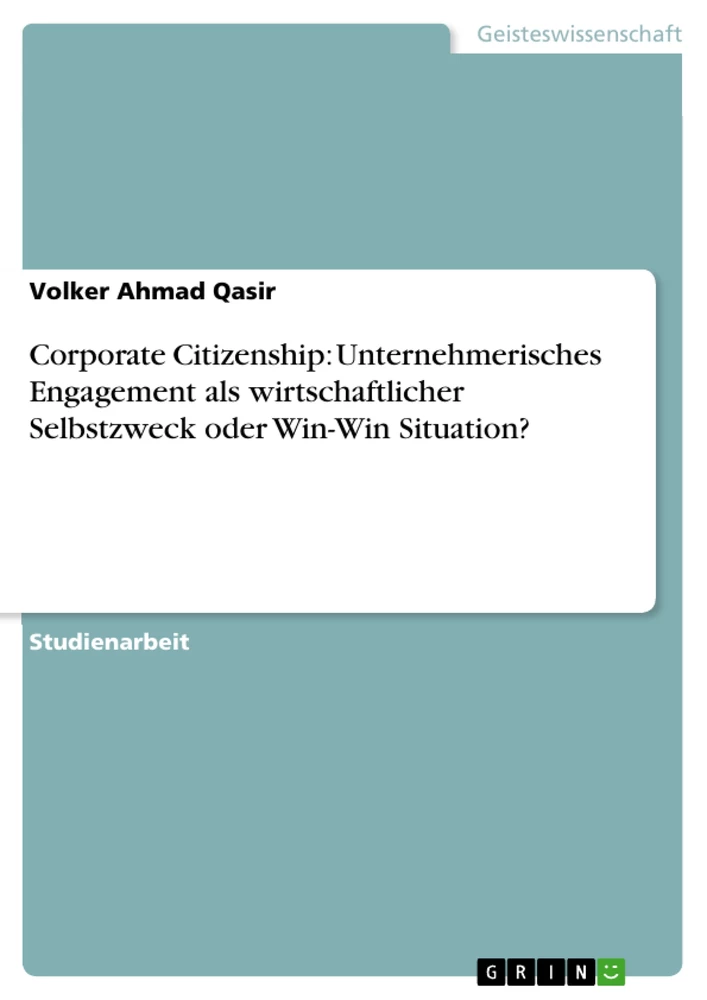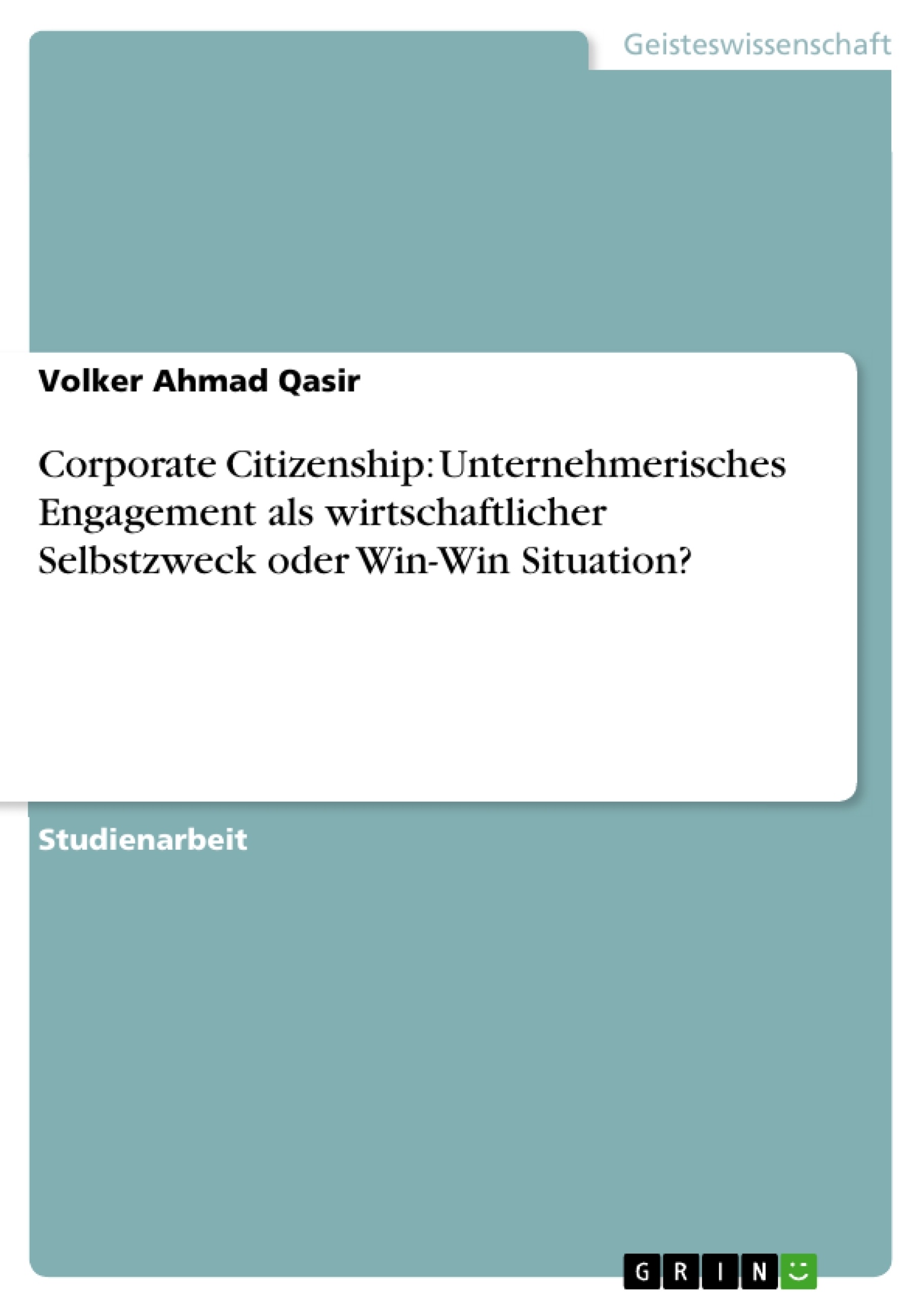Fast täglich stoßen wir in Zeitungsartikeln und Fernsehberichten versteckt, oder ganz offen in Form von Werbemaßnahmen auf die Information, dass sich Wirtschaftsunternehmen auch sozial engagieren und ihrerseits einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten.
Je nach Art und Weise des unternehmerischen Engagements drängt sich dem aufmerksamen Bürger dabei die Frage auf, ob das dahinter stehende Unternehmen tatsächlich am Gemeinwohl interessiert ist oder ob sich hinter der Fassade sozialer Selbstlosigkeit in Wirklichkeit nicht doch ein direktes ökonomisches Interesse verbirgt.
Im Rahmen der Hausarbeit wird zunächst der Begriff des unternehmerischen Engagements erfasst und inhaltlich abgegrenzt. Danach wird das Thema aus unternehmerischer Sicht aufgegriffen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hierbei die Frage, inwiefern wirtschaftlich orientierte Unternehmen von sozialem Engagement profitieren können. Da Unternehmen im Rahmen ihrer Engagement-Aktivitäten oftmals mit gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeiten, wird anschließend unternehmerisches Engagement aus der Sicht von NPOs (Non-Profit-Organisationen) betrachtet und gefragt, wann und wie stark diese davon profitieren.
Zum Schluss werden die Ziele der beiden Parteien (wirtschaftliches Unternehmen und gemeinnützige Organisation) vergleichend gegenüber gestellt und bewertet. Hierbei steht die Frage nach gutem und schlechtem unternehmerischen Engagement im Mittelpunkt und die Frage, wann Einseitigkeit und Benachteiligung auftreten und wann es zu einer Situation kommt, von der alle beteiligten profitieren – der Idealfall, die Win-Win-Situation.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Corporate Citizenship - Was ist das?
- 2.1 Begriffsabgrenzung im Text
- 3. Corporate Citizenship aus Sicht von Unternehmen
- 3.2 Corporate Citizenship als Unternehmens- und Kommunikationsstrategie
- 3.3 Corporate Citizenship und Cause-Related Marketing
- 3.4 Kriterien für ein erfolgreiches Corporate Citizenship
- 3.5 Praxisbeispiel: Krombacher Regenwald-Projekt
- 4. Corporate Citizenship aus Sicht gemeinnütziger Organisationen
- 4.1 Risiken bei der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen
- 4.2 Aspekte einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht unternehmerisches Engagement, insbesondere den Begriff "Corporate Citizenship", und dessen Auswirkungen auf Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Es wird analysiert, ob dieses Engagement ein rein wirtschaftlicher Selbstzweck ist oder ob es zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten führt.
- Definition und Abgrenzung von Corporate Citizenship
- Vorteile und Strategien von Corporate Citizenship für Unternehmen
- Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen
- Risiken und Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit
- Bewertung des unternehmerischen Engagements hinsichtlich Gemeinwohl und wirtschaftlichem Interesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema unternehmerisches Engagement ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem wirtschaftlichen Selbstzweck oder dem Win-Win-Potential von Corporate Citizenship. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Betrachtung aus unternehmerischer und gemeinnütziger Perspektive umfasst, und kündigt den Vergleich der Ziele beider Seiten an, um letztlich "gutes" und "schlechtes" Engagement zu definieren und die Bedingungen für eine Win-Win-Situation zu ergründen.
2. Corporate Citizenship - Was ist das?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Corporate Citizenship" und grenzt ihn ab. Es beschreibt Corporate Citizenship als aktives und systematisches bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen für das Gemeinwohl. Der Zusammenhang mit "Corporate Social Responsibility" wird erläutert. Der Text hebt die Unterschiede im Verständnis von Corporate Citizenship zwischen den USA und Deutschland hervor, wobei in den USA die Freiwilligkeit im Vordergrund steht und in Deutschland eine aktivere gesellschaftliche Rolle von Unternehmen erwartet wird. Der Unterschied wird auf das jeweilige gesellschaftliche und politische Verständnis zurückgeführt. Die Unterschiede in der Freiwilligkeit und staatlichen Regulierung werden deutlich herausgearbeitet.
3. Corporate Citizenship aus Sicht von Unternehmen: Dieses Kapitel behandelt Corporate Citizenship aus Unternehmenssicht, analysiert es als Unternehmens- und Kommunikationsstrategie und im Kontext von Cause-Related Marketing. Es werden Kriterien für erfolgreiches Corporate Citizenship und ein Praxisbeispiel (Krombacher Regenwald-Projekt) vorgestellt. Das Kapitel beleuchtet, wie Unternehmen von sozialem Engagement profitieren und strategisch diese Aktivitäten einsetzen können. Die Analyse zeigt auf, dass Corporate Citizenship nicht nur Imagevorteile sondern auch handfeste wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen generieren kann. Das Praxisbeispiel veranschaulicht diese potentiellen Vorteile und die verschiedenen strategischen Ansätze.
4. Corporate Citizenship aus Sicht gemeinnütziger Organisationen: Aus der Perspektive gemeinnütziger Organisationen (NPOs) werden die Risiken und Aspekte einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen beleuchtet. Hierbei wird untersucht, welche Vor- und Nachteile eine Kooperation mit Unternehmen für NPOs mit sich bringt. Es geht um die Frage wie NPOs von Corporate Citizenship-Initiativen profitieren können, aber auch um die potentiellen Gefahren von Abhängigkeiten oder der Instrumentalisierung für wirtschaftliche Zwecke.
Schlüsselwörter
Corporate Citizenship, Unternehmerisches Engagement, Gemeinwohl, Win-Win-Situation, Corporate Social Responsibility (CSR), Cause-Related Marketing (CRM), gemeinnützige Organisationen (NPOs), Wirtschaftsunternehmen, Zusammenarbeit, Risiken, Erfolgsfaktoren, USA, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Corporate Citizenship: Unternehmerisches Engagement im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gemeinwohl"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht unternehmerisches Engagement, insbesondere den Begriff "Corporate Citizenship", und dessen Auswirkungen auf Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Es wird analysiert, ob dieses Engagement ein rein wirtschaftlicher Selbstzweck ist oder ob es zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten führt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Corporate Citizenship, die Vorteile und Strategien für Unternehmen, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, die damit verbundenen Risiken und Erfolgsfaktoren sowie eine Bewertung des unternehmerischen Engagements hinsichtlich Gemeinwohl und wirtschaftlichem Interesse. Ein Praxisbeispiel (Krombacher Regenwald-Projekt) veranschaulicht die Anwendung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel zu Corporate Citizenship allgemein, zur Unternehmensperspektive (inkl. Strategien und Cause-Related Marketing), zur Perspektive gemeinnütziger Organisationen (inkl. Risiken und Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit), und endet mit einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Was versteht man unter Corporate Citizenship?
Die Arbeit definiert Corporate Citizenship als aktives und systematisches bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen für das Gemeinwohl. Der Zusammenhang mit Corporate Social Responsibility (CSR) wird erläutert. Die Arbeit hebt Unterschiede im Verständnis zwischen den USA (stärkere Freiwilligkeit) und Deutschland (aktivere gesellschaftliche Rolle) hervor.
Welche Vorteile bietet Corporate Citizenship für Unternehmen?
Die Arbeit analysiert Corporate Citizenship als Unternehmens- und Kommunikationsstrategie und zeigt auf, dass es neben Imagevorteilen auch handfeste wirtschaftliche Vorteile generieren kann. Das Praxisbeispiel des Krombacher Regenwald-Projekts illustriert dies.
Welche Risiken und Herausforderungen bestehen bei der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen?
Aus der Perspektive gemeinnütziger Organisationen werden die potenziellen Risiken einer Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen beleuchtet. Es geht um die Vermeidung von Abhängigkeiten und die Instrumentalisierung für wirtschaftliche Zwecke. Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile einer solchen Kooperation.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Corporate Citizenship, Unternehmerisches Engagement, Gemeinwohl, Win-Win-Situation, Corporate Social Responsibility (CSR), Cause-Related Marketing (CRM), gemeinnützige Organisationen (NPOs), Wirtschaftsunternehmen, Zusammenarbeit, Risiken, Erfolgsfaktoren, USA, Deutschland.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Frage ist, ob Corporate Citizenship ein rein wirtschaftlicher Selbstzweck ist oder ob es ein Win-Win-Potential für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen bietet.
Wie wird die Win-Win-Situation bewertet?
Die Arbeit untersucht die Bedingungen für eine Win-Win-Situation durch den Vergleich der Ziele von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen und versucht, "gutes" und "schlechtes" Engagement zu definieren.
- Citation du texte
- Master of Education und Dipl. Kfm. (FH) Volker Ahmad Qasir (Auteur), 2011, Corporate Citizenship: Unternehmerisches Engagement als wirtschaftlicher Selbstzweck oder Win-Win Situation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231220