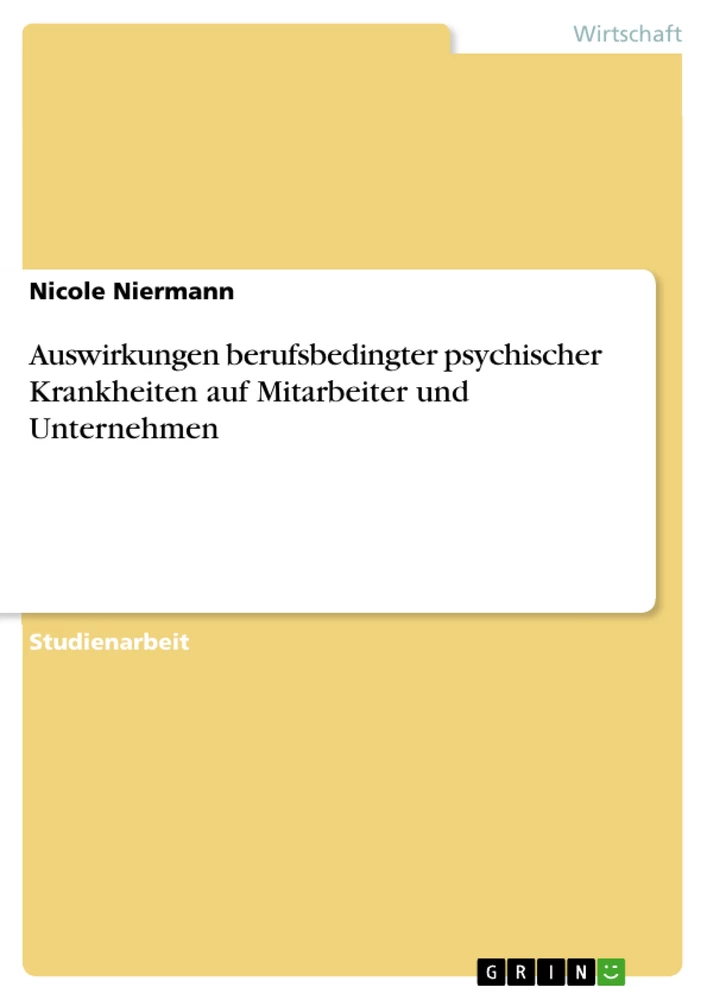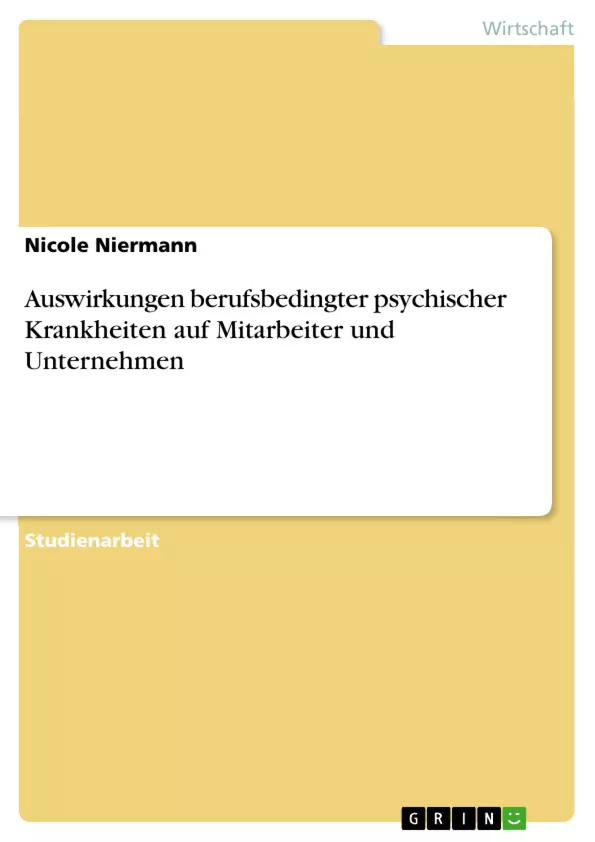Zuerst werde ich wichtige Begrifflichkeiten bezüglich des Themas definieren und Grundlagen darstellen. Im Anschluss stelle ich einige Formen der Krankheiten vor und belege aktuelle Zahlen. Anschließend analysiere ich die Ursachen und gehe auf Folgen bzw. Auswirkungen auf Unternehmen und Mitarbeiter ein. Abschließend soll eine Zusammenfassung den Schluss des Assignments bilden.
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau des Assignments
2 GRUNDLAGEN DER THEMATIK
2.1 Definitionen
2.1.1 „Berufsbedingte" und „arbeitsbedingte" Erkrankungen
2.1.2 Psychische Erkrankungen
2.1.3 Psychische Belastungen und psychische Beanspruchungen
2.2 Aktuelle Zahlen
3 URSACHEN
4 FOLGEN
4.1 Fehlbeanspruchungen im Sinne des Arbeitsschutzes
4.2 Folgen fürden Arbeitnehmer
4.2.1 Angststörung
4.2.2 Depressionen
4.2.3 Somatoforme Störung
4.2.4 Posttraumatische Belastungsstörung
4.2.5 Burn-Out
4.3 Folgen fürden Arbeitgeber
5 ZUSAMMENFASSUNG
LITERATURVERZEICHNIS
- Citation du texte
- Nicole Niermann (Auteur), 2013, Auswirkungen berufsbedingter psychischer Krankheiten auf Mitarbeiter und Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231374