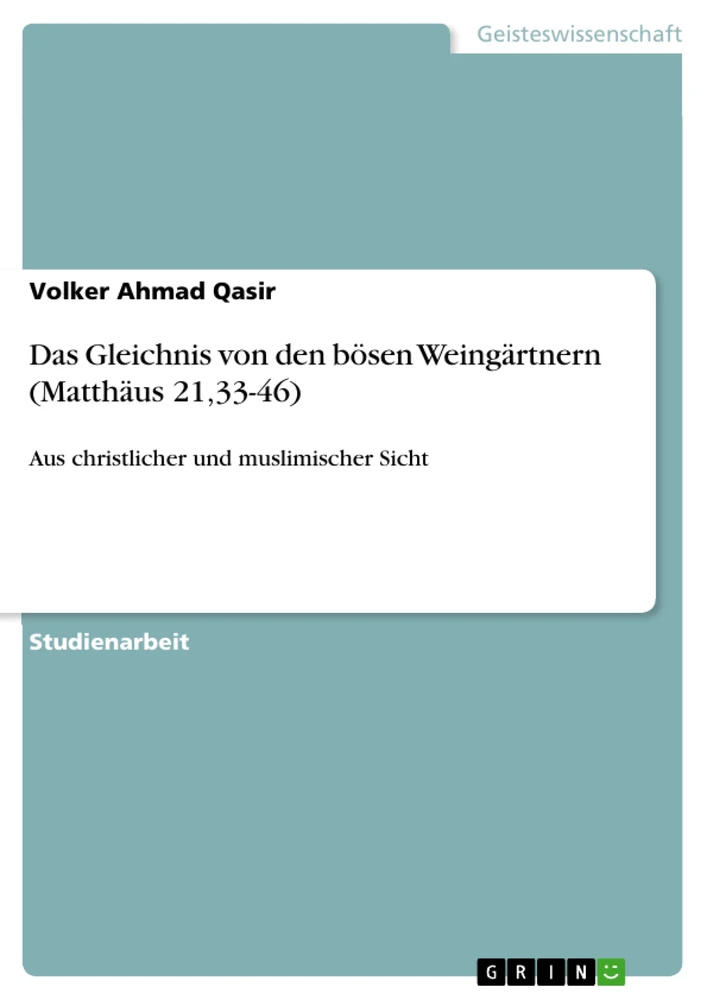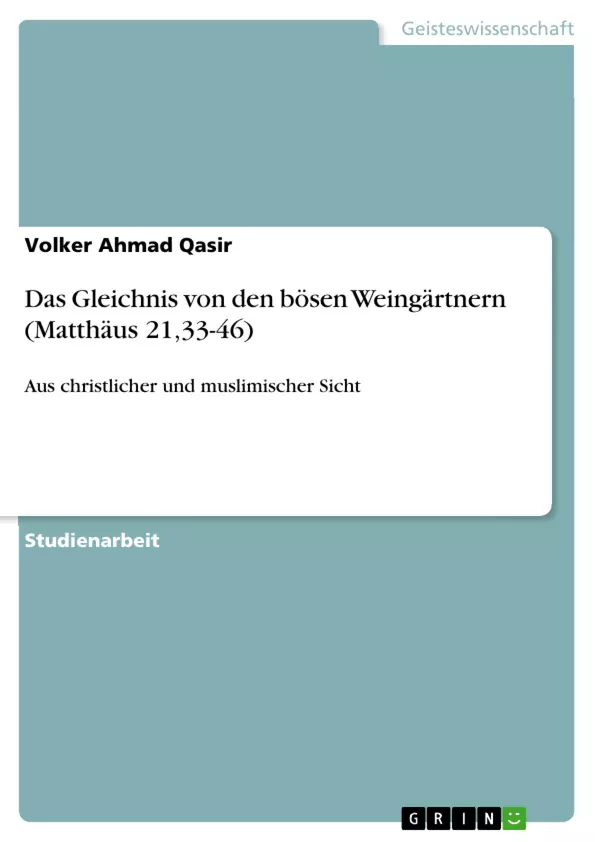Die Person Jesus Christus hat nicht nur im Christentum eine besondere Stellung, sondern auch Muslime, die Anhänger der zweitgrößten Weltreligion, des Islam, verehren Jesus und führen seine religiöse Botschaft auf Gottes Geheiß zurück. Aufgrund der Verschiedenheit der beiden Religionen gestaltet sich die Wahrnehmung Jesu jedoch unterschiedlich. Diese Wahrnehmung soll anhand des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern (Mt 21,33-46) behandelt werden und einen Beitrag zur interreligiösen Verständigung leisten, da sich auch muslimische Kommentatoren auf das Gleichnis beziehen, um den Wahrheitsanspruch des Islam in der Bibel zu verorten.
Im Rahmen der Hausarbeit wird zunächst das Gleichnis von den bösen Weingärtnern (Mt 21,33-46) aus christlich-exegetischer Sicht behandelt. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der Bedeutung des Gleichnisses für den christlichen Glauben. Im Anschluss wird das Gleichnis aus muslimischer Sicht betrachtet. Dies beinhaltet auch das Wissen um die Rolle Jesu im Islam, sowie die Verortung des muslimischen Glaubens innerhalb der biblischen Schriften seitens der Muslime. Nach diesen beiden Hinführungen folgt dann abschließend eine Auslegung des Gleichnisses nach muslimischem Verständnis. Die Arbeit endet mit einem Fazit, in dem die wesentlichen Schlussfolgerungen und Erkenntnisse mit Hinblick auf den interreligiösen Dialog zusammengefasst wiedergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gleichnis in der christlichen Exegese
- Ursprünglichkeit des Gleichnisses
- Erklärung des Gleichnisses
- Die Bedeutung des Gleichnisses aus muslimischer Sicht
- Die Rolle Jesu im Islam
- Biblische Schriften und der Prophet Muhammad
- Muslimische Deutung des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Gleichnis von den bösen Weingärtnern aus christlicher und muslimischer Perspektive, um Einblicke in die unterschiedlichen Wahrnehmungen Jesu in beiden Religionen zu gewinnen und einen Beitrag zur interreligiösen Verständigung zu leisten.
- Die Ursprünglichkeit des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern und seine Bedeutung für den christlichen Glauben.
- Die Rolle Jesu im Islam und die Verortung des muslimischen Glaubens innerhalb der biblischen Schriften.
- Die muslimische Deutung des Gleichnisses und deren Bezüge zum Wahrheitsanspruch des Islam.
- Die Bedeutung des Gleichnisses für den interreligiösen Dialog.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der interreligiösen Verständigung ein und betont die Bedeutung des interreligiösen Dialogs im heutigen kulturellen und religiösen Kontext. Die Arbeit fokussiert auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen Jesu in Christentum und Islam, die anhand des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern untersucht werden.
Das Gleichnis in der christlichen Exegese
Dieses Kapitel analysiert das Gleichnis von den bösen Weingärtnern aus christlich-exegetischer Sicht, insbesondere hinsichtlich seiner Ursprünglichkeit und seiner Bedeutung für den christlichen Glauben. Dabei wird auch auf die Interpretationen von Exegeten eingegangen.
Die Bedeutung des Gleichnisses aus muslimischer Sicht
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle Jesu im Islam und den Umgang mit biblischen Schriften aus muslimischer Perspektive. Es beleuchtet die muslimische Deutung des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern und zeigt, wie dieses Gleichnis für den Wahrheitsanspruch des Islam herangezogen wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Gleichnis von den bösen Weingärtnern, Jesus Christus, interreligiöse Verständigung, christliche Exegese, muslimische Deutung, Wahrheitsanspruch, Bibel, Islam, interreligiöser Dialog.
- Citar trabajo
- Master of Education und Dipl. Kfm. (FH) Volker Ahmad Qasir (Autor), 2012, Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern (Matthäus 21,33-46), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231387