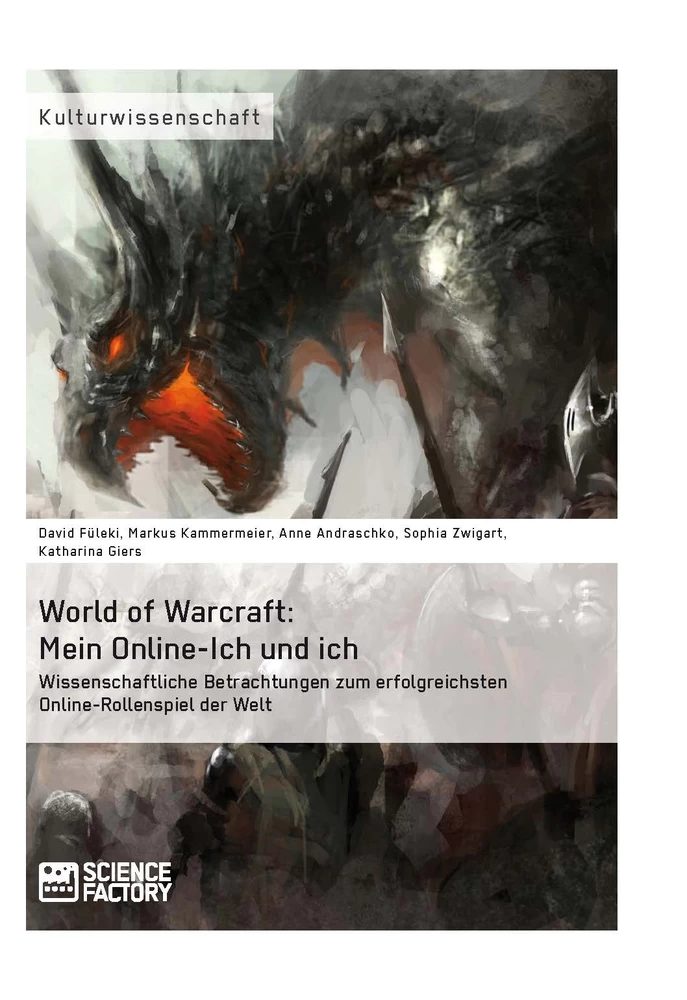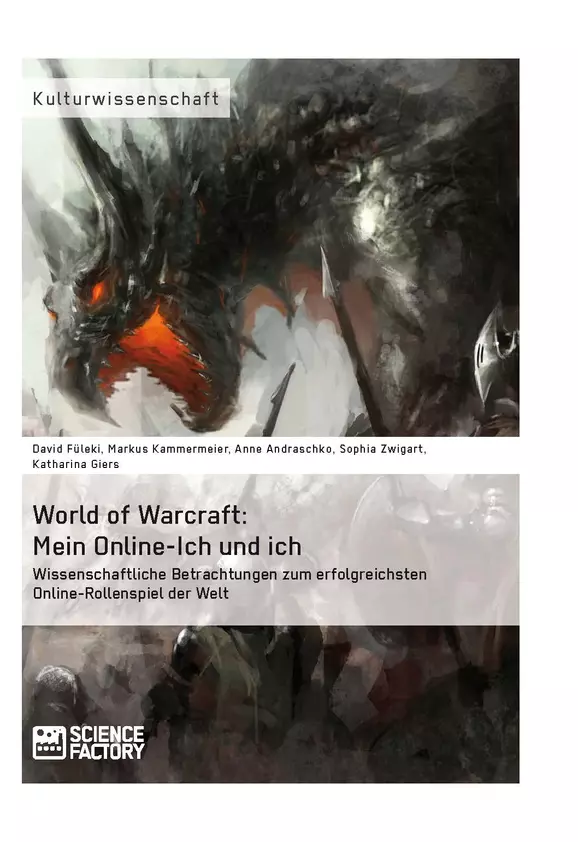Computer- und Konsolenspiele sind in Deutschland eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen – unabhängig von Alter oder sozialem Stand. Das Online-Rollenspiel World of Warcraft ist 2004 erschienen und fesselt seither Millionen Spieler weltweit.
Es gehört zum Spielprinzip, dass sich die Spieler in virtuellen Gemeinschaften organisieren, innerhalb derer sich eine eigene Sprache entwickelt hat. Genau diese Facetten machen World of Warcraft für Wissenschaftler interessant. Welche Motivation haben die Spieler von Word of Warcraft? Wo endet der Spielspaß und wo beginnt die Spielsucht?
Aus dem Inhalt:
Virtuelle Kommune Netz: Das Leben nach dem Alltag
Der Reiz der potenziellen Unendlichkeit
Die Geburt einer neuen Sprache
Einfluss von Online-Rollenspielen auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher
Vereinsamung und Gruppenzugehörigkeit
Computerspielsucht
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kategorisierung von Computerspielen
- Soziologie des Online Gamings
- Online Gaming - Die Revolution der Netz-Community: Wir bauen uns eine eigene Welt
- Schlussbemerkung
- Einleitung
- Überblick über die Arbeit
- Zielbeschreibung
- Begriffsklärung
- Massive Multiplayer Online Role Playing Game
- MMORPG als CSCW am Beispiel World of Warcraft
- World of Warcraft als MMORPG
- Werkzeuge der Kollaboration / WoW als CSCW
- Aspekte der Kollaboration außerhalb von WOW
- Ergebnisse und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Dynamik und die kollaborativen Aspekte von Online-Rollenspielen, insbesondere World of Warcraft. Ziel ist es, ein Verständnis für die Entstehung neuer Gemeinschaften im Kontext von Online-Gaming zu entwickeln und die Mechanismen der Kollaboration zu analysieren.
- Die Kategorisierung von Computerspielen
- Soziologische Aspekte des Online-Gamings
- Die Rolle von World of Warcraft als Beispiel für ein MMORPG
- Kollaborative Werkzeuge und Prozesse innerhalb von World of Warcraft
- Kollaboration im Kontext des Online-Gamings und darüber hinaus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Online-Gamings und seiner sozialen Implikationen ein und liefert einen Überblick über die Forschungsfragen und die Struktur der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Untersuchung der Gemeinschaftsbildung und der Kollaboration im Kontext von MMORPGs.
Kategorisierung von Computerspielen: Dieses Kapitel bietet eine systematische Kategorisierung verschiedener Computerspiele, um den Platz von MMORPGs innerhalb des breiteren Genres zu definieren und deren spezifische Eigenschaften herauszustellen. Die Kategorisierung bildet die Grundlage für die spätere Analyse der sozialen Dynamiken innerhalb von MMORPGs.
Soziologie des Online Gamings: Hier wird ein soziologischer Rahmen für die Untersuchung von Online-Gaming-Gemeinschaften geschaffen. Es werden relevante soziologische Theorien und Konzepte vorgestellt, die zur Analyse der sozialen Strukturen und Prozesse in Online-Spielen herangezogen werden. Dieser Abschnitt dient als theoretische Grundlage für die folgenden Kapitel.
Online Gaming - Die Revolution der Netz-Community: Wir bauen uns eine eigene Welt: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung von Online-Gaming-Communities, insbesondere im Kontext der virtuellen Welten, die von MMORPGs geschaffen werden. Es werden die Besonderheiten dieser Gemeinschaften im Vergleich zu traditionellen sozialen Gruppen untersucht, mit einem Fokus auf die Gestaltung und den Aufbau dieser virtuellen Umgebungen.
Massive Multiplayer Online Role Playing Game: Dieses Kapitel definiert und erklärt das Genre des MMORPGs detailliert. Es beschreibt die charakteristischen Merkmale dieser Spiele, wie die persistierende Spielwelt, die große Anzahl an Spielern und die komplexen sozialen Interaktionen. Diese Definition ist essentiell für das Verständnis der folgenden Analysen von World of Warcraft.
MMORPG als CSCW am Beispiel World of Warcraft: Dieses Kapitel analysiert World of Warcraft als Beispiel für Computer-Supported Cooperative Work (CSCW). Es untersucht, wie die Spielmechaniken und die virtuelle Welt die Zusammenarbeit zwischen Spielern unterstützen und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich daraus ergeben. Die Analyse konzentriert sich auf die Werkzeuge und Mechanismen, die die Kooperation fördern.
World of Warcraft als MMORPG: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die spezifischen Eigenschaften von World of Warcraft als MMORPG. Er beleuchtet die einzigartige Spielwelt, die Charakterentwicklung, die Quests und die sozialen Interaktionen, die das Spielerlebnis prägen. Diese detaillierte Beschreibung dient als Basis für die spätere Analyse der Kollaboration.
Werkzeuge der Kollaboration / WoW als CSCW: In diesem Kapitel werden die konkreten Werkzeuge und Mechanismen in World of Warcraft analysiert, die die Zusammenarbeit der Spieler ermöglichen und unterstützen. Beispiele reichen von der gemeinsamen Bearbeitung von Quests bis hin zu Gildenstrukturen und Kommunikationssystemen. Die Analyse beleuchtet, wie diese Werkzeuge die soziale Interaktion und die Kollaboration beeinflussen.
Aspekte der Kollaboration außerhalb von WOW: Dieser Abschnitt erweitert die Perspektive und betrachtet die Kollaboration im Kontext von Online-Gaming über die Grenzen von World of Warcraft hinaus. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen MMORPGs und Online-Spielen betrachtet und die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere soziale Kontexte diskutiert.
Schlüsselwörter
Online-Rollenspiele, MMORPG, World of Warcraft, Kollaboration, Gemeinschaftsbildung, virtuelle Gemeinschaften, Soziologie des Gamings, CSCW, Online-Community.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der sozialen Dynamik und kollaborativen Aspekte von Online-Rollenspielen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die soziale Dynamik und die kollaborativen Aspekte von Online-Rollenspielen, insbesondere World of Warcraft. Das Ziel ist es, die Entstehung neuer Gemeinschaften im Kontext von Online-Gaming zu verstehen und die Mechanismen der Kollaboration zu analysieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kategorisierung von Computerspielen, soziologische Aspekte des Online-Gamings, die Rolle von World of Warcraft als MMORPG, kollaborative Werkzeuge und Prozesse innerhalb von World of Warcraft und Kollaboration im Kontext des Online-Gamings und darüber hinaus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Kategorisierung von Computerspielen, zur Soziologie des Online-Gamings, zur Analyse von Online-Gaming-Communities, eine detaillierte Betrachtung von MMORPGs und World of Warcraft als Beispiel für CSCW (Computer-Supported Cooperative Work), sowie eine Analyse der Kollaborationswerkzeuge in WoW und einen Ausblick auf die Kollaboration außerhalb von WoW. Schließlich folgt eine Schlussbemerkung.
Was wird unter „Kollaboration“ im Kontext dieser Arbeit verstanden?
„Kollaboration“ bezieht sich auf die Zusammenarbeit der Spieler innerhalb von World of Warcraft und anderen Online-Rollenspielen. Analysiert werden die Mechanismen und Werkzeuge, die diese Zusammenarbeit ermöglichen und unterstützen, wie z.B. gemeinsame Quests, Gildenstrukturen und Kommunikationssysteme.
Welche Rolle spielt World of Warcraft in dieser Arbeit?
World of Warcraft dient als Fallstudie, um die theoretischen Konzepte der sozialen Dynamik und Kollaboration in MMORPGs zu veranschaulichen und zu analysieren. Die Arbeit untersucht detailliert die Spielmechaniken, die virtuelle Welt und die sozialen Interaktionen innerhalb von World of Warcraft.
Welche soziologischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit nutzt soziologische Theorien und Konzepte, um die Entstehung und Entwicklung von Online-Gaming-Communities zu verstehen. Es werden die Besonderheiten dieser Gemeinschaften im Vergleich zu traditionellen sozialen Gruppen untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Online-Rollenspiele, MMORPG, World of Warcraft, Kollaboration, Gemeinschaftsbildung, virtuelle Gemeinschaften, Soziologie des Gamings, CSCW, Online-Community.
Welche konkreten Beispiele für Kollaboration in World of Warcraft werden analysiert?
Die Analyse umfasst die gemeinsame Bearbeitung von Quests, Gildenstrukturen und verschiedene Kommunikationssysteme innerhalb des Spiels. Es wird untersucht, wie diese Werkzeuge die soziale Interaktion und die Kollaboration beeinflussen.
Wie wird die Kategorisierung von Computerspielen in der Arbeit verwendet?
Die Kategorisierung dient dazu, den Platz von MMORPGs innerhalb des breiteren Genres der Computerspiele zu definieren und ihre spezifischen Eigenschaften hervorzuheben. Dies bildet die Grundlage für die spätere Analyse der sozialen Dynamiken innerhalb von MMORPGs.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Art und Weise, wie Online-Rollenspiele virtuelle Gemeinschaften schaffen und die Mechanismen der Kollaboration innerhalb dieser Gemeinschaften funktionieren. Die Ergebnisse werden auch im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf andere soziale Kontexte diskutiert.
- Quote paper
- David Füleki (Author), Markus Kammermeier (Author), Katharina Giers (Author), Anne Andraschko (Author), Sophia Zwigart (Author), 2013, World of Warcraft: Mein Online-Ich und ich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231412