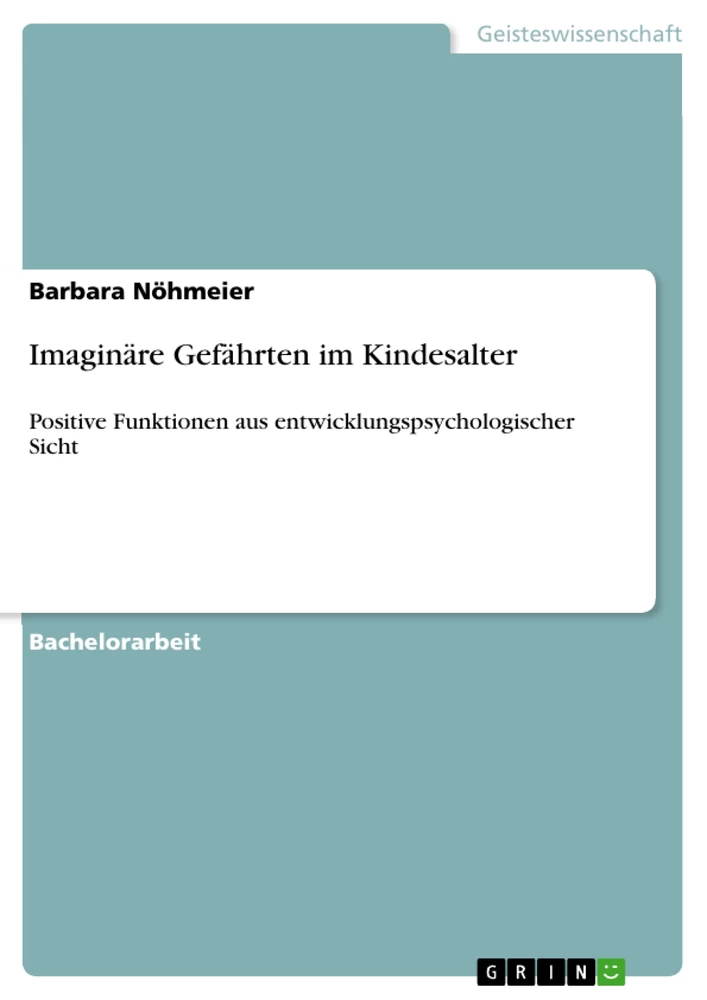Imaginäre Gefährten sind bei Kindern keine Seltenheit. Im Gegenteil, man geht davon aus, dass bis zu 65% der Kinder einen imaginären Gefährten in Form eines unsichtbaren Freundes, eines personifizierten Spielzeuges oder in Gestalt eines fiktiven, von ihnen verkörperten Charakters haben. Diese Begleiter erfüllen gewisse adaptive und entwicklungspsychologische Funktionen. Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden zu diesen positiven Funktionen Studien aus den letzten zehn Jahren gesichtet und bezüglich ihrer Aussagekraft und neuerer Erkenntnisse auf zwei Schwerpunktthemen vorgestellt und diskutiert: Angstbewältigung und Förderung der Sprachentwicklung. Die Untersuchungen zur Förderung der Sprachentwicklung sprechen den hauptsächlich unsichtbaren imaginären Freunden in einigen Facetten deutliche Effekte nach. So verfügen Kinder mit imaginären Gefährten über eine reifere Sprache mit komplexerem und inhaltlich verbundenerem Satzbau, sowie über eine bessere auditive Vorstellungskraft. Desweiteren können sie sich in der Kommunikation ihrem Gesprächspartner verständlicher mitteilen und weisen eine bessere erzählerische Qualität auf als Kinder ohne imaginäre Gefährten. Dennoch bleibt die Frage nach der Kausalität ungeklärt, denn der Effekt kann theoretisch auch in entgegengesetzter Weise verlaufen, indem sich Kinder mit weiterentwickelter Sprache einen imaginären Gefährten zur Kommunikation schaffen. Personifizierte Objekte wie Kuscheltiere scheinen sich den Studienergebnissen nach bestens zur Angstbewältigung zu eignen, sei es in ihrer Rolle als Beschützer oder als verängstigter Freund, den es zu trösten gilt. Als ein wichtiger Faktor, der diese Funktion des imaginären Gefährten beeinflusst, erwies sich der Grad der Bindung an ihn.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theorie der Funktionen imaginärer Gefährten
2.1 Adaptive Funktionen
2.2 Weitere entwicklungspsychologische Funktionen
2.3 Fragestellung
3 Die Literaturrecherche
3.1 Ein- und Ausschlusskriterien
3.2 Datenbanken
3.3 Schlagwörter
4 Ergebnisse
4.1 Förderung der Sprachentwicklung
4.1.1 Sprachgebrauch
4.1.2 Auditive Vorstellungskraft und Sprachgefühl
4.1.2.1 Studie I
4.1.2.2 Studie II
4.1.3 Visuelle und auditive Vorstellungskraft und sprachliche Fertigkeiten
4.1.4 Referentielle Kommunikation
4.1.5 Erzählerische Fertigkeiten
4.2 Angstbewältigung
4.2.1 Die Huggy-Puppy-Intervention
4.2.1.1 Studie I
4.2.1.2 Studie II
4.2.2 Nachtangst
4.2.3 Das Teddybärkrankenhaus
5 Diskussion
6 Literaturverzeichnis
7 Pressemitteilung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Stichproben in den Studien zur Förderung der Sprachentwicklung durch imaginäre Gefährten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ergebnisse in der Sprechkomponente und Anzahl der Redundanzen
Abbildung 2: Ergebnisse im Hörverstehen und Anzahl redundanter Nachfragen im Hörverstehen
Abbildung 3: Ergebnisse in Geschichtenverständnis, Erzählqualität in Geschichtenwiedergabe und in Beschreibung eines vergangenen Ereignisses
Abbildung 4: Ergebnisse der Subkategorien in der Geschichtenwiedergabe
Abbildung 5: Ergebnisse der Subkategorien in der Erzählung eines zurückliegenden
Ereignisses
Abbildung 6: Stressreaktionen der Kinder im Kriegsgeschehen
Abbildung 7: Effekt der HPI auf Stressreaktionen im Verlauf der Intervention in
Studie I
Abbildung 8: Effekt der HPI auf Stressreaktionen im Verlauf der Intervention in
Studie II
Abbildung 9: Ausmaß der Nachtangst in beiden Interventionsgruppen im Verlauf der Intervention
Abbildung 10: Angst vor einem Krankenhausaufenthalt vor und nach der
Intervention
Häufig gestellte Fragen
Sind imaginäre Gefährten ein Zeichen für psychische Probleme?
Nein, sie sind bei bis zu 65% aller Kinder vorhanden und erfüllen wichtige adaptive und entwicklungspsychologische Funktionen.
Wie fördern unsichtbare Freunde die Sprachentwicklung?
Kinder mit imaginären Gefährten verfügen oft über einen komplexeren Satzbau, eine bessere Erzählqualität und eine reifere Kommunikation.
Können imaginäre Gefährten bei der Angstbewältigung helfen?
Ja, insbesondere personifizierte Objekte wie Kuscheltiere dienen als Beschützer oder als „Freunde“, die getröstet werden müssen, was die Selbstregulation fördert.
Was ist die Huggy-Puppy-Intervention?
Es ist eine Methode, bei der Kinder in Stresssituationen (z.B. Krieg oder Krankenhaus) eine Puppe erhalten, um durch die Fürsorge für diese ihre eigenen Ängste zu reduzieren.
Welche Rolle spielt die auditive Vorstellungskraft?
Kinder mit unsichtbaren Freunden trainieren ständig ihr inneres Gehör und ihre Vorstellungskraft, was sich positiv auf das Hörverstehen und Sprachgefühl auswirkt.
- Citar trabajo
- Barbara Nöhmeier (Autor), 2012, Imaginäre Gefährten im Kindesalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231424