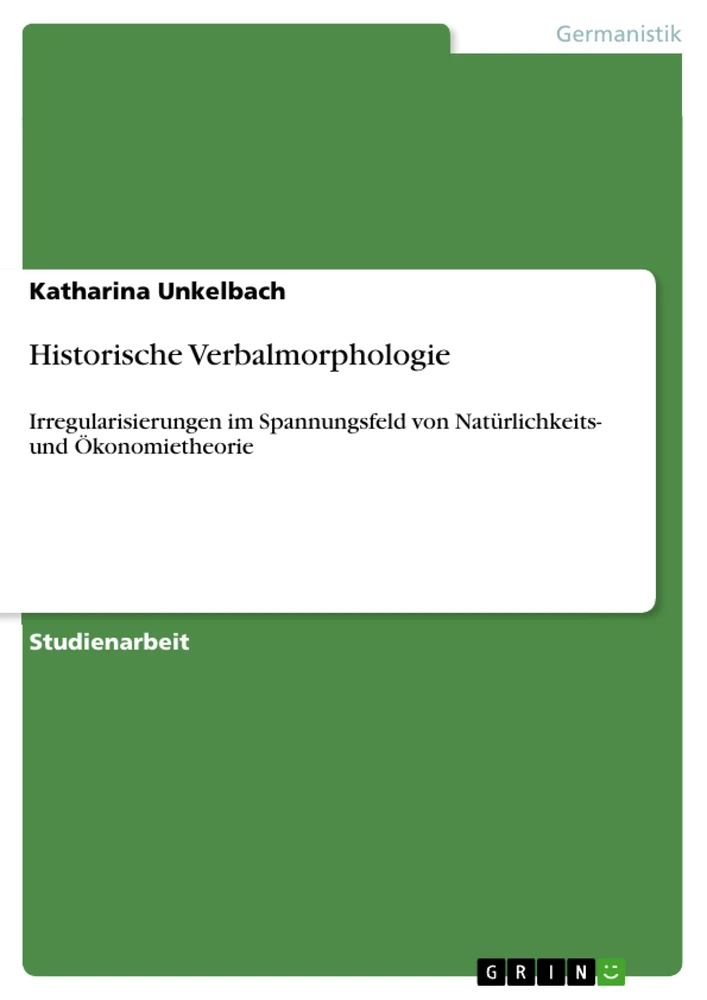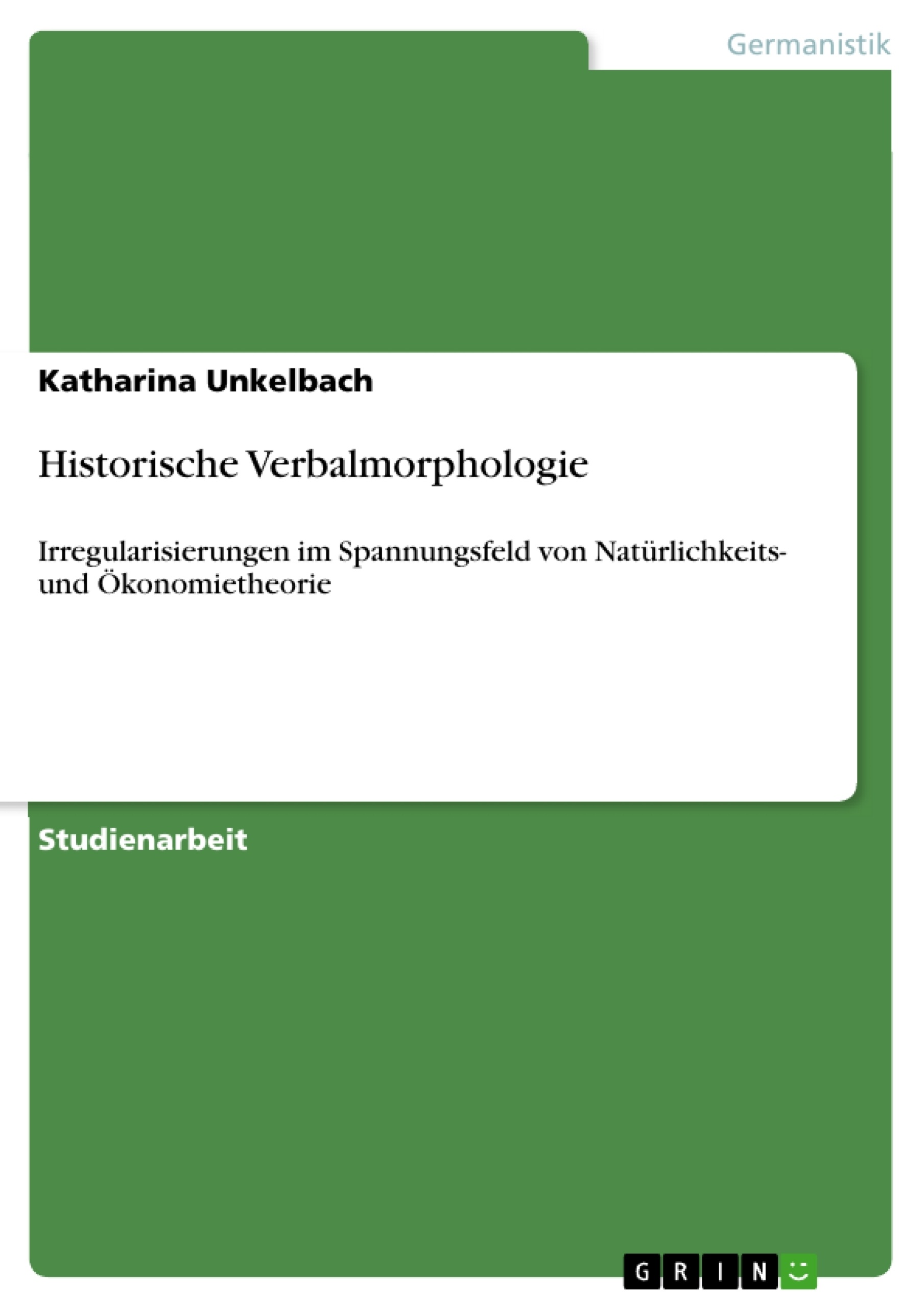Unter welchen Bedingungen werden bestehende morphologische Formen konserviert – welche Faktoren begünstigen die Entstehung von Irregularität und Differenzierung? Sprachwissenschaftler wie MAYERTHALER (1981) oder WURZEL (1994) sind der Auffassung, dass die Prinzipien der Einfachheit und des Ikonismus das oberste Ziel von Sprachwandel sind und irreguläre Entwicklungen unnatürlich und wenn überhaupt, nur von temporärer Dauer sein können.
Neben der Natürlichkeitstheorie existiert die Ökonomietheorie, die über erstere Theorie in dem Punkt hinausgeht, dass zusätzlich die essentielle Rolle von sprachexternen Faktoren wie die Bedeutung von Gebrauchsfrequenzen berücksichtigt wird. Hierbei steht im Fokus der Betrachtung, dass reguläre Formen zwar oftmals produktiv sind, aber Einheitlichkeit dennoch nicht als primäres und übergeordnetes Ziel einer Sprache und auch nicht von Sprachwandel betrachtet werden kann.
Um dies zu verdeutlichen, wird in Kapitel 2 zunächst das Konzept der morphologischen Natürlichkeit erläutert. Im Anschluss werden dann ausgewählte Schwachpunkte der Natürlichkeitstheorie skizziert. In Kapitel 3 soll im Rahmen der Ökonomietheorie untersucht werden, welche Rolle Gebrauchs- und kategorielle Frequenzen bei der Entstehung von unregelmäßigen morphologischen Strukturen spielen. In Kapitel 3.4 werden Irregularisierungen hinsichtlich der Relevanz verschiedener Verbalkategorien erklärt, die Irregularisierung eher fördern beziehungsweise hemmen. An ausgewählten Beispielen wie dem nhd. Verb haben sollen Nutzen und Effektivität von differenzierten Formen verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Natürlichkeitstheorie
- Definition von morphologischer Natürlichkeit
- Schwachpunkte der Natürlichkeitstheorie
- Irregularisierungen im Kontext der Ökonomietheorie
- Konflikt zwischen Natürlichkeits- und Ökonomietheorie
- Gebrauchsfrequenzen als Determinator von Irregularität
- Verbalkategorielle Frequenzen
- Relevanzbedingte Irregularisierungen
- Nutzen von Irregularisierungen
- Ökonomietheorie am Bsp. des nhd. Verbs haben
- Regularisierungen bei abnehmender Gebrauchsfrequenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen bestehende morphologische Formen konserviert werden und welche Faktoren die Entstehung von Irregularität und Differenzierung begünstigen. Sie stellt zwei konkurrierende Theorien gegenüber: die Natürlichkeitstheorie, die auf Einfachheit und Ikonismus fokussiert, und die Ökonomietheorie, die die Bedeutung von Gebrauchsfrequenzen und sprachlichen Effizienz zusätzlich berücksichtigt.
- Morphologische Natürlichkeit und ihre Schwachpunkte
- Der Einfluss von Gebrauchsfrequenzen auf Irregularisierungen
- Die Rolle von Verbalkategorien bei der Entstehung von Irregularität
- Der Nutzen von Irregularisierungen in sprachlicher Kommunikation
- Die Bedeutung von sprachlichen Ökonomie für Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung nach der Entstehung von Irregularitäten in der Morphologie vor und skizziert die zwei zentralen Theorien, die im weiteren Verlauf beleuchtet werden: die Natürlichkeitstheorie und die Ökonomietheorie.
- Natürlichkeitstheorie: Dieses Kapitel definiert das Konzept der morphologischen Natürlichkeit und beschreibt die zentralen Prinzipien, die als "natürlich" gelten. Es werden auch Kritikpunkte an der Natürlichkeitstheorie aufgezeigt, die sich insbesondere auf die Rolle von starken Verben im Spracherwerb konzentrieren.
- Irregularisierungen im Kontext der Ökonomietheorie: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Gebrauchsfrequenzen und kategorialen Frequenzen bei der Entstehung von Irregularitäten. Es analysiert, wie die Häufigkeit des Gebrauchs einer Form die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass sie irregularisiert wird. Außerdem wird die Bedeutung von Verbalkategorien für Irregularisierungen untersucht. Das Kapitel beleuchtet auch die Vorteile von differenzierten Formen im Sprachgebrauch und veranschaulicht diese am Beispiel des Verbs "haben".
Schlüsselwörter
Morphologische Natürlichkeit, Irregularisierung, Ökonomietheorie, Gebrauchsfrequenzen, Verbalkategorien, Sprachwandel, starke Verben, schwache Verben, Ikonismus, Transparenz, Uniformität, Flexionsparadigma, Suppletion, nhd. Verb "haben".
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Natürlichkeitstheorie in der Sprachwissenschaft?
Sie geht davon aus, dass Sprachwandel primär auf Vereinfachung, Transparenz und Ikonismus abzielt und unregelmäßige Formen nur temporär sind.
Was ist der Kern der Ökonomietheorie?
Die Ökonomietheorie betont, dass Irregularität oft durch hohe Gebrauchsfrequenz konserviert wird, da häufig genutzte Formen im Gedächtnis stabiler verankert sind.
Warum bleiben unregelmäßige Verben wie "haben" bestehen?
Das Verb "haben" wird so häufig verwendet, dass seine unregelmäßige Form trotz der Tendenz zur Vereinfachung ökonomisch effizient bleibt und nicht regularisiert wird.
Was sind "verbalkategorielle Frequenzen"?
Es beschreibt die Häufigkeit bestimmter grammatikalischer Kategorien (z.B. Tempus), die beeinflussen, ob ein Verb eher zur Irregularisierung oder zur Regularisierung neigt.
Wann treten Regularisierungen auf?
Regularisierungen (z.B. der Übergang von starken zu schwachen Verben) treten meist dann auf, wenn die Gebrauchsfrequenz eines Wortes abnimmt.
- Citation du texte
- Katharina Unkelbach (Auteur), 2013, Historische Verbalmorphologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231519