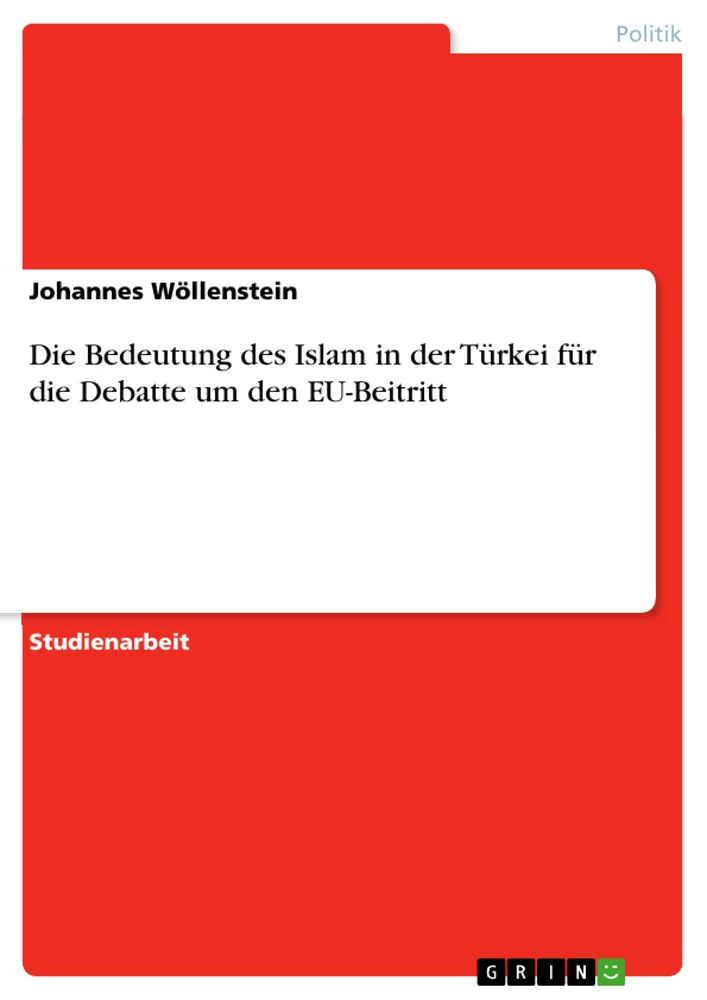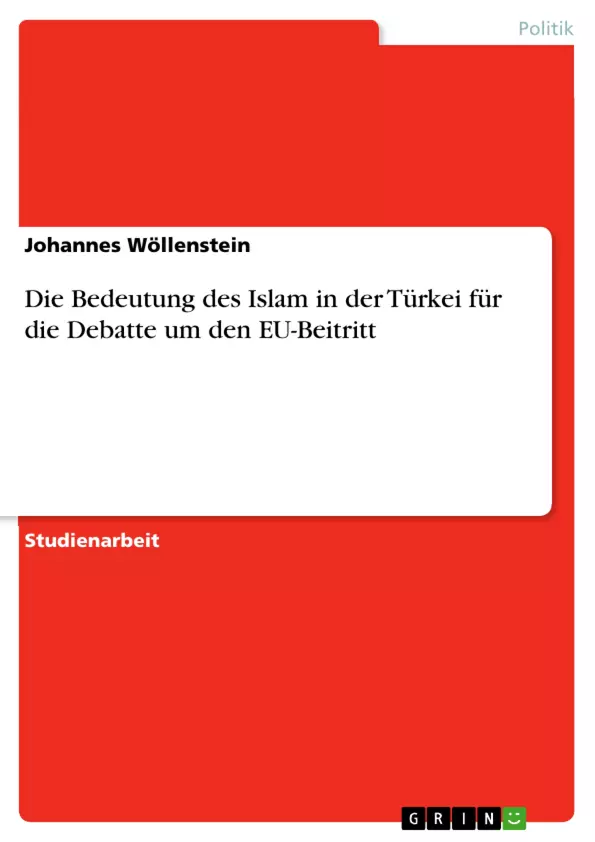Der vorliegenden Ausarbeitung liegt folgende Forschungsfrage zugrunde: „Welche Bedeutung hat die Tatsache, dass die Türkei ein stark vom islamischen Glauben geprägter Staat ist, in der Debatte um den EU-Beitritt?" Das Untersuchungsziel liegt dabei in der Frage, ob ungeachtet dessen, dass der EU an keinem Punkt der Europäischen Verträge eine bestimmte Religion zugeordnet wird, der Aspekt der Religion dennoch als Argumentationsgrundlage im Beitrittsdiskurs genutzt wird. Der Schwerpunkt der Untersuchung wird dementsprechend auf einer Analyse der direkten Argumente der religiös-kulturellen Argumentationslinie, wie sie insbesondere von deutschen Argumentationsführern häufig genutzt wird, liegen. Die bereits lang andauernde Entwicklung des Beitrittsprozesses der Türkei findet in dieser Arbeit keine Berücksichtigung, da dies an dem Zielinteresse vorbeiführen würde.
Methodisch erfolgt die Bearbeitung der Thematik dieser Hausarbeit vor allem durch die Nutzung vorhandener Publikationen. Zudem wird partiell auf die Vertragstexte der EU Bezug genommen. Dementsprechend ergibt sich ein vorrangig hermeneutisches Vorgehen.
Zu Beginn der Untersuchung werden die historischen Entwicklungen in der Türkei und speziell die türkisch-europäischen Beziehungen dargestellt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Beschreibung des Wandels des Verhältnisses zwischen Staat und Religion in der Türkei vom Osmanischen Reich bis in die Jetztzeit. Daran anknüpfend werden kurz die Beitrittskriterien beschrieben, welche als Grundlage der im Anschluss aufgeführten Argumentationslinien zur Frage des Türkeibeitritts dienen. Von besonderem Interesse wird hierbei die religiös-kulturelle Argumentationslinie sein, auf der daher auch der Schwerpunkt der Untersuchung liegen wird. Abschließend wird die Bedeutung der religiös-kulturellen Argumentationslinie in Relation zur Grundsatzfrage der Finalität der EU gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historische Entwicklung
3. Beitrittskriterien
4. Diskurse
4.1 Religiös-kulturelle Argumentationslinie
4.1.1 Exkludierende Argumente
4.1.2 Inkludierende Argumente
4.2 Einfluss der Finalitätsmodelle Europas
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturliste
- Arbeit zitieren
- Johannes Wöllenstein (Autor:in), 2013, Die Bedeutung des Islam in der Türkei für die Debatte um den EU-Beitritt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231616