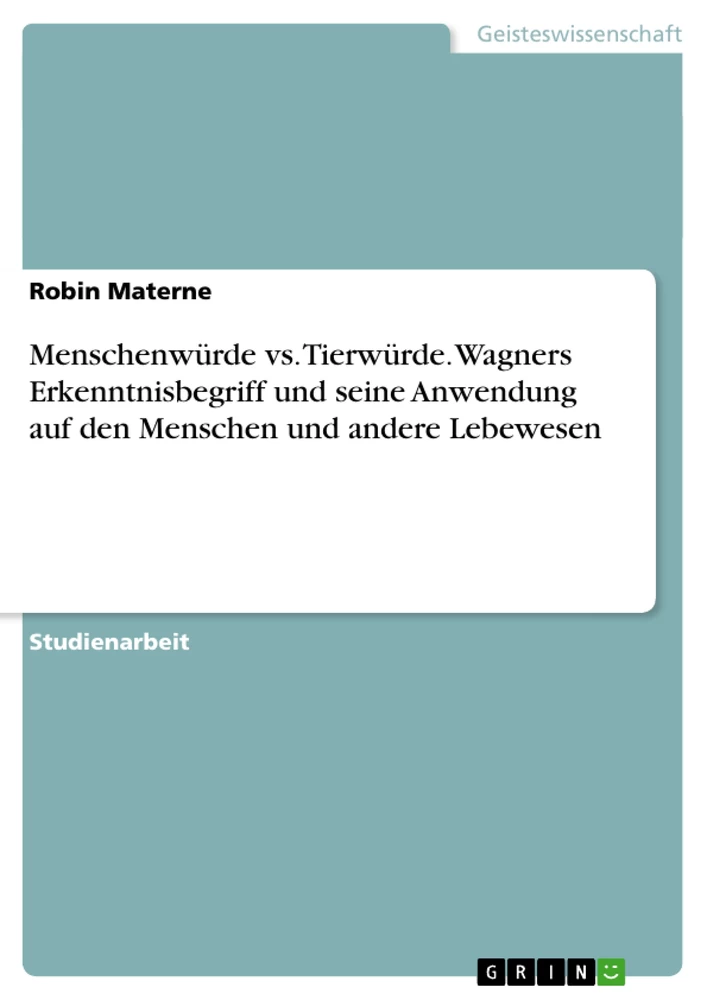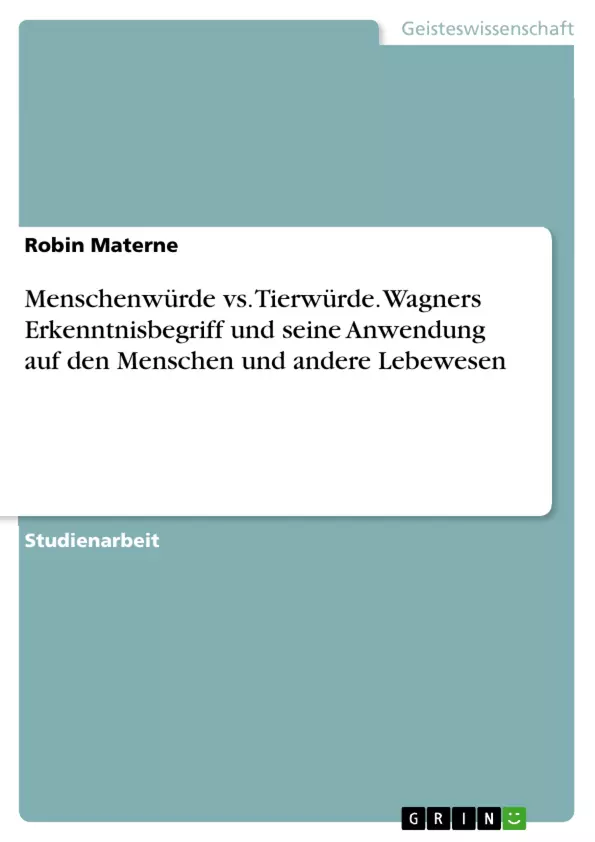„Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie!“ Mit diesem Satz spricht Schiller in seinem Gedicht „Die Künstler“, zwar nur selbige an, aber man kann es auch gut als eine Aufforderung an alle Menschen sehen, die ihnen zuteil kommende Würde und die der anderen Menschen zu achten und zu schützen. Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass dem Mensch Würde zugesprochen wird? Gibt es eine Begründung warum gerade wir eine besondere Art der Würde, nämlich die Menschenwürde besitzen und somit eine Sonderstellung unter den Lebewesen einnehmen? Hans Wagner nimmt sich dieser Frage in seinem Spätwerk „Die Würde des Menschen“ an und führt eine mögliche Begründung an. Es soll nun geprüft werden, ob seine Begründung wirklich nur auf den Menschen und somit auch auf alle Menschen oder auch auf andere Lebewesen zutrifft. Die in dieser Diskussion oftmals angeführten präferenzutilitaristischen Gründe werden hier nicht weiter berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wagners Erkenntnisbegriff
- Sprachfähigkeit von Tieren
- Tierwürde
- Erkenntnisfähigkeit von Kleinkindem und schwer geistig Behinderten
- Erweiterung oder Einschränkung des Würdebegriffs?
- Quellen und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit der philosophischen Frage nach der Menschenwürde auseinander und untersucht, ob die von Hans Wagner in seinem Werk „Die Würde des Menschen“ gegebene Begründung für die Menschenwürde auch auf andere Lebewesen, insbesondere Tiere, anwendbar ist. Der Text analysiert Wagners Erkenntnisbegriff und seine Argumentation, die auf der menschlichen Fähigkeit zum Denken und zur Erkenntnis basiert. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob auch sprachlose Wesen, wie Tiere, denken können und ob ihnen aufgrund ihrer Fähigkeiten eine eigene Würde zukommen könnte. Schließlich wird die Herausforderung diskutiert, die sich aus der Anwendung von Wagners Würdebegründung auf Kleinkinder und schwer geistig Behinderte ergibt.
- Wagners Erkenntnisbegriff als Grundlage für die Menschenwürde
- Die Frage nach der Denk- und Erkenntnisfähigkeit von Tieren
- Die Implikationen von Wagners Würdebegründung für den Umgang mit Tieren
- Die Herausforderung der Anwendung des Würdebegriffs auf Kleinkinder und schwer geistig Behinderte
- Die mögliche Erweiterung oder Einschränkung des Würdebegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung führt in die Thematik der Menschenwürde ein und stellt die zentrale Frage der Arbeit: Ob Wagners Begründung für die Menschenwürde auch auf andere Lebewesen zutrifft. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und skizziert die Argumentationslinie der Arbeit.
-
Das Kapitel „Wagners Erkenntnisbegriff“ analysiert den von Hans Wagner entwickelten Erkenntnisbegriff, der als Grundlage für seine Begründung der Menschenwürde dient. Wagner argumentiert, dass Erkenntnis ausschließlich ein Produkt menschlichen Denkens ist, und stellt die Frage, ob dies auch für Tiere gilt. Dieses Kapitel untersucht die zentralen Elemente von Wagners Erkenntnisbegriff und seine Implikationen für die Frage der Tierwürde.
-
Das Kapitel „Sprachfähigkeit von Tieren“ befasst sich mit der Frage, ob auch sprachlose Wesen denken können. Es wird diskutiert, ob Sprache eine notwendige Voraussetzung für Denken ist und ob Tiere, insbesondere Menschenaffen, über eine eigene Form der Kommunikation verfügen, die als Sprache bezeichnet werden kann. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Positionen zum Thema der tierischen Sprachfähigkeit und analysiert die Argumente für und gegen die Annahme eines tierischen Denkens.
-
Das Kapitel „Tierwürde“ untersucht, ob Wagners Würdebegründung auch auf Tiere angewendet werden kann. Es wird diskutiert, ob Tieren aufgrund ihrer Denk- und Erkenntnisfähigkeit eine eigene Würde zukommen könnte. Das Kapitel analysiert Wagners Position zum Thema der Tierwürde und beleuchtet die ethischen Implikationen, die sich aus der Anerkennung einer Tierwürde ergeben würden.
-
Das Kapitel „Erkenntnisfähigkeit von Kleinkindem und schwer geistig Behinderten“ diskutiert die Anwendung von Wagners Würdebegründung auf Kleinkinder und schwer geistig Behinderte. Es wird untersucht, ob diese Menschen aufgrund ihrer eingeschränkten Denkfähigkeit vom Würdebegriff ausgeschlossen werden müssen. Das Kapitel beleuchtet die ethischen Herausforderungen, die sich aus der Anwendung von Wagners Würdebegründung auf Menschen mit besonderen Bedürfnissen ergeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Menschenwürde, den Erkenntnisbegriff, die Denkfähigkeit, die Tierwürde, die Sprachfähigkeit von Tieren, die ethischen Implikationen der Anerkennung von Tierwürde, die Anwendung des Würdebegriffs auf Kleinkinder und schwer geistig Behinderte sowie die Erweiterung oder Einschränkung des Würdebegriffs.
- Quote paper
- Robin Materne (Author), 2012, Menschenwürde vs. Tierwürde. Wagners Erkenntnisbegriff und seine Anwendung auf den Menschen und andere Lebewesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231642