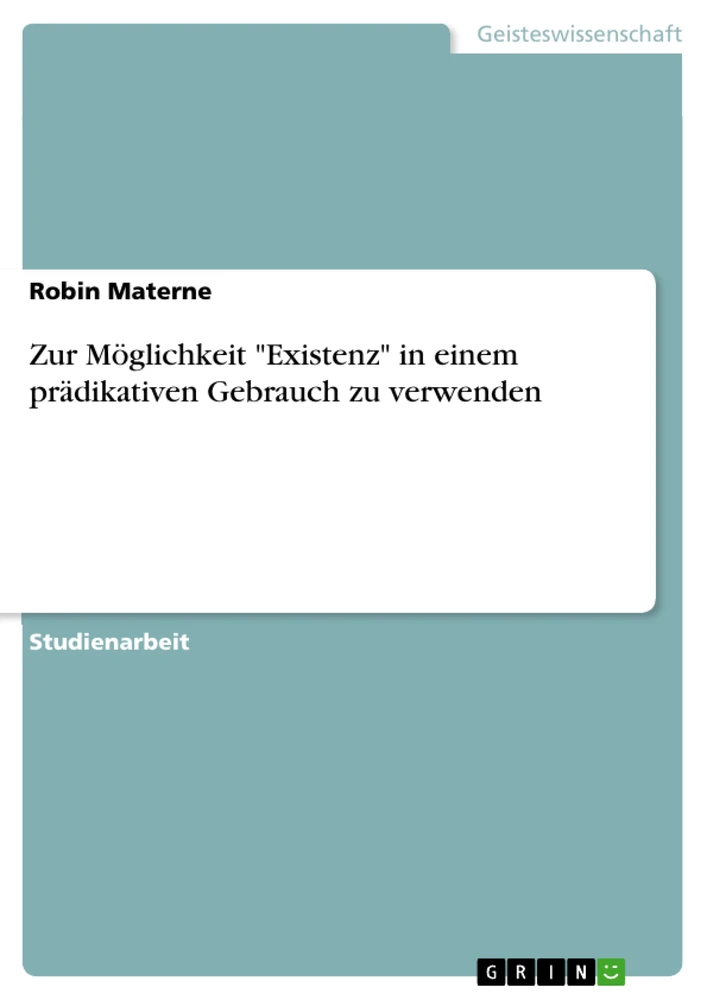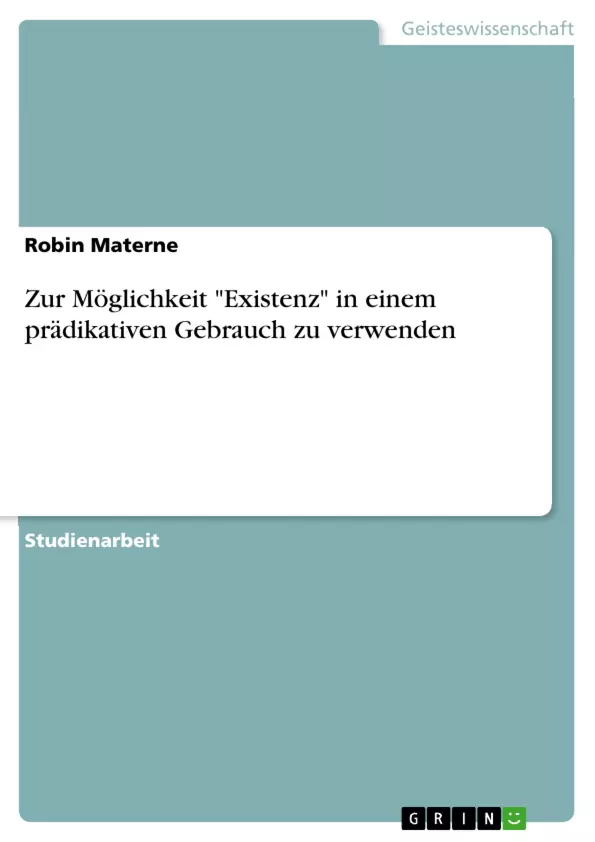„To be or not to be; that is the question.” – “Sein oder Nichtsein; dass ist hier die Frage.” Diesen Satz kennt wohl, ab einem gewissen Alter, in der westlichen Welt zumindest, nahezu jeder. Er stammt aus William Shakespeares Stück über den Prinz von Dänemark, Hamlet, der damit einen der bekanntesten, wenn nicht gar den bekanntesten Monolog der Theatergeschichte einleitet. Mittlerweile ist der Ausspruch, in der einen oder anderen Form, ein oft benutzter Einschub in Überlegungen, die für den Überlegenden essentiell und existentiell sind.
So, oder so ähnlich könnte man allerdings auch eine immer noch in der Philosophie stattfindende Diskussion wohl recht gut beschreiben. Näher erläutert geht es um den Konflikt, ob es möglich ist, „Existenz“ in einem prädikativen Gebrauch zu verwenden, also das Wort „existieren“ zu einem Prädikat zu machen. In dieser Arbeit soll es nun genau darum gehen. Ebenfalls soll beleuchtet werden, ob und zu welchen Problemen es führen kann, wenn man, wie vorher beschrieben „existieren“ und somit auch dessen Negation, „nicht-existieren“ im prädikativen Sinn verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie verwendet man ein Prädikat?
- 3. Was existiert und was gibt es?
- 4. Wann existiert etwas?
- 5. Was existiert nicht?
- 6. Gibt es unendlich viele Gegenstände?
- 7. Wie interagieren Dinge, Gegenstände und Wesenheiten untereinander?
- 8 Gibt es alles?
- 9. Es gibt Existenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Frage nach der Verwendung von „Existenz“ als Prädikat in der Philosophie zu untersuchen. Dabei soll geklärt werden, ob und zu welchen Problemen es führen kann, „existieren“ und „nicht-existieren“ im prädikativen Sinne zu verwenden.
- Die Verwendung von Prädikaten in der Sprache und Logik
- Die sprachliche Unterscheidung zwischen „etwas existiert“ und „es gibt etwas“
- Die Bedingungen und Zeitebenen von Existenz und Nicht-Existenz
- Die Frage nach dem Umfang des Seienden und der Möglichkeit von Dingen, die nicht existieren
- Die Auseinandersetzung mit Quines „On What There Is“ und Routleys „On What There Is Not“
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit und stellt die zentrale Frage nach der Verwendung von „Existenz“ als Prädikat in den Kontext philosophischer Diskussionen.
- Kapitel 2: Wie verwendet man ein Prädikat?: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung des Begriffs „Prädikat“ und untersucht seine Rolle in der Sprache und Logik.
- Kapitel 3: Was existiert und was gibt es?: Das dritte Kapitel beleuchtet die sprachliche Differenz zwischen „etwas existiert“ und „es gibt etwas“.
- Kapitel 4: Wann existiert etwas?: In diesem Kapitel wird erörtert, unter welchen Bedingungen und in welchen Zeitebenen Dinge existieren.
- Kapitel 5: Was existiert nicht?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach den Dingen, die nicht existieren.
- Kapitel 6: Gibt es unendlich viele Gegenstände?: In diesem Kapitel wird die Frage nach der Anzahl der existierenden Gegenstände behandelt.
- Kapitel 7: Wie interagieren Dinge, Gegenstände und Wesenheiten untereinander?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Interaktionen zwischen Dingen, Gegenständen und Wesenheiten.
- Kapitel 8: Gibt es alles?: Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob es alles gibt, oder ob es Dinge gibt, die nicht in den Bereich des Seienden fallen.
- Kapitel 9: Es gibt Existenz: Dieses Kapitel untersucht die Existenz selbst als Konzept.
Schlüsselwörter
Prädikat, Existenz, Nicht-Existenz, Quine, „On What There Is“, Routley, „On What There Is Not“, Sprachphilosophie, Ontologie, Seinsfrage, Prädikation, Gegenstand, Wesenheit
- Quote paper
- Robin Materne (Author), 2012, Zur Möglichkeit "Existenz" in einem prädikativen Gebrauch zu verwenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231643