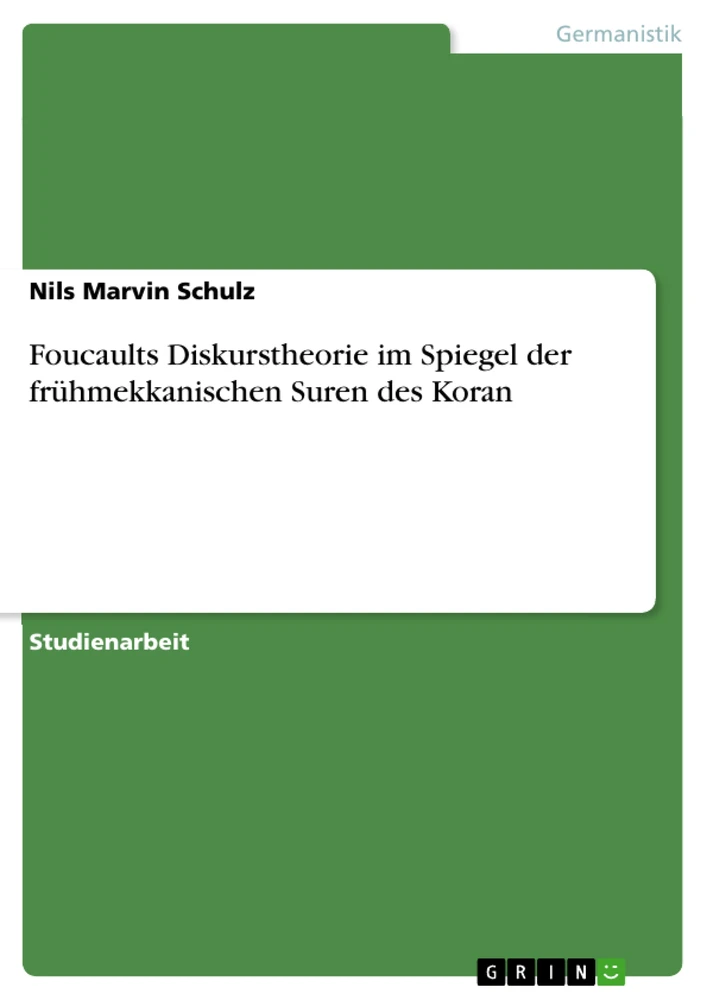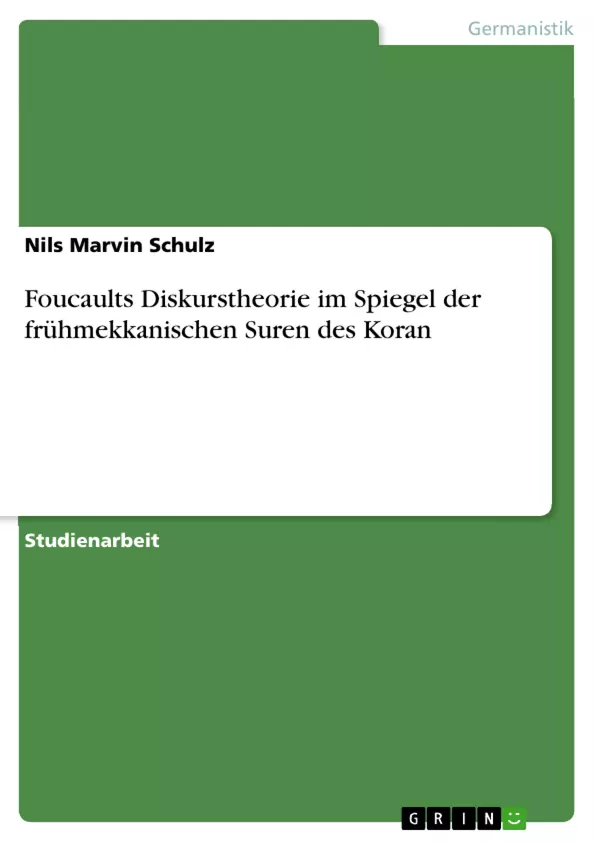Der französische Diskursanalytiker, Philosoph und Psychologe Michel Foucault wuchs in dem mit den Nationalsozialisten kollaborierenden Vichy-Frankreich der Weltkriegszeit auf und daher sei es nach Meinung Ulrika Martenssons nicht verwunderlich, dass sich Foucault Zeit seines Lebens mit Strukturen und Instrumenten der Machtausübung beschäftigt habe. Doch was genau versteht Michel Foucault – dessen theoretische Ansätze sich alles andere als einheitlich darstellen – unter dem Machtbegriff, der neben dem Begriff des Diskurses und dem Prinzip der Dynamik bzw. Transformation der Welt und deren Gesellschaftsformationen zusammen mit der Wahrheitsthematik zu den wichtigsten Konstanten des foucaultschen Denkens der 1970er Jahre gehört? Zunächst erscheint der Machtbegriff bei Foucault im Allgemeinen nicht als negativ konnotiert, vielmehr wirke Macht als ein Netz sowohl auf Subjekte als auch auf Dinge konstruktiv und produktiv – Macht schaffe Anreize, bringe Lust hervor, forme Wissen, weise Dingen Bedeutungen zu oder tabuisiere diese und produziere Dinge in ihrer Materialität, um damit Wirklichkeit und gesellschaftlich wirksame Sozialfaktoren zu schaffen. Foucault distanziert sich in seinen Schriften von der naiven Vorstellung, dass Macht ausschließlich in exklusiven Zirkeln weniger Mächtiger zentral verwaltet werde und zirkuliere; vielmehr durchströme Macht den gesamten Gesellschaftskörper, reguliere denselben und sehe sich nicht dazu gezwungen, ausschließlich als Sanktionsinstanz mittels Ge- und Verboten zu agieren. Im Allgemeinen fasst Foucault den Machtbegriff als eine Analysekategorie auf. Auf der Makroebene beschreibt Foucault Macht als den „[…] Name[n], den man einer komplexen strategischen Situation gibt.“ In diesem Sinne also als eine bestimmte Anordnung zu einer gewissen Zeit. Auf der Mikroebene setzt es sich Foucault zum Ziel, „[…] die zu untersuchenden Gegenstände in ihrer Dynamik und ihrem [verborgenen bzw. verstellten] Gewordensein zu betrachten.“ Jedem Gegenstand hafte eine Prozessualität an, die sowohl den Gegenstand selbst definiere als auch denselben in ein System von Bedeutungen einordne. Bedeutungszuweisung rekurriere wiederum auf die Schaffung von Wirklichkeit. Aber wer genau schafft oder erfindet Wirklichkeit durch Bedeutungszuweisung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte in Verbindung mit Foucaults diskursivem Begriff der Macht und Heranführung an den historisch-kritischen und literaturwissenschaftlichen Zugang zum Koran
- Foucaults Begriff der Macht und der Dispositiv in Verbindung mit dem Diskurs
- Hans Küng über die Bedeutung des Koran
- Angelika Neuwirths auf Abu Zaids fußender historisch-kritischer und literaturwissenschaftlicher Zugang zum Koran
- Der Koran als diskursive Interaktion zwischen koranischer Gemeinschaft und Verkünder
- Die Sure als diskursive Interaktion und die Mündlichkeit des Koran
- Das koranische Kommunikationsmodell und die Persuasio der Rhetorik
- Prozessualität und Intertextualität: Koranische Verhandlungen von spätantiken Traditionen, altarabischer Poesie und Seherrede sowie lokalen Beobachtungen im Spiegel der frühmekkanischen Suren
- Die Erweiterung der foucaultschen Diskurstheorie durch Leontjews Tätigkeitstheorie als Materialisation des Diskurses
- Verdichtung des eschatologischen Diskurses in Gestalt der Straflegenden und der djahiliya-Konstruktion: Auseinandersetzungen mit der altarabischen Poesie und der Seherrede
- Die djahiliya-Konstruktion und das neue Zeitbild
- Die Straflegenden, die Seherrede und der altarabische Dichter
- Intertextuelle Aspekte zwischen den frühmekkanischen Suren und dem biblischen Psalter
- Der Koran als statischer Gegenstand: Erloschene Diskursivität
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Koran unter dem Blickwinkel der Diskurstheorie Michel Foucaults. Sie analysiert die frühmekkanischen Suren des Korans als diskursive Interaktionen, die von Machtverhältnissen, historischen Traditionen und literarischen Konventionen geprägt sind. Im Fokus steht die Frage, wie der Koran in seiner Entstehung die Welt interpretiert, neue Bedeutungen schafft und durch Sprache und Rhetorik Einfluss auf seine Leser nimmt.
- Foucaults Diskurstheorie und ihre Anwendung auf den Koran
- Die frühmekkanischen Suren als diskursive Interaktionen
- Die Rolle von Macht, Tradition und Literatur im Koran
- Die Entstehung neuer Bedeutungen und die Persuasivität der koranischen Sprache
- Die Intertextualität des Korans und seine Verbindungen zu anderen Texten und Traditionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Foucaults Diskurstheorie und stellt dessen Verständnis von Macht und Dispositiv dar. Anschließend wird der Koran in seiner Bedeutung innerhalb des Islam von Hans Küng vorgestellt und der historisch-kritische und literaturwissenschaftliche Zugang zum Koran durch Angelika Neuwirth und Nasr Hamid Abu Zaid erläutert. Kapitel 2 beleuchtet den Koran als diskursive Interaktion zwischen der koranischen Gemeinschaft und dem Verkünder, wobei die Rolle der Sure als diskursive Einheit und die Bedeutung der Mündlichkeit und Rhetorik für die Übermittlung der Botschaft im Vordergrund stehen. Kapitel 3 analysiert die Prozessualität und Intertextualität des Korans, indem es die Verhandlungen mit spätantiken Traditionen, altarabischer Poesie und Seherrede sowie lokale Beobachtungen im Spiegel der frühmekkanischen Suren untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Michel Foucault, Diskurstheorie, Macht, Diskurs, Dispositiv, Koran, frühmekkanische Suren, Intertextualität, Prozessualität, Tradition, Literatur, Rhetorik, Persuasion, Historisch-kritische Methode, Literaturwissenschaftlicher Zugang, Angelika Neuwirth, Nasr Hamid Abu Zaid.
Häufig gestellte Fragen
Wie wendet Foucault seinen Machtbegriff auf den Koran an?
Foucault sieht Macht als produktives Netz, das Wissen formt und Bedeutungen zuweist. Im Koran zeigt sich dies durch die diskursive Interaktion, die Wirklichkeit erschafft und gesellschaftliche Faktoren formt.
Was sind frühmekkanische Suren?
Es handelt sich um die zeitlich am frühesten offenbarten Abschnitte des Korans, die oft durch poetische Sprache, eschatologische Themen und die Auseinandersetzung mit der altarabischen Tradition geprägt sind.
Was bedeutet Intertextualität im Kontext des Korans?
Es beschreibt die Bezüge des Korans zu anderen Texten und Traditionen, wie etwa dem biblischen Psalter oder der altarabischen Poesie, mit denen er in einen diskursiven Austausch tritt.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in der koranischen Verkündigung?
Die Rhetorik dient der Persuasion (Überzeugung). Durch sprachliche Mittel und das Kommunikationsmodell wird eine Interaktion zwischen dem Verkünder und der Gemeinschaft hergestellt.
Was ist unter der "djahiliya-Konstruktion" zu verstehen?
Es bezeichnet die koranische Darstellung der vorislamischen Zeit als Epoche der Unwissenheit, um ein neues Zeitbild und eine neue moralische Ordnung zu legitimieren.
- Quote paper
- Nils Marvin Schulz (Author), 2013, Foucaults Diskurstheorie im Spiegel der frühmekkanischen Suren des Koran, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231683