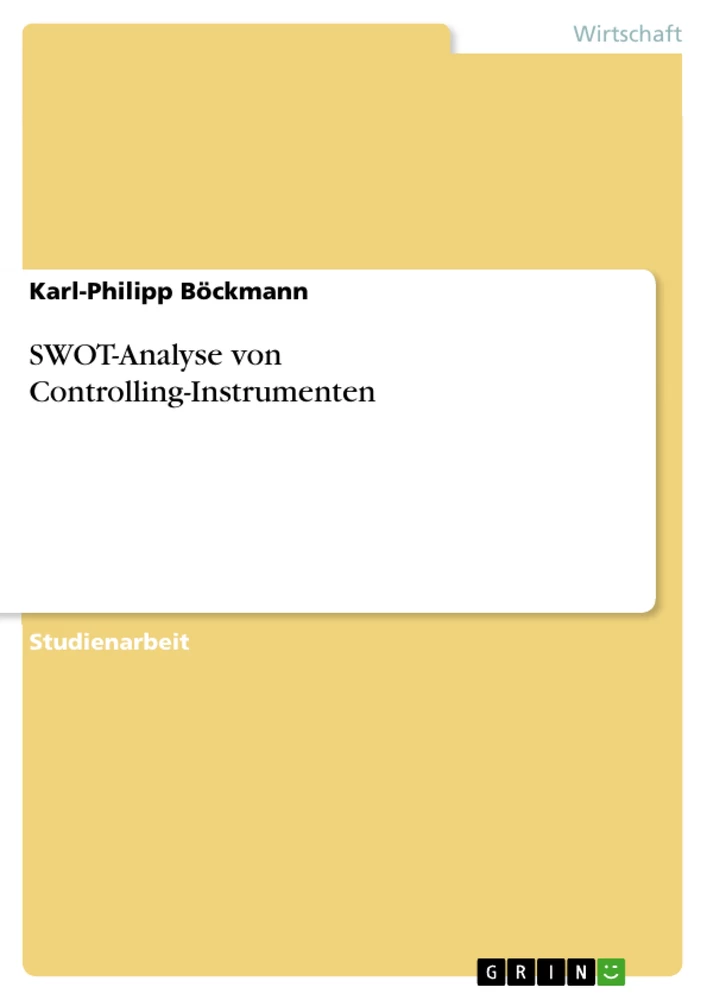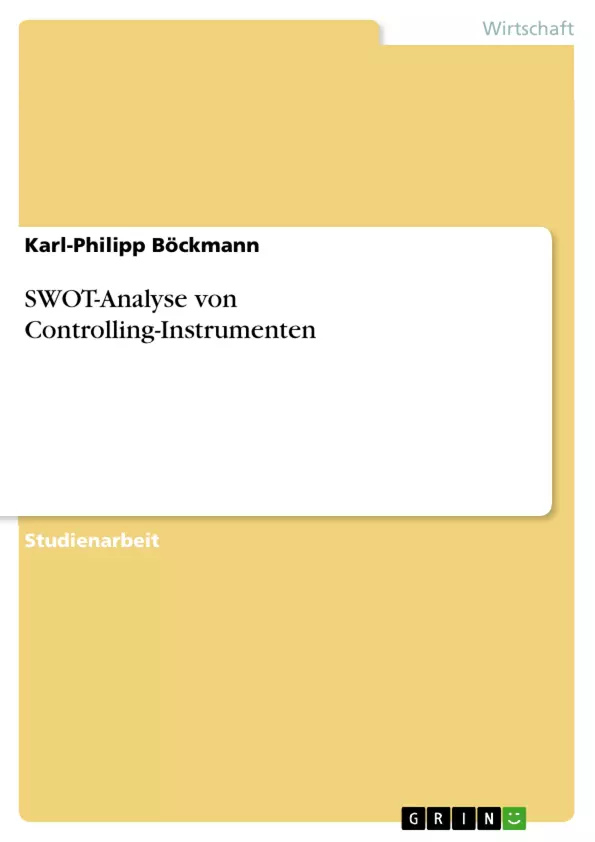Der immer stärker werdende Konkurrenzkampf und Preisdruck auf fast allen Märkten zwingt die Unternehmen, ständig ihre Strategien und Ziele anzupassen, sowie kontinuierlich die Kosten zu senken. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben sich innerhalb der Jahre einige Controlling-Instrumente etabliert, welche den Controllern helfen, Daten so aufzubereiten und zu analysieren, dass der Geschäftsführung eine gute Grundlage für ihre Entscheidungen geliefert wird. Diese Seminararbeit führt eine SWOT-Analyse von einigen ausgewählten Controlling-Instrumenten durch. Um einzelne Sachverhalte besser darstellen zu können, werden einige Vor- und Nachteile mit Hilfe eines Fallbeispiels erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Einführung des Fallbeispiels
- Einführung der Controlling-Instrumente
- SWOT
- BSC - Balanced Score Card
- Benchmarking
- Target Costing
- SWOT-Analyse von Controlling-Instrumenten
- Balanced Score Card
- Benchmarking
- Target Costing
- Vergleich der Instrumente und Bewertung
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung
- Fazit
- Glossar und Abkürzungsverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literatur
- Internet
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit führt eine SWOT-Analyse von einigen ausgewählten Controlling-Instrumenten durch. Um einzelne Sachverhalte besser darstellen zu können, werden einige Vor- und Nachteile mit Hilfe eines Fallbeispiels erläutert.
- Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen von drei wichtigen Controlling-Instrumenten: Balanced Score Card, Benchmarking und Target Costing.
- Die Analyse berücksichtigt die Chancen und Risiken, die sich aus der Anwendung dieser Instrumente ergeben.
- Die Arbeit befasst sich mit der Anpassung der SWOT-Methode für die Analyse von Controlling-Instrumenten.
- Die Arbeit untersucht die Relevanz der Instrumente im Kontext eines aktuellen Fallbeispiels aus der Praxis.
- Die Arbeit vergleicht die drei Instrumente und bewertet deren Einsatzmöglichkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel erfolgt die Einleitung in die Thematik und die Vorstellung des Fallbeispiels. Im Anschluss wird kurz erklärt, was eine SWOT-Analyse liefert und wann sie eingesetzt wird. Danach werden die zu analysierenden Instrumente eingeführt. Der Hauptteil beginnt mit der Anpassung der SWOT-Methode an den für die Arbeit benötigten Zweck. Die angepasste Methode wird dann auf die einzelnen Instrumente angewendet. Am Ende jeder SWOT-Analyse wird der Bezug zum Fallbeispiel kurz erörtert. Im letzten Abschnitt des Hauptteils erfolgen ein Vergleich aller Instrumente, sowie eine Bewertung dieser in Bezug auf das Beispiel.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der SWOT-Analyse der einzelnen Controlling-Instrumente. Die Balanced Score Card wird als ein Instrument mit Stärken wie der Unterstützung bei der Strategiefindung und der Akzeptanz bei den Mitarbeitern und in der Wissenschaft vorgestellt. Allerdings ist der Koordinationsaufwand und der Zeitaufwand für die unteren Führungsebenen bei der Erstellung und Aktualisierung der BSC hoch. Das Benchmarking zeichnet sich durch seine Hilfreichkeit bei der Strategiefindung und die Vermeidung von Fehlentscheidungen aus. Allerdings ist die Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht immer ohne Komplikationen zu erreichen, und die Datenbeschaffung kann schwierig sein. Target Costing bietet eine hohe Datenintegrität und ist ein Instrument, das in vielen Branchen eingesetzt werden kann. Allerdings ist der Koordinationsaufwand hoch, und es gibt Risiken wie Absatzveränderungen und unvorhersehbare Preisveränderungen.
Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse der SWOT-Analysen zusammengefasst und ein Fazit gezogen. Es wird festgestellt, dass alle drei Controlling-Instrumente ihre Stärken und Schwächen haben, und man daher genau prüfen muss, ob sich ein Einsatz in der Praxis lohnt und welche Risiken damit verbunden sind. Für das Fallbeispiel hat sich gezeigt, dass alle Instrumente mit gewissen Einschränkungen eingesetzt werden sollten, jedoch Target Costing den größten Erfolg verspricht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen SWOT-Analyse, Controlling-Instrumente, Balanced Score Card, Benchmarking, Target Costing, Fallbeispiel, Strategiefindung, Datenintegrität, Koordinationsaufwand, Akzeptanz, Chancen, Risiken, Vergleich, Bewertung, Zusammenfassung, Fazit, zukünftige Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Controlling-Instrumente werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit führt eine SWOT-Analyse für die Balanced Scorecard (BSC), Benchmarking und Target Costing durch.
Was ist das Ziel einer SWOT-Analyse in diesem Kontext?
Die Analyse dient dazu, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der einzelnen Instrumente aufzuzeigen, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsführung zu schaffen.
Was sind die Stärken und Schwächen der Balanced Scorecard?
Stärken sind die Unterstützung bei der Strategiefindung und die Akzeptanz bei Mitarbeitern. Schwächen sind der hohe Koordinations- und Zeitaufwand bei der Erstellung.
Welche Herausforderungen bietet das Benchmarking?
Benchmarking hilft zwar, Fehlentscheidungen zu vermeiden, leidet aber oft unter schwieriger Datenbeschaffung und potenziell geringer Akzeptanz in der Belegschaft.
Warum wird Target Costing positiv bewertet?
Target Costing bietet eine hohe Datenintegrität und ist branchenübergreifend einsetzbar, birgt jedoch Risiken bei unvorhersehbaren Preis- oder Absatzveränderungen.
Welches Instrument wird im Fallbeispiel am meisten empfohlen?
Für das untersuchte Fallbeispiel verspricht das Target Costing laut der Analyse den größten Erfolg.
- Citation du texte
- Karl-Philipp Böckmann (Auteur), 2011, SWOT-Analyse von Controlling-Instrumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231728