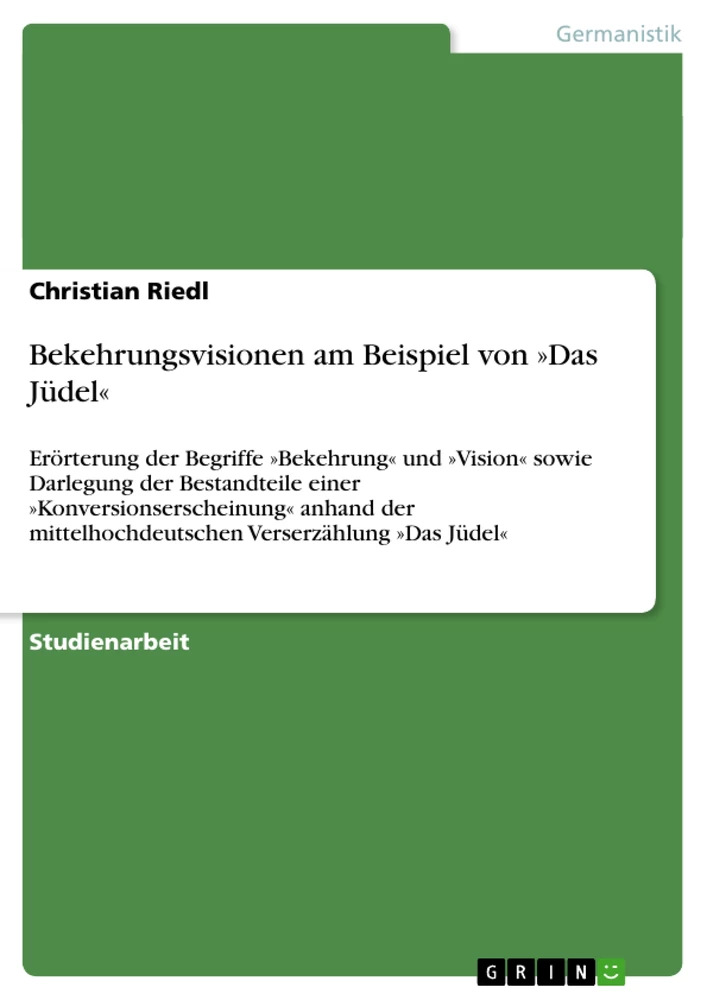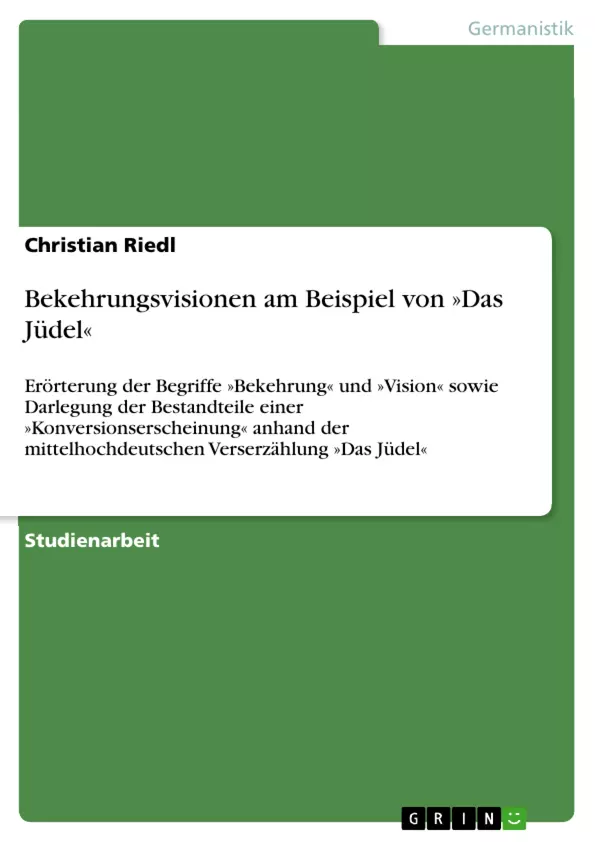Dieser Essay diente als Abschlussarbeit des Proseminars »Ältere deutsche Literatur: Traum und Vision«, das Christa Tuczay, Lehrbeauftragte am Institut für Germanistik der Universität Wien, im Wintersemester 2012/13 im Rahmen des Bachelor-Studiums Deutsche Philologie hielt. Die (vorgegebene) Aufgabenstellung lautete ursprünglich »Bekehrungsvisionen am Beispiel von ›Das Jüdel‹«. »Das Jüdel« ist eine mittelhochdeutsche Verserzählung, die ein Marienmirakel enthält: Ein Judenknabe, der an der christlichen Kommunion teilgenommen hat, wird von seinen Verwandten als Strafe in einen brennenden Ofen geworfen. Durch das wunderbare Eingreifen der heiligen Jungfrau bleibt er allerdings unverletzt und führt eine Bekehrung der Juden herbei. Diese Arbeit, welche in Form eines Essays verfasst wurde, bearbeitet die Aufgabenstellung, indem sie 1. die Begriffe »Bekehrung« und »Vision« sowie »Konversion« unter Zuhilfenahme von mediävistischen und theologischen Nachschlagewerken zu definieren versucht und 2. die Formulierung der Aufgabenstellung einer kritischen Betrachtung unterzieht. Am Ende der Bearbeitung werden die Bestandteile der »Bekehrungserscheinung«, die das geschilderte Marienmirakel nach eingehender Betrachtung darstellt, beispielhaft dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorrede zum Essay
- Erläuterungen und Übersetzungen
- Begründung der Essay-Form
- Essay
- Aufgabenstellung
- Welche Fragen beantwortet dieser Essay?
- Unzulänglichkeit des Begriffes der »Vision«
- DINZELBACHERS Definition der »Vision«
- Konstituierende Elemente der »Vision«
- Die zwei Schauungen in Das Jüdel
- Die Schauung des Christuskindes
- Die Schauung der Gottesmutter
- Die Schauungen des Christuskindes und der Gottesmutter als »Visionen«
- DINZELBACHERS Definition der »Erscheinung«
- Konstituierende Elemente der »Erscheinung«
- Die Schauung des Christuskindes als Spielart der »Erscheinung«
- Die Schauung der Gottesmutter als Erscheinung
- Vision vs. Erscheinung — Reformulierung des Arbeitsgegenstandes
- Inhaltsangabe zu Das Jüdel
- Allgemeines zu Das Jüdel
- Vorbemerkungen zu Literatur und Zitation
- Editions- und Forschungsstand
- Datierung und Lokalisierung
- Textanalyse und Hintergrundinformationen
- Definition des Begriffes »Bekehrung«
- LÖFFLERS Definition der »Bekehrung« (Evangelisches Kirchenlexikon)
- Definition der »Bekehrung« nach der Brockhaus-Enzyklopädie
- HOLLENWEGERS Definition der »Bekehrung« (Theologische Realenzyklopädie)
- Definitionen der »Bekehrung« in Religion in Geschichte und Gegenwart
- BISCHOFBERGERS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart)
- MARQUARDTS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart)
- KRECHS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der bisherigen Definitionen
- Das Marienmirakel in Das Jüdel als »Bekehrungserscheinung«
- Die Marienerscheinung als »Bekehrungserscheinung«
- Quellen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der mittelhochdeutschen Verserzählung »Das Jüdel« und analysiert sie im Kontext der Bekehrungsvisionen. Ziel ist es, die Bestandteile einer Bekehrungserscheinung anhand des Textes zu beleuchten und zu erörtern, inwiefern »Das Jüdel« dem Muster einer solchen Erscheinung entspricht.
- Die Bedeutung der Begriffe »Bekehrung« und »Vision« im Mittelalter
- Die Unterscheidung zwischen »Vision« und »Erscheinung«
- Die Analyse der übernatürlichen Ereignisse in »Das Jüdel«
- Die Darstellung der Bekehrung des Judenknaben und seiner Familie
- Die Interpretation des Textes im Kontext der mittelalterlichen Marienmirakel und der Legende vom Judenknaben
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorrede zum Essay: Der Essay stellt den Kontext des Proseminars »Ältere deutsche Literatur: Traum und Vision« dar und erläutert die Wahl des Themas »Bekehrungsvisionen am Beispiel von »Das Jüdel«.
- Erläuterungen und Übersetzungen: Der Autor erklärt, dass er aufgrund des angenommenen Wissensstandes seiner Kommilitonen Fachbegriffe erläutern und Zitate aus dem mittelhochdeutschen Original mit einer neuhochdeutschen Übersetzung versehen wird.
- Begründung der Essay-Form: Der Autor begründet die Wahl der Essay-Form für diese Arbeit im Vergleich zu herkömmlichen wissenschaftlichen Arbeiten.
- Essay: Der Essay beginnt mit einem Zitat von William Blake und erläutert die Aufgabenstellung, die darin besteht, die Bestandteile einer Bekehrungsvision anhand von »Das Jüdel« zu untersuchen.
- Aufgabenstellung: Die Aufgabenstellung wird im Detail erläutert und in die Formulierung gebracht, die Bestandteile einer Bekehrungsvision anhand von »Das Jüdel« darzulegen.
- Welche Fragen beantwortet dieser Essay?: Der Autor stellt die Fragen, die er im Essay beantwortet, vor: Was ist »Das Jüdel«? Wovon handelt »Das Jüdel«? Was ist unter den Begriffen »Bekehrung« und »Vision« zu verstehen? Inwieweit entspricht »Das Jüdel« dem Muster einer Bekehrungsvision?
- Unzulänglichkeit des Begriffes der »Vision«: Der Autor argumentiert, dass »Das Jüdel« keine Visionen, sondern Erscheinungen beinhaltet und daher die Begriffe »Vision« und »Erscheinung« näher betrachtet werden müssen.
- DINZELBACHERS Definition der »Vision«: Der Autor stellt DINZELBACHERS Definition der »Vision« vor.
- Konstituierende Elemente der »Vision«: Die konstituierenden Elemente der »Vision« nach DINZELBACHER werden aufgeführt.
- Die zwei Schauungen in Das Jüdel: Der Autor stellt die beiden übernatürlichen Ereignisse in »Das Jüdel« vor: die Schauung des Christuskindes und die Schauung der Gottesmutter.
- Die Schauung des Christuskindes: Der Autor beschreibt die Schauung des Christuskindes durch den Judenknaben während der Heiligen Kommunion.
- Die Schauung der Gottesmutter: Der Autor beschreibt die Schauung der Gottesmutter durch den Judenknaben, während er im Ofen sitzt.
- Die Schauungen des Christuskindes und der Gottesmutter als »Visionen«: Der Autor argumentiert, dass die beiden Schauungen in »Das Jüdel« nicht als Visionen im Sinne von DINZELBACHER gelten können, da wichtige Elemente fehlen.
- DINZELBACHERS Definition der »Erscheinung«: Der Autor stellt DINZELBACHERS Definition der »Erscheinung« vor.
- Konstituierende Elemente der »Erscheinung«: Die konstituierenden Elemente der »Erscheinung« nach DINZELBACHER werden aufgeführt.
- Die Schauung des Christuskindes als Spielart der »Erscheinung«: Der Autor argumentiert, dass die Schauung des Christuskindes als eine Übergangsform zwischen Vision und Erscheinung betrachtet werden kann.
- Die Schauung der Gottesmutter als Erscheinung: Der Autor argumentiert, dass die Schauung der Gottesmutter alle Merkmale einer »Erscheinung« im Sinne von DINZELBACHER erfüllt.
- Vision vs. Erscheinung — Reformulierung des Arbeitsgegenstandes: Der Autor reformuliert den Arbeitsgegenstand des Essays von »Bekehrungsvisionen« zu »Bekehrungserscheinungen« aufgrund der Analyse der Begriffe »Vision« und »Erscheinung«.
- Inhaltsangabe zu Das Jüdel: Der Autor fasst die Handlung der Verserzählung »Das Jüdel« zusammen.
- Allgemeines zu Das Jüdel: Der Autor gibt allgemeine Informationen zu »Das Jüdel«, darunter Titel, Überlieferung und Handschriften.
- Vorbemerkungen zu Literatur und Zitation: Der Autor gibt Hinweise auf die verwendete Literatur und Zitierweise.
- Editions- und Forschungsstand: Der Autor beschreibt den Editions- und Forschungsstand von »Das Jüdel« von der ersten Veröffentlichung bis zur Edition von HEIKE A. BURLMEISTER.
- Datierung und Lokalisierung: Der Autor diskutiert die Datierung und Lokalisierung von »Das Jüdel« und argumentiert für eine Entstehung im bairisch-österreichischen Sprachraum.
- Textanalyse und Hintergrundinformationen: Der Autor analysiert den Text von »Das Jüdel« und stellt ihn in den Kontext der mittelalterlichen Marienmirakel und der Legende vom Judenknaben.
- Definition des Begriffes »Bekehrung«: Der Autor definiert den Begriff »Bekehrung« anhand verschiedener Nachschlagewerke und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Definitionen heraus.
- LÖFFLERS Definition der »Bekehrung« (Evangelisches Kirchenlexikon): Der Autor stellt LÖFFLERS Definition der »Bekehrung« aus dem Evangelischen Kirchenlexikon vor.
- Definition der »Bekehrung« nach der Brockhaus-Enzyklopädie: Der Autor stellt die Definition der »Bekehrung« aus der Brockhaus-Enzyklopädie vor.
- HOLLENWEGERS Definition der »Bekehrung« (Theologische Realenzyklopädie): Der Autor stellt HOLLENWEGERS Definition der »Bekehrung« aus der Theologische Realenzyklopädie vor.
- Definitionen der »Bekehrung« in Religion in Geschichte und Gegenwart: Der Autor stellt die Definitionen der »Bekehrung« aus Religion in Geschichte und Gegenwart von BISCHOFBERGER, MARQUARDT und KRECH vor.
- BISCHOFBERGERS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart): Der Autor stellt BISCHOFBERGERS Definition der »Bekehrung« aus Religion in Geschichte und Gegenwart vor.
- MARQUARDTS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart): Der Autor stellt MARQUARDTS Definition der »Bekehrung« aus Religion in Geschichte und Gegenwart vor.
- KRECHS Definition (Religion in Geschichte und Gegenwart): Der Autor stellt KRECHS Definition der »Bekehrung« aus Religion in Geschichte und Gegenwart vor.
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der bisherigen Definitionen: Der Autor vergleicht die verschiedenen Definitionen der »Bekehrung« und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.
- Das Marienmirakel in Das Jüdel als »Bekehrungserscheinung«: Der Autor argumentiert, dass das Marienmirakel in »Das Jüdel« als »Bekehrungserscheinung« bezeichnet werden kann, da es sowohl die Merkmale einer »Erscheinung« als auch die Bestandteile einer »Bekehrung« erfüllt.
- Die Marienerscheinung als »Bekehrungserscheinung«: Der Autor fasst zusammen, dass die Marienerscheinung in »Das Jüdel« als »Bekehrungserscheinung« betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bekehrungsvisionen, Bekehrungserscheinungen, mittelhochdeutsche Literatur, »Das Jüdel«, Marienmirakel, Legende vom Judenknaben, Vision, Erscheinung, Christentum, Judentum, mittelalterliche Literatur, Traum und Vision.
Häufig gestellte Fragen zu „Das Jüdel“
Was ist „Das Jüdel“?
Es handelt sich um eine mittelhochdeutsche Verserzählung, die ein Marienmirakel über einen Judenknaben und dessen Bekehrung zum Christentum enthält.
Was ist der Unterschied zwischen einer Vision und einer Erscheinung?
Die Arbeit nutzt Definitionen von Dinzelbacher, um aufzuzeigen, dass die Ereignisse im Text eher als „Erscheinungen“ (objektiv wahrnehmbare übernatürliche Präsenz) denn als „Visionen“ (innere Schauung) einzustufen sind.
Welche übernatürlichen Schauungen treten im Text auf?
Der Judenknabe erlebt zwei zentrale Ereignisse: die Schauung des Christuskindes während der Kommunion und die Schauung der Gottesmutter im brennenden Ofen.
Wie wird „Bekehrung“ im Essay definiert?
Der Essay analysiert verschiedene theologische und enzyklopädische Definitionen von Bekehrung und Konversion im mittelalterlichen Kontext.
Was ist der Kern des Marienmirakels in diesem Text?
Ein Judenknabe überlebt unbeschadet einen brennenden Ofen durch das Eingreifen der Jungfrau Maria, was zur Konversion seiner Familie führt.
- Citation du texte
- Christian Riedl (Auteur), 2013, Bekehrungsvisionen am Beispiel von »Das Jüdel«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231745