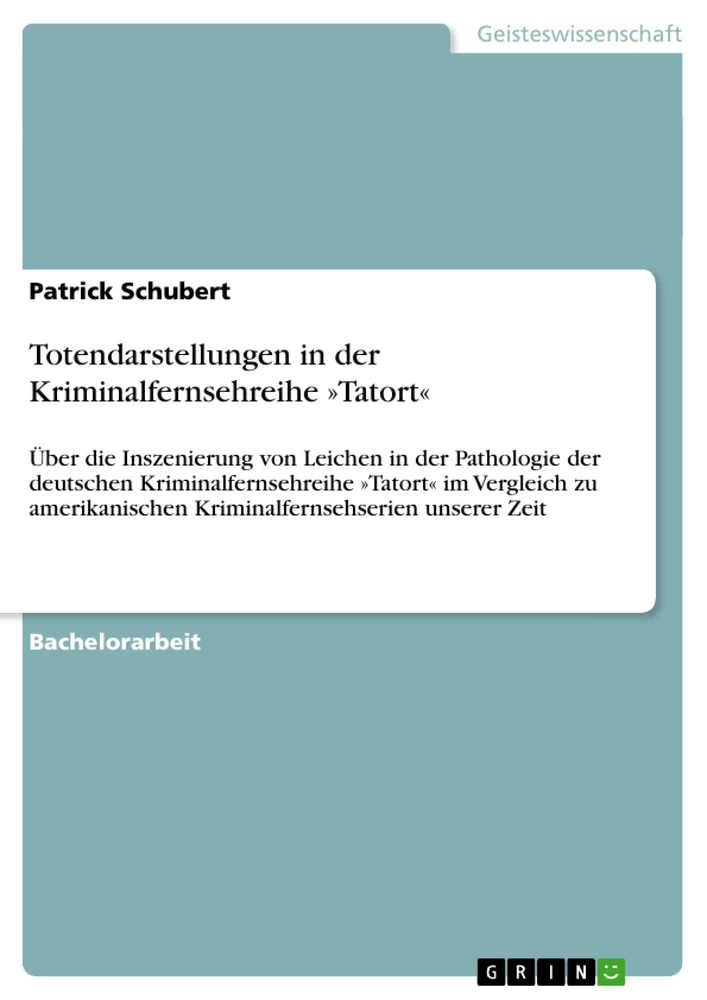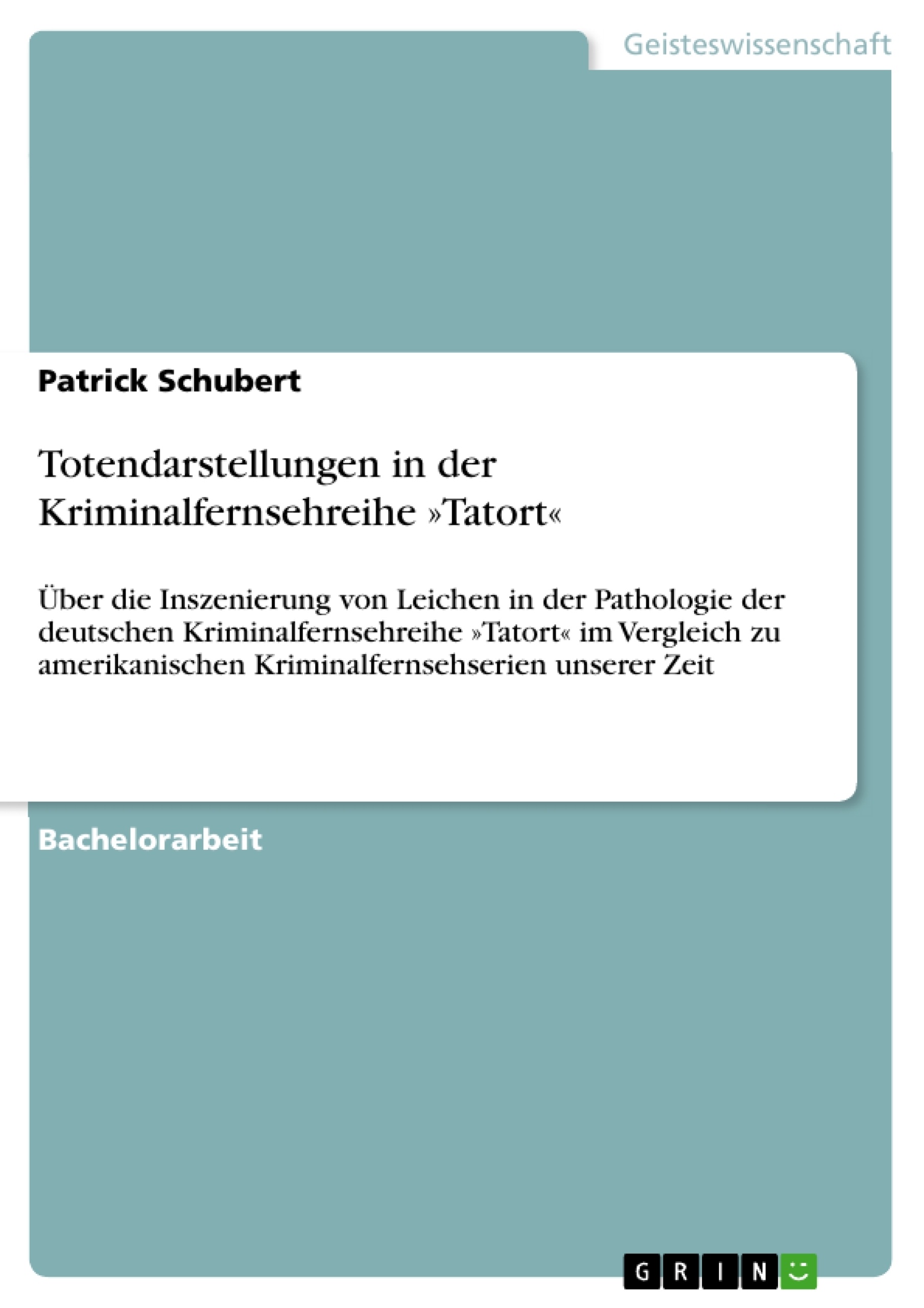Diese Untersuchung vergleicht Totendarstellungen in gerichtsmedizinischen Kontexten der Kriminalreihe »Tatort« mit thematisch ähnlichen Darstellungen amerikanischer Kriminalserien. Die zur Analyse deutscher sowie amerikanischer Serien herangezogene Methode ist die der struktural-hermeneutischen Symbolanalyse nach Müller-Doohm. Die Analyse hat gezeigt, dass es neue Formen der visuellen Kodierung von Leichen im »Tatort« gibt, die einem neuen Abbildungsmodell zugeordnet werden können. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass es hybride Darstellungen erzeugt. In Darstellungen, die diesem Typus entsprechen werden typische Darstellungsweisen deutscher und amerikanischer Abbildungsmodelle kombiniert. Die dadurch hybridisierte Darstellung ist jedoch immer als einem deutschen Entstehungskontext zugehörig zu identifizieren, da sie ästhetische Elemente der Inszenierung enthält, die in amerikanischen Darstellungen nicht vorkommen würden. Es wird die Ansicht vertreten, dass die neuen Leichendarstellungen sowohl deutscher wie amerikanischer Produktion, als Ausdruck einer wachsenden »Popularisierung des Todes« innerhalb der Gesellschaften gedeutet werden können. Diese sich zumindest im westlichen Kulturraum ausbreitende Popularisierungstendenz wird jedoch jeweils lokal vollzogen und dabei nationalspezifisch überformt.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Zugänge: Das Krimi-Genre, seine Funktion und Geschichte
- Allgemeine Merkmale des Krimis
- Die Geschichte des Fernsehkrimis
- Zu den Konzepten der Amerikanisierung und Westernisierung deutscher Kultur
- Äußerlicher Realismus als Stilmittel eines fiktionalen Genres
- Zusammenfassung
- 3 Methodik und Erhebung
- Analysemethoden
- Das Untersuchungmaterial: Die Kriminalfernsehreihe »Tatort«
- Die Grundgesamtheit und die Auswahlgesamtheit
- Die Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- Empirische Ergebnisse
- Amerikanische Abbildungsmodelle
- Deutsche Abbildungsmodelle
- Traditionelle Darstellung
- Moderne Darstellung
- Hybride Darstellung
- 5 Schluss
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs-/Tabellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die visuellen Kodierungen von Totendarstellungen in der deutschen Kriminalfernsehreihe „Tatort“ und vergleicht diese mit amerikanischen Krimiserien. Das Hauptziel ist es, Veränderungen in den Darstellungsweisen im Laufe der Zeit zu identifizieren und diese im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen zu interpretieren. Der Fokus liegt auf der Analyse der visuellen Gestaltung und der Zuordnung verschiedener Darstellungsmodelle.
- Veränderung der visuellen Kodierung von Leichendarstellungen im „Tatort“ über die Zeit.
- Vergleich der deutschen und amerikanischen Darstellungsmodelle von Leichen.
- Identifizierung von nationalen Besonderheiten in der visuellen Gestaltung.
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext einer möglichen „Popularisierung des Todes“.
- Analyse der Einflüsse amerikanischer Krimiserien auf deutsche Darstellungsweisen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der visuellen Kodierung von Leichendarstellungen in deutschen und amerikanischen Krimiserien ein. Sie begründet die Wahl des „Tatorts“ als Untersuchungsgegenstand aufgrund der beobachteten Veränderungen in den Darstellungsweisen und der Möglichkeit des Vergleichs mit amerikanischen Serien. Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Veränderung der visuellen Kodierungen im „Tatort“ im Laufe der Zeit und deren Vergleich mit amerikanischen Serien. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die visuellen Kodierungen den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext widerspiegeln.
2 Theoretische Zugänge: Das Krimi-Genre, seine Funktion und Geschichte: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für die Analyse. Es beleuchtet allgemeine Merkmale des Krimi-Genres, seine Geschichte und Entwicklung, sowie die Konzepte der Amerikanisierung und Westernisierung im Kontext deutscher Kultur. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Entwicklung des Fernsehkrimis und seiner Funktion als Unterhaltungsmedium. Der Abschnitt über den „äußerlichen Realismus“ betont die stilistischen Mittel des Genres und legt den Grundstein für das Verständnis der visuellen Kodierungen.
3 Methodik und Erhebung: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze der Arbeit. Es erläutert die verwendeten Analysemethoden (struktural-hermeneutische Symbolanalyse) und detailliert das Untersuchungmaterial, die Auswahl der Folgen und die Zusammensetzung der Stichprobe. Die methodischen Schritte zur Datenerhebung und -auswertung werden präzise dargelegt, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Studie zu gewährleisten.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der Analyse. Es stellt die identifizierten Darstellungsmodelle vor (traditionell, modern, hybrid) und vergleicht diese mit den von Weber (2011) ermittelten Modellen amerikanischer Serien. Die Ergebnisse bieten eine detaillierte Beschreibung der visuellen Merkmale der verschiedenen Darstellungsmodelle und zeigen die Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Serien auf. Es wird quantitaiv und qualitativ auf die Ergebnisse eingegangen.
Schlüsselwörter
Tatort, Kriminalfernsehserie, Totendarstellung, Gerichtsmedizin, visuelle Kodierung, Abbildungsmodell, Amerikanisierung, struktural-hermeneutische Symbolanalyse, Vergleichende Analyse, Gesellschaftlicher Kontext, Popularisierung des Todes.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Visuelle Kodierungen von Totendarstellungen im "Tatort"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die visuellen Kodierungen von Totendarstellungen in der deutschen Kriminalfernsehreihe "Tatort" und vergleicht diese mit amerikanischen Krimiserien. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Darstellungsweisen im Laufe der Zeit und deren Interpretation im gesellschaftlichen Kontext.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Veränderung der visuellen Kodierungen im "Tatort" über die Zeit und deren Vergleich mit amerikanischen Serien. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die visuellen Kodierungen den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext widerspiegeln.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine strukural-hermeneutische Symbolanalyse. Das Kapitel "Methodik und Erhebung" beschreibt detailliert die Analysemethoden, das Untersuchungsmaterial ("Tatort"), die Auswahl der Folgen und die Zusammensetzung der Stichprobe. Die methodischen Schritte zur Datenerhebung und -auswertung werden präzise dargelegt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die empirischen Ergebnisse zeigen verschiedene Darstellungsmodelle von Totendarstellungen (traditionell, modern, hybrid), sowohl im deutschen "Tatort" als auch im Vergleich zu amerikanischen Serien. Die Ergebnisse werden quantitativ und qualitativ beschrieben und die Unterschiede zwischen den nationalen Darstellungsweisen herausgearbeitet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit theoretischen Zugängen zum Krimi-Genre, ein Kapitel zur Methodik und Erhebung, ein Kapitel mit den Ergebnissen, sowie einen Schluss mit Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse. Zusätzlich beinhaltet sie ein Literaturverzeichnis, ein Abbildungs-/Tabellenverzeichnis und einen Anhang.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Tatort, Kriminalfernsehserie, Totendarstellung, Gerichtsmedizin, visuelle Kodierung, Abbildungsmodell, Amerikanisierung, strukural-hermeneutische Symbolanalyse, Vergleichende Analyse, Gesellschaftlicher Kontext, Popularisierung des Todes.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Identifizierung von Veränderungen in den Darstellungsweisen von Totendarstellungen im "Tatort" über die Zeit und deren Interpretation im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Vergleich mit amerikanischen Krimiserien und der Identifizierung nationaler Besonderheiten.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit beleuchtet allgemeine Merkmale des Krimi-Genres, seine Geschichte und Entwicklung, sowie die Konzepte der Amerikanisierung und Westernisierung im Kontext deutscher Kultur. Der "äußerliche Realismus" als stilistisches Mittel des Genres wird ebenfalls betrachtet.
- Quote paper
- B.A. Patrick Schubert (Author), 2012, Totendarstellungen in der Kriminalfernsehreihe »Tatort«, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231834