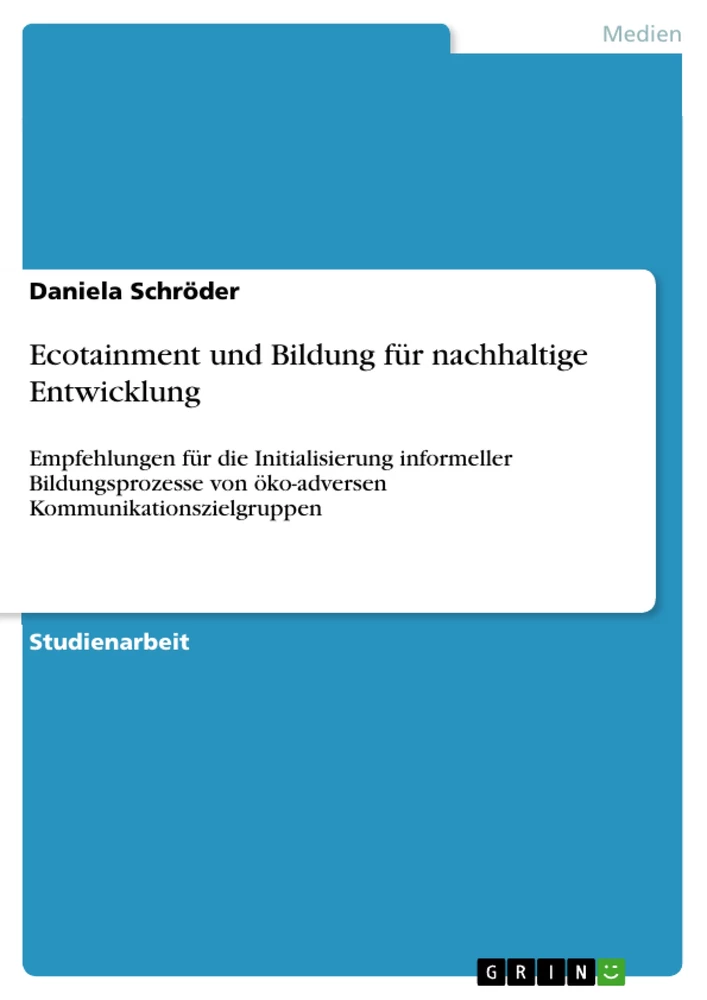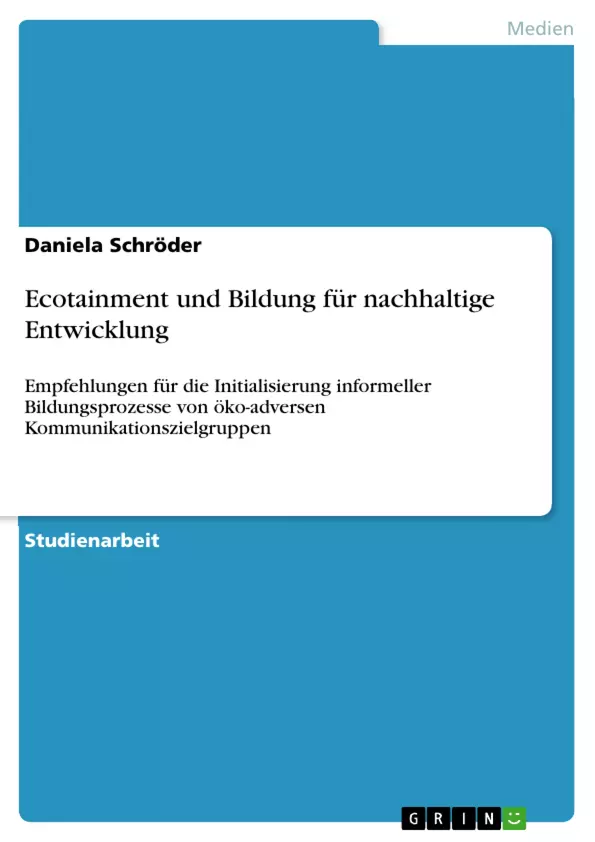In dieser Arbeit soll der Fragestellung nachgegangen werden, welche Empfehlungen an die informelle BNE zur Ausgestaltung ihrer Beiträge für die Kommunikation mit an ökologischen und sozialen Fragen gering interessierten Zielgruppen zur Initialisierung von informellen Lernprozessen gemacht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
- THEORIE 1: BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
- ZIELE UND DIDAKTSCHE PRINZIPIEN
- INFORMELLES LERNEN
- INFORMELLE BNE
- MEDIEN UND INFORMELLE BNE
- THEORIE 2: MASSENMEDIALE NACHHALTIGKEITSKOMMUNIKATION
- POTENTIALE UND HEMMNISSE
- MEDIALISIERUNG DER NACHHALTIGKEIT - ECOTAINMENT
- PROJEKT balance (f): MEDIALISIERUNG DER NACHHALTIGKEIT
- EMPIRIE: ANALYSE EINES „WELT DER WUNDER"-BEITRAGES
- ERGEBNISSE EMPIRIE
- QUALITATIVE ANALYSE DER GESTALTUNG DES BEITRAGES
- ANALYSE DER DURCH DEN BEITRAG VERMITTELTEN INHALTE
- DISKUSSION: BEANTWORTUNG DER FRAGEN ZU A: IST DER BEITRAG DEM ECOTAINMENT-KONZEPT NACH LICHTL ZUZUORDNEN?
- BEANTWORTUNG DER FRAGEN ZU B: LÄSST SICH DER BEITRAG ALS BEITRAG ZUR INFORMELLE BNE BESCHREIBEN?
- DISKUSSION: EMPFEHLUNGEN AN DIE INFORMELLE BNE
- FAZIT
- QUELLEN
- LITERATUR
- STUDIEN
- ENTER-NEI
- ANLAGE 1: ABSCHRIFT DES ZU ANALYSIERENDEN „WELT DER WUNDER"-BEITRAGES
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, welche Empfehlungen an die informelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gegeben werden können, um Beiträge für „öko-adverse“ Zielgruppen zu gestalten und so informelle Lernprozesse zu initiieren.
- Die Bedeutung von informeller Bildung im Kontext der BNE
- Das Konzept des Ecotainment als Ansatz zur attraktiven Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen
- Die Analyse eines „Welt der Wunder“-Beitrags im Hinblick auf seine Einordnung in das Ecotainment-Konzept und die informelle BNE
- Die Herausforderungen der Nachhaltigkeitskommunikation und die Relevanz von emotionalisierender und erlebnisorientierter Kommunikation
- Empfehlungen zur Gestaltung von Beiträgen für die informelle BNE, die an ökologischen und sozialen Themen gering interessierte Zielgruppen erreichen sollen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ein und beschreibt die Relevanz von informellen Lernprozessen für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie „öko-adverse“ Zielgruppen, die wenig Interesse an Nachhaltigkeitsthemen haben, für die BNE gewonnen werden können.
Im ersten Theoriekapitel werden die Ziele und didaktischen Prinzipien der BNE vorgestellt, wobei ein Schwerpunkt auf dem informellen Lernen liegt. Die Bedeutung von Medien im Kontext der informellen BNE wird erläutert und die Rolle von Massenmedien für die Verbreitung von Nachhaltigkeitsbotschaften wird hervorgehoben.
Das zweite Theoriekapitel beleuchtet die Herausforderungen der massenmedialen Nachhaltigkeitskommunikation und stellt das Ecotainment-Konzept nach Martin Lichtl vor. Dieses Konzept zielt darauf ab, Nachhaltigkeitsthemen durch eine attraktive und emotionalisierende Präsentation in den Medien zu verankern und so die Aufmerksamkeit der Rezipienten zu gewinnen.
Der empirische Teil der Arbeit analysiert einen selbstgewählten Beitrag aus der TV-Reihe „Welt der Wunder“ im Hinblick auf seine Einordnung in das Ecotainment-Konzept und die informelle BNE. Die Analyse zeigt, dass der Beitrag zwar einige Elemente des Ecotainment-Konzeptes aufweist, jedoch nicht vollständig den Kriterien der informellen BNE entspricht.
In der anschließenden Diskussion werden Empfehlungen an die informelle BNE gegeben, wie Beiträge gestaltet werden können, um „öko-adverse“ Zielgruppen anzusprechen und informelle Lernprozesse zu initiieren. Dabei wird die Bedeutung von emotionalisierender und erlebnisorientierter Kommunikation sowie die Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), informelle Bildung, Ecotainment, Nachhaltigkeitskommunikation, „öko-adverse“ Zielgruppen, Medien, und die Gestaltung von Lerninhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ecotainment?
Ecotainment (Ecological Entertainment) ist ein Konzept zur massenmedialen Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen durch attraktive, emotionalisierende und unterhaltsame Formate.
Was sind „öko-adverse“ Zielgruppen?
Damit sind Personengruppen gemeint, die ein geringes Interesse an ökologischen oder sozialen Fragen haben und durch klassische BNE-Ansätze schwer erreicht werden.
Welchen Beitrag leistet informelle BNE?
Informelle BNE findet außerhalb klassischer Bildungsinstitutionen statt (z.B. durch Medien) und nutzt Alltagssituationen, um Nachhaltigkeitsbewusstsein zu schaffen.
Wie wurde das Konzept in dieser Arbeit empirisch geprüft?
Der Autor führte eine qualitative Analyse eines Beitrags der TV-Sendung „Welt der Wunder“ durch, um dessen Eignung als Ecotainment und informelle BNE zu bewerten.
Welche Empfehlungen gibt die Arbeit für die Praxis?
Beiträge sollten stärker emotionalisieren, erlebnisorientiert gestaltet sein und die spezifischen Interessen der Zielgruppe berücksichtigen, statt rein belehrend zu wirken.
- Quote paper
- Daniela Schröder (Author), 2012, Ecotainment und Bildung für nachhaltige Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231856