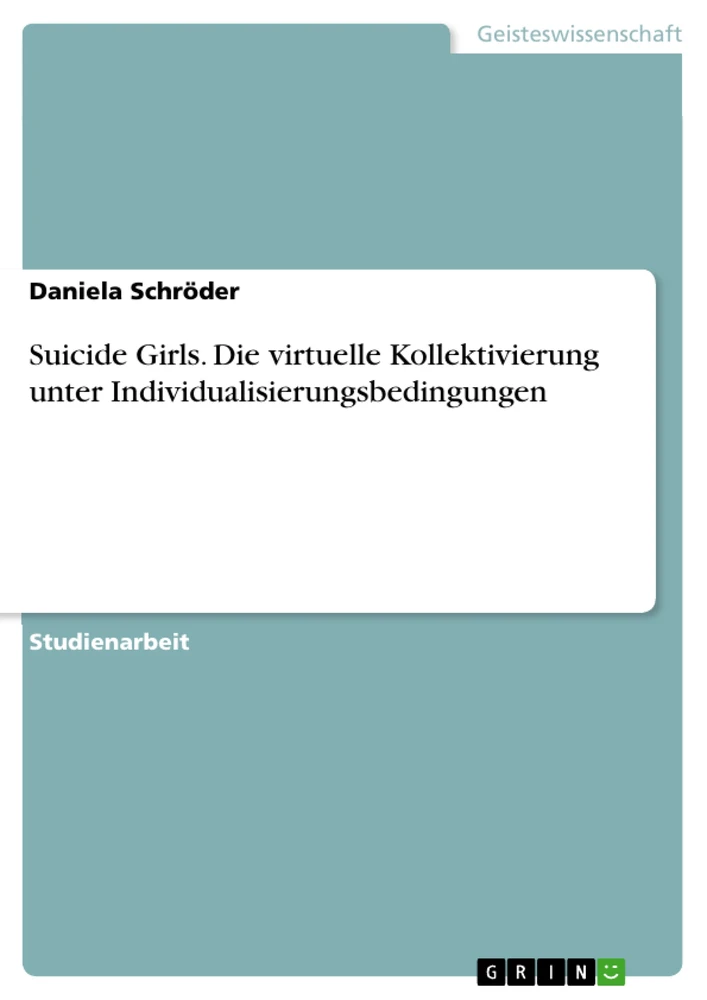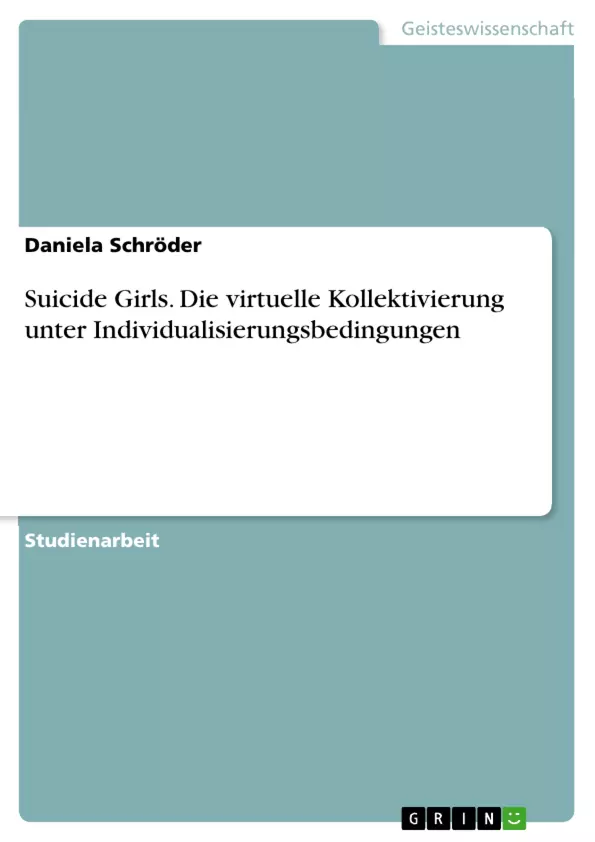Das Internet ist heute selbstverständlicher Alltag, kommunikatives Rückrat von
Sozialität und „unverzichtbarstes Medium“ für Jugendliche1 und ist somit
längst nicht mehr nur für Marketingspezialisten und ihre Auftraggeber
interessant, sondern rückt zunehmend auch in den Fokus soziologischer
Betrachtungen.
Dabei stehen zunehmend auch neue Formen der Vergemeinschaftung im
Rahmen des Web 2.0 im Mittelpunkt des Interesses; Internetnutzer laden als so
genannte „Prosumenten“ bei youtube.com eigene Inhalte ins Netz, erstellen
Profile auf verschiedenen Sozialen Netzwerkseiten wie Myspace.com oder
Studivz.net, und unterhalten sich mit anderen Nutzern über die verschiedenen
angebotenen Kanäle wie scype.com oder Twitter.com.
Einer Untersuchung des Pew Research Centers aus dem Jahre 2006 zufolge
sind 55% der jugendlichen Onlinenutzer in den USA zwischen 12 und 17
Jahren Mitglied in mindestens einer virtuellen Community (VC)2.
Laut einer Studie des Nürnberger Marktforschungsinstituts ForschungsWerk
aus dem Jahre 2009 sind fast zwei Drittel der Internetnutzer in Deutschland
über 18 Jahre Mitglied in einem oder mehreren Online-Netzwerken, wobei von
den 18-29-jährigen bereits 90% in einem Netzwerk vertreten sind. Auch haben
die meisten Communities für die Benutzer einen hohen Stellenwert; ein Drittel
der Befragten würde das Angebot stark oder sehr stark vermissen3.
Der Web-Informationsdienst alexa.com wies am 08.09.2009 die Sozialen
Netzwerkseiten von Facebook.com als die am dritthäufigsten besuchte Seite
weltweit aus4.
Doch was macht diese Sozialen Netzwerkseiten (SNS) so attraktiv? Welche Motive haben Menschen für das Anlegen ihres Profils, welchen privaten
Nutzen erhoffen sie sich von ihrer Teilnahme an diesen virtuellen
Gemeinschaften?
Um sich diesen und weiteren Fragestellungen anzunähern, möchte ich in dieser
Arbeit die verschiedenen Aspekte der virtuellen Vergemeinschaftung in einer
posttraditionalen Gemeinschaft nach den Überlegungen von Ronald Hitzler
und anderen beleuchten.
Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, ob posttraditionale
Gemeinschaften – und hier besonders die virtuellen Communities (VCs) –
einen positiven Beitrag zur Findung von sozialer Sicherheit im Umgang
miteinander leisten kann in einer Moderne, welche sich durch hochgradige
Individualisierung und Optionalisierung beschreiben lässt.
Untersuchungsgegenstand wird dabei die virtuelle Gemeinschaft der
SuicideGirls auf suicidegirls.com sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Durchführung
- Fragen
- Theorie
- Posttraditionale Gemeinschaften
- Szenen
- Virtual Communities
- Suicidegirls.com
- Überblick
- Geschichte & Selbstverständnis
- Funktionen
- Suicidegirls, Hopefuls & Members
- Profile
- Äußeres Erscheinungsbild der Seite
- Äußeres Erscheinungsbild der Suicidegirls & Assoziation zu anderen szenischen Entwicklungen
- Zusammenfassung & Interpretation
- Empirie
- Methode
- Material
- Selbst-Portraits
- Frage nach Motiven
- Zusammenfassung der Motive
- Frage nach Erfahrungen durch SG.com
- Zusammenfassung der Erfahrungen
- Interpretation
- Fazit
- Persönliche Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die virtuelle Gemeinschaft SuicideGirls.com und beleuchtet die Motive junger Frauen für ihre Teilnahme sowie die damit verbundenen Erfahrungen. Im Fokus steht die Frage, welche sozialen Funktionen diese virtuelle Community erfüllt und ob diese mit Funktionen realer Gemeinschaften vergleichbar sind. Die Arbeit analysiert die Plattform im Kontext posttraditioneller Gemeinschaften und virtueller Communities.
- Motive für die Teilnahme an SuicideGirls.com
- Soziale Funktionen von SuicideGirls.com
- Vergleich mit realen Gemeinschaften
- SuicideGirls.com im Kontext posttraditioneller Gemeinschaften
- Analyse virtueller Communities
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der virtuellen Vergemeinschaftung im Internet ein und verweist auf die zunehmende Bedeutung sozialer Netzwerke und virtueller Communities. Sie hebt die hohe Nutzung von Online-Netzwerken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hervor und stellt die Forschungsfrage nach den Motiven der Teilnahme an solchen Plattformen in den Mittelpunkt. Der Untersuchungsgegenstand, die SuicideGirls-Community, wird vorgestellt, und es wird auf den Forschungsansatz hingewiesen, der sich an der Theorie posttraditioneller Gemeinschaften orientiert.
Durchführung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es skizziert die theoretischen Grundlagen, die auf dem Konzept posttraditionaler Gemeinschaften und der Analyse virtueller Communities basieren. Weiterhin wird die Vorgehensweise bei der Untersuchung von Suicidegirls.com erläutert, welche die Analyse des Erscheinungsbilds der Seite, der technischen Funktionen und die qualitative Inhaltsanalyse der Daten beinhaltet. Der empirische Teil der Untersuchung und die anschließende Interpretation werden angekündigt.
Theorie: Dieser Abschnitt präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem er das Konzept der posttraditionalen Gemeinschaften nach Hitzler et al. sowie das Konzept der virtuellen Communities nach Deterding erläutert. Es wird die Bedeutung von Szenen im Kontext von Kollektivierung unter Individualisierungsbedingungen diskutiert und als Grundlage für die Analyse von Suicidegirls.com dienen. Die Theorie dient der Interpretation der empirischen Ergebnisse.
Suicidegirls.com: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die virtuelle Gemeinschaft Suicidegirls.com, einschließlich ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer technischen Funktionen und ihres visuellen Erscheinungsbildes. Es wird eine Beschreibung des „Look and Feel“ der Plattform vorgenommen, um erste Eindrücke und Geschmacksmuster zu identifizieren. Das Kapitel liefert den Kontext für die spätere empirische Analyse.
Empirie: Der empirische Teil der Arbeit wird vorgestellt. Hier werden die Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse erklärt und das verwendete Material (z.B. Selbst-Portraits) spezifiziert. Die Ergebnisse der Untersuchung der Motive der Teilnehmerinnen und ihrer Erfahrungen werden zusammengefasst und interpretiert. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage für die abschließende Interpretation und das Fazit.
Schlüsselwörter
SuicideGirls.com, virtuelle Community, posttraditionale Gemeinschaften, soziale Netzwerke, Online-Netzwerke, Jugendkultur, Individualisierung, soziale Funktionen, Motivation, qualitative Inhaltsanalyse, virtuelle Vergemeinschaftung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der virtuellen Gemeinschaft SuicideGirls.com
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die virtuelle Gemeinschaft SuicideGirls.com. Der Fokus liegt auf den Motiven junger Frauen für ihre Teilnahme und den damit verbundenen Erfahrungen. Es wird analysiert, welche sozialen Funktionen diese Community erfüllt und ob diese mit Funktionen realer Gemeinschaften vergleichbar sind.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Welche sozialen Funktionen erfüllt die virtuelle Community SuicideGirls.com, und wie lassen sich diese mit Funktionen realer Gemeinschaften vergleichen? Zusätzlich werden die Motive der Teilnahme und die gemachten Erfahrungen der Nutzerinnen untersucht.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie posttraditioneller Gemeinschaften (Hitzler et al.) und das Konzept virtueller Communities (Deterding). Der Begriff der „Szenen“ wird im Kontext von Kollektivierung unter Individualisierungsbedingungen diskutiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse. Das verwendete Material umfasst unter anderem Selbst-Portraits der Suicidegirls. Die Analyse untersucht die Motive der Teilnehmerinnen und ihre Erfahrungen mit der Plattform.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die Einleitung, Durchführung, Theorie, eine detaillierte Beschreibung von Suicidegirls.com, Empirie, Interpretation, Fazit und eine persönliche Meinung umfassen. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zur Beantwortung der Forschungsfragen bei.
Welche Aspekte von Suicidegirls.com werden untersucht?
Die Untersuchung umfasst die Geschichte und das Selbstverständnis der Plattform, ihre technischen Funktionen, das äußere Erscheinungsbild der Webseite und der Suicidegirls selbst, sowie die Profile der Nutzerinnen und deren Assoziation zu anderen szenischen Entwicklungen.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Aufschluss über die Motive der Teilnahme an SuicideGirls.com, die sozialen Funktionen der Plattform und einen Vergleich dieser Funktionen mit denen realer Gemeinschaften. Die Ergebnisse sollen auch Aufschluss über die Bedeutung von SuicideGirls.com im Kontext posttraditioneller Gemeinschaften und virtueller Communities geben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit virtuellen Gemeinschaften, sozialen Netzwerken, Jugendkultur, Individualisierung und qualitativer Sozialforschung beschäftigen. Sie bietet Einblicke in die Funktionsweise und die soziale Bedeutung einer spezifischen Online-Community.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
SuicideGirls.com, virtuelle Community, posttraditionale Gemeinschaften, soziale Netzwerke, Online-Netzwerke, Jugendkultur, Individualisierung, soziale Funktionen, Motivation, qualitative Inhaltsanalyse, virtuelle Vergemeinschaftung.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist nicht hier verfügbar. Dieser Text bietet lediglich eine Zusammenfassung und einen Überblick über den Inhalt.
- Citar trabajo
- Daniela Schröder (Autor), 2009, Suicide Girls. Die virtuelle Kollektivierung unter Individualisierungsbedingungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231861