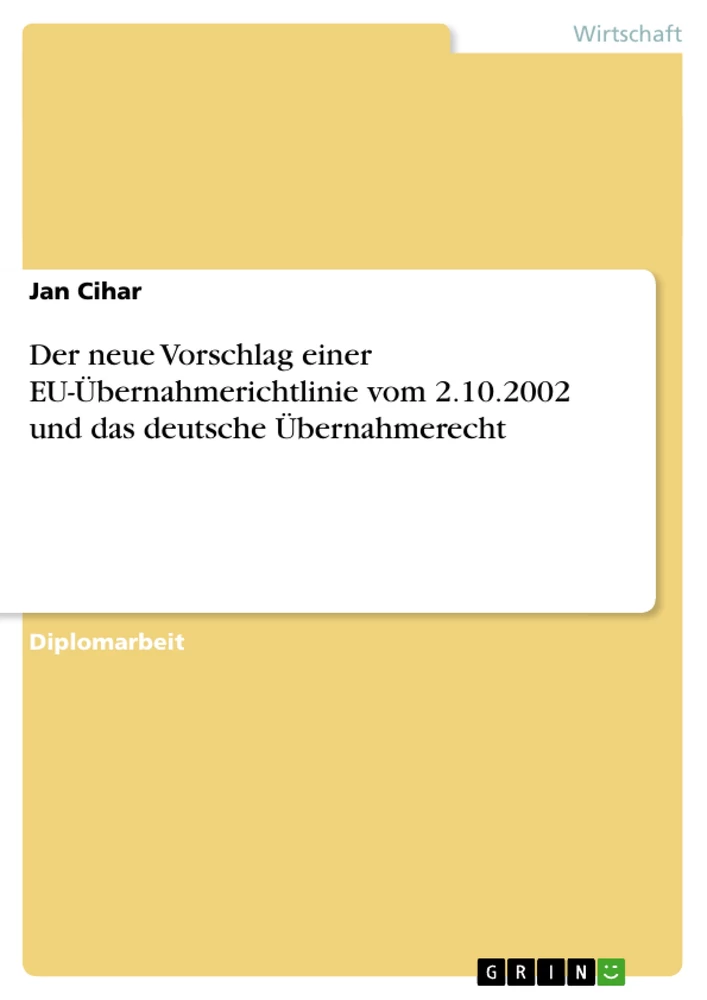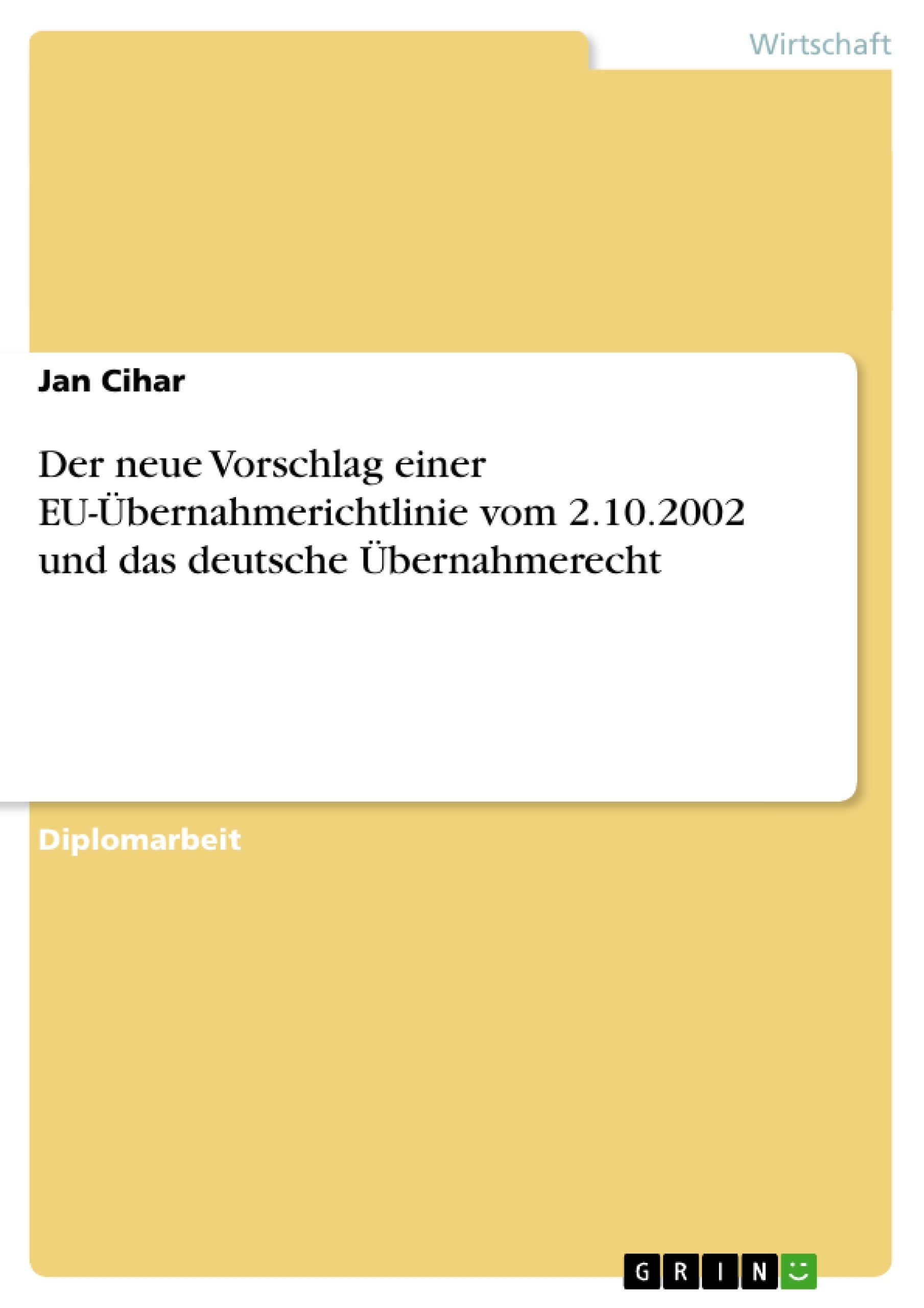Im Januar 2003 titelte die Financial Times Deutschland „Berlin findet Bundesgenossen gegen Bolkestein“ und meinte damit die wachsende Kritik an den Vorschlägen der EU-Kommission für eine europaweit gültige Übernahmerichtlinie. Diese hatte die Kommission am 2.10.2002 vorgelegt, nachdem ein vorangegangener Vorschlag im Juli 2001 spektakulär gescheitert war. Es war der erneute Versuch, Unternehmensübernahmen in Europa einheitlich zu regeln und damit ein Level Playing Field zu schaffen. Daß dabei die verschiedenen Regelungen in den europäischen Staaten nicht unangetastet bleiben würden und dies zum Teil heftige Kritik hervorrief, war zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund ist es Ziel der vorliegenden Arbeit, in einem ersten Schritt die Regelungen der vorgelegten Übernahmerichtlinie darzustellen und, wo angebracht, zu hinterfragen. In einem zweiten Schritt wird das deutsche Übernahmerecht dargestellt und mit den Anforderungen der Richtlinie verglichen. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Übernahmerichtlinie ohne wesentliche Änderungen verabschiedet wird, um die deutschen Regelungen unabhängig von den Diskussionen um die Richtlinie daraufhin zu überprüfen, ob und in welcher Hinsicht sie den europäischen Forderungen entsprechen.
Die Arbeit wird sich daran messen lassen müssen, inwieweit es ihr darzustellen gelingt, welche Teile des deutschen Übernahmerechts bereits richtlinienkonform sind, welche es nachzubessern gilt und ob Wege aufgezeigt werden können, diese Anpassung zu erreichen.
Dabei werde ich die neuralgischen Punkte ausführlich darstellen und bewerten, mich aber bei weniger diskussionswürdigen Abschnitten auf eine kurze Darstellung beschränken, so daß bei den Ausführungen zum deutschen Übernahmerecht kein Anspruch auf Vollständigkeit bis ins Detail besteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DER 13. RICHTLINIENVORSCHLAG
- 2.1 Entstehungsgeschichte und Grundlagen
- 2.1.1 Entstehungsgeschichte
- 2.1.2 Grundlagen und Level Playing Field
- 2.2 Anwendungsbereich und Verfahrensgrundsätze
- 2.2.1 Anwendungsbereich - Art. 1
- 2.2.2 Begriffsbestimmungen - Art. 2
- 2.2.3 Allgemeine Grundsätze - Art. 3
- 2.2.4 Aufsichtsorgan - Art. 4
- 2.2.5 Schutz der Minderheitsaktionäre durch Pflichtangebot und angemessenen Preis – Art. 5
- 2.2.5.1 Auslöser des Pflichtangebots
- 2.2.5.2 Angemessener Preis
- 2.2.6 Information über das Angebot, Annahmefrist und Bekanntmachung – Art. 6, 7, 8
- 2.2.6.1 Angebot und Angebotsunterlage
- 2.2.6.2 Annahmefrist
- 2.2.6.3 Bekanntmachung
- 2.2.7 Pflichten des Vorstands, Abwehrmaßnahmen und Transparenzvorschriften – Art. 9, 10
- 2.2.7.1 Stellungnahme der Zielgesellschaft
- 2.2.7.2 Abwehrmaßnahmen / Neutralitätspflicht
- 2.2.7.3 Transparenzvorschriften
- 2.2.7.3.1 Darstellung im Lagebericht
- 2.2.7.3.2 Äußerungsrecht der Hauptversammlung und Begründungspflicht von Vorstand und Aufsichtsrat
- 2.2.8 Beschränkungen und Durchbruchsregel – Art. 11
- 2.2.8.1 Stimmrechtsbeschränkungen
- 2.2.8.1.1 Höchststimmrechte
- 2.2.8.1.2 Mehrfachstimmrechte
- 2.2.8.2 Übertragungsbeschränkungen
- 2.2.8.3 Goldene Aktien
- 2.2.8.4 Durchgriffsregel
- 2.2.9 Weitere Verfahrensregeln und Information der Arbeitnehmervertreter – Art. 12, 13
- 2.2.9.1 Weitere Verfahrensregeln
- 2.2.9.2 Information der Arbeitnehmervertreter
- 2.2.10 Squeeze Out und Sell Out – Art. 14, 15
- 2.2.10.1 Squeeze Out
- 2.2.10.2 Sell Out
- 2.2.11 Sanktionen und weitere Regelungen
- 2.3 Zwischenergebnis
- 3. DAS DEUTSCHE ÜBERNAHMERECHT VOR DEM HINTERGRUND DES 13. RICHTLINIENVORSCHLAGS
- 3.1 Entstehung und Hintergründe des WpÜG
- 3.1.1 Übernahmekodex 1995
- 3.1.2 WpÜG 2002
- 3.2 Ziele und Aufbau des Gesetzes
- 3.3 Allgemeine Vorschriften und Zuständigkeit der BAFin - Abschnitt 1, 2
- 3.3.1 Allgemeine Vorschriften
- 3.3.1.1 Sachlich
- 3.3.1.2 Örtlich
- 3.3.1.3 Legaldefinitionen
- 3.3.2 Allgemeine Grundsätze
- 3.3.2 Zuständigkeit der BAFin
- 3.4 Angebote zum Erwerb von Wertpapieren – Abschnitt 3
- 3.4.1 Vorbemerkungen
- 3.4.2 Verfahren
- 3.4.2.1 Öffentliche Ankündigung
- 3.4.2.2 Stellungnahme der Zielgesellschaft
- 3.4.2.3 Annahmefrist
- 3.4.2.4 Inhaltliche Gestaltung des Angebots
- 3.4.3 Gleichbehandlung
- 3.4.3.1 Bedingungen
- 3.4.3.2 Gegenleistung
- 3.4.3.3 Änderung des Angebots
- 3.4.3.4 Haftung für die Angebotsunterlage
- 3.4.5 Arbeitnehmerschutz
- 3.5 Übernahmeangebote und Pflichtangebote - Abschnitt 4, 5
- 3.5.1 Vorbemerkungen
- 3.5.2 Übernahmeangebote
- 3.5.2.1 Kontrolle und Stimmrechte
- 3.5.2.1.1 Kontrolle
- 3.5.2.1.2 Zurechnungsregeln für Stimmrechte
- 3.5.2.1.3 Durchbruchsregel
- 3.5.2.2 Verhalten der Organe der Zielgesellschaft
- 3.5.2.2.1 Rechte und Pflichten des Vorstands
- 3.5.2.2.1.1 Vereitelungsverbot
- 3.5.2.2.1.2 Ermächtigungstatbestände
- 3.5.2.2.1.2.1 Suche nach einem konkurrierenden Angebot
- 3.5.2.2.1.2.2 Maßnahmen eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters
- 3.5.2.2.1.2.3 Handlungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates
- 3.5.2.2.2 Kompetenzen der Hauptversammlung
- 3.5.2.3 Gegenleistung
- 3.5.2.4 Vorteilsgewährung und Teilangebot
- 3.5.3 Pflichtangebote
- 3.5.3.1 Pflichtangebotsverfahren und -funktion
- 3.5.3.2 Befreiungsmöglichkeiten
- 3.6 Rechtsmittel und Sanktionen – Abschnitt 7, 8
- 3.6.1 Rechtsmittel
- 3.6.2 Sanktionen
- 3.7 Squeeze Out und Sell Out
- 3.7.1 Squeeze Out
- 3.7.2 Sell Out
- 4. SCHLUẞBETRACHTUNG
- 4.1 Europäischer Ausblick
- 4.2 Deutsche Perspektive und Anpassungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, den neuen Vorschlag einer EU-Übernahmerichtlinie vom 2.10.2002 im Kontext des deutschen Übernahmerechts zu analysieren. Sie untersucht insbesondere die Auswirkungen des Richtlinienenentwurfs auf die bestehenden Regelungen im deutschen WpÜG und erörtert den Anpassungsbedarf des deutschen Rechts.
- Harmonisierung des europäischen Übernahmerechts
- Schutz der Minderheitsaktionäre
- Transparenz und Informationspflichten
- Verfahren und Abwehrmaßnahmen bei Übernahmen
- Anpassungsbedarf des deutschen Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Einleitung dar und führt in das Thema der Diplomarbeit ein. Kapitel 2 analysiert den 13. Richtlinienenentwurf der EU-Übernahmerichtlinie. Es werden die Entstehungsgeschichte und die Grundlagen des Vorschlags sowie die Anwendungsbereiche und Verfahrensgrundsätze im Detail beleuchtet. Das Kapitel untersucht auch den Schutz der Minderheitsaktionäre, die Informationspflichten, Abwehrmaßnahmen und Transparenzvorschriften, sowie weitere Verfahrensregeln und Sanktionen.
Kapitel 3 befasst sich mit dem deutschen Übernahmerecht vor dem Hintergrund des 13. Richtlinienenentwurfs. Es werden die Entstehung und die Hintergründe des WpÜG beleuchtet, sowie die Ziele und der Aufbau des Gesetzes. Darüber hinaus wird die Zuständigkeit der BAFin, die Vorschriften zu Angeboten, die Übernahmeangebote und Pflichtangebote, sowie die Rechtsmittel und Sanktionen analysiert. Das Kapitel behandelt auch den Squeeze Out und Sell Out im deutschen Recht.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit fokussiert sich auf die Themen EU-Übernahmerichtlinie, deutsches Übernahmerecht, WpÜG, Minderheitenschutz, Transparenz, Informationspflichten, Abwehrmaßnahmen, Squeeze Out, Sell Out, Harmonisierung, Anpassungsbedarf.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der EU-Übernahmerichtlinie von 2002?
Das Ziel war die Schaffung einheitlicher Regeln für Unternehmensübernahmen in Europa („Level Playing Field“) und der Schutz von Minderheitsaktionären.
Was ist ein Pflichtangebot?
Ein Pflichtangebot muss abgegeben werden, wenn ein Erwerber die Kontrolle über eine Gesellschaft erlangt, um Minderheitsaktionären einen fairen Ausstieg zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt das WpÜG in Deutschland?
Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) regelt in Deutschland den Ablauf von Übernahmen und die Pflichten der beteiligten Organe.
Was versteht man unter Squeeze Out und Sell Out?
Squeeze Out erlaubt einem Mehrheitsaktionär, Minderheitsaktionäre gegen Abfindung auszuschließen; Sell Out gibt Minderheitsaktionären das Recht, ihre Anteile dem Mehrheitsaktionär anzudienen.
Wie steht das deutsche Recht zur Neutralitätspflicht des Vorstands?
Die Arbeit vergleicht die EU-Forderung nach Neutralität des Vorstands bei Übernahmen mit den deutschen Regelungen zu Abwehrmaßnahmen.
- Quote paper
- Jan Cihar (Author), 2003, Der neue Vorschlag einer EU-Übernahmerichtlinie vom 2.10.2002 und das deutsche Übernahmerecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23190