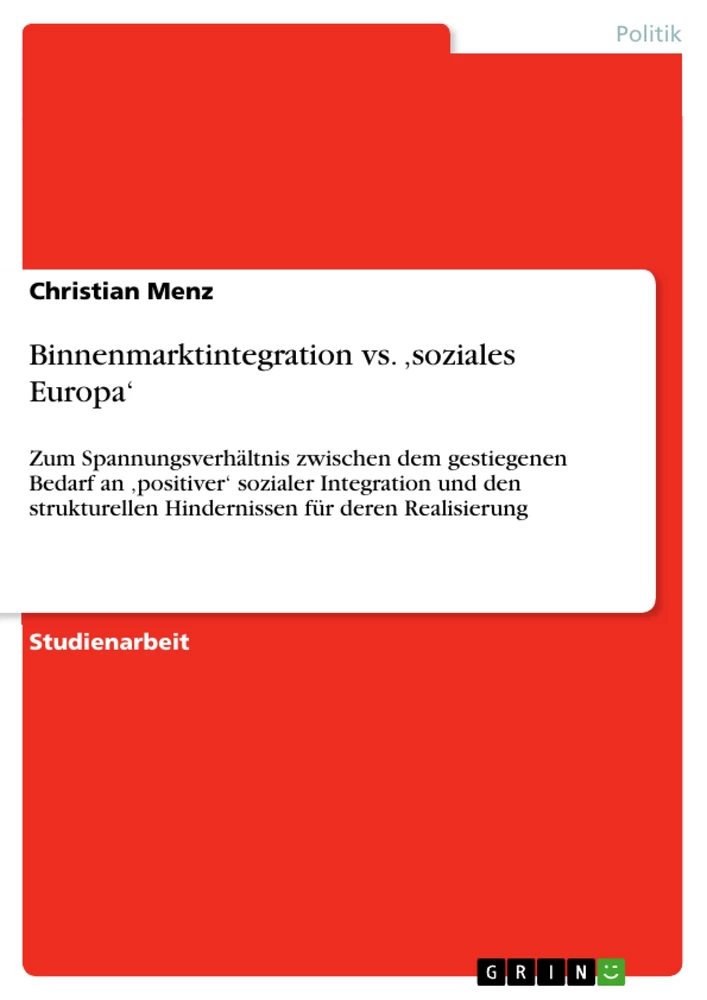Gegenwärtig lässt sich ein Spannungsverhältnis identifizieren zwischen dem durch die Europäische Integration gestiegenen Bedarf an sozialpolitischer Abstimmung auf der europäischen Ebene einerseits und dem Unwillen der Mitgliedstaaten andererseits, (zusätzliche) Autonomie- und Souveränitätsverluste in einem absoluten Kernbereich der Staatstätigkeit in Kauf zu nehmen. Früher oder später werden allerdings weitreichende politische Entscheidungen zur Auflösung der gegenwärtigen Widersprüche vonnöten sein. Dies gilt auch im Hinblick auf ein Hauptziel der Europäischen Union, namentlich die vollständige Realisierung der ‚vier Grundfreiheiten‘ (Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen), welche nur erreichbar scheint durch eine stärkere Zentralisierung wohlfahrtsstaatlicher Kompetenzen. Ob und wie allerdings das Dilemma zwischen dem gestiegenen Bedarf an ‚positiver‘ sozialer Integration und struktureller Hindernisse für deren Realisierung gelöst werden könnte, erscheint derzeit unklar. Wie die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit zeigt, sprechen viele Faktoren dafür, dass das gegenwärtige Ungleichgewicht zwischen ‚positiver‘ und ‚negativer‘ Integration auf absehbare Zeit nicht kleiner werden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die veränderte Ausgangslage nationaler Sozialpolitik vor dem Hintergrund der europäischen Integration
- Argumente für eine stärkere Integration im Bereich der Sozialpolitik
- Hindernisse für die Europäisierung der Sozialpolitik
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit einer stärkeren sozialen Integration im Rahmen der europäischen Integration und den strukturellen Hindernissen für deren Realisierung. Sie untersucht die Argumente für eine stärkere Europäisierung der Sozialpolitik sowie die Herausforderungen, die einer solchen Entwicklung entgegenstehen.
- Die veränderte Ausgangslage nationaler Sozialpolitik im Kontext der europäischen Integration
- Argumente für eine verstärkte europäische Koordinierung der Sozialpolitik
- Die Herausforderungen der Europäisierung der Sozialpolitik
- Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Gestaltung europäischer Sozialpolitik
- Zukünftige Szenarien für die Europäisierung der Sozialpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die veränderte Ausgangslage nationaler Sozialpolitik im Kontext der europäischen Integration dar. Sie zeigt auf, wie die ökonomische Integration der EU-Mitgliedstaaten die Souveränität und Autonomie der Nationalstaaten im Bereich der Sozialpolitik beeinflusst hat.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Argumenten für eine stärkere Integration im Bereich der Sozialpolitik. Es werden verschiedene Gründe genannt, warum eine europäische Koordinierung der Sozialpolitik notwendig ist, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der EU-Bürger zu verbessern, die soziale Kohäsion zu fördern und den europäischen Einigungsprozess zu stabilisieren.
Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Hindernisse für die Europäisierung der Sozialpolitik diskutiert. Die politische Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene ist durch die Verflechtung nationaler Interessen und die tiefe Verankerung nationaler Wertesysteme begrenzt. Die finanziellen Ressourcen der Europäischen Kommission sind im Vergleich zu den nationalen Sozialausgaben gering, und die Kompetenzen der Kommission und des Europäischen Parlaments im Bereich der Sozialpolitik sind begrenzt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Integration, die Binnenmarktintegration, die Sozialpolitik, die Europäisierung der Sozialpolitik, der Wohlfahrtsstaat, die soziale Kohäsion, die soziale Ungleichheit, das demokratische Defizit, die Offene Methode der Koordinierung (OMK), der Europäische Gerichtshof (EuGH), die Grundfreiheiten, die Politikverflechtungsfallen, die Pfadabhängigkeiten und die „positive" und „negative" Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welches Spannungsverhältnis wird in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen der notwendigen sozialpolitischen Abstimmung auf EU-Ebene und dem Unwillen der Mitgliedstaaten, Souveränität in diesem Kernbereich abzugeben.
Was sind die "vier Grundfreiheiten" der EU?
Es handelt sich um den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen innerhalb des europäischen Binnenmarktes.
Warum fällt die Europäisierung der Sozialpolitik so schwer?
Hindernisse sind die Verflechtung nationaler Interessen, tief verankerte nationale Wertesysteme, begrenzte finanzielle Ressourcen der Kommission und eingeschränkte Kompetenzen des EU-Parlaments.
Was ist der Unterschied zwischen "positiver" und "negativer" Integration?
Negative Integration bezieht sich auf den Abbau von Handelsschranken, während positive Integration die Schaffung gemeinsamer Regeln und Politiken (wie Sozialstandards) bedeutet.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH)?
Der EuGH spielt eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der europäischen Sozialpolitik durch seine Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten.
- Arbeit zitieren
- Christian Menz (Autor:in), 2011, Binnenmarktintegration vs. ‚soziales Europa‘, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232020