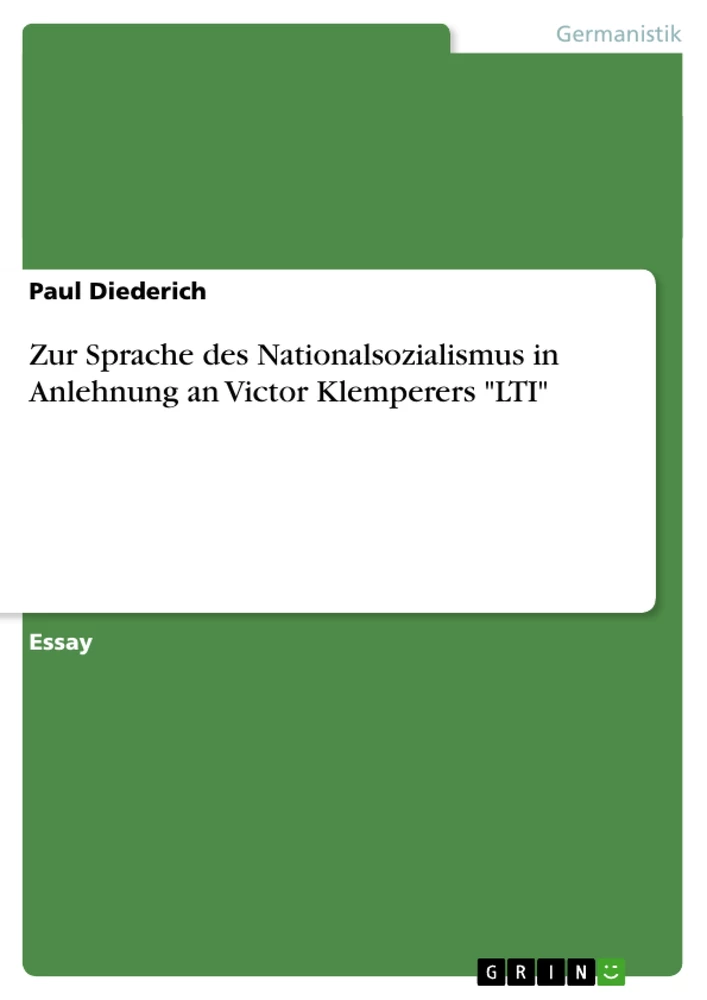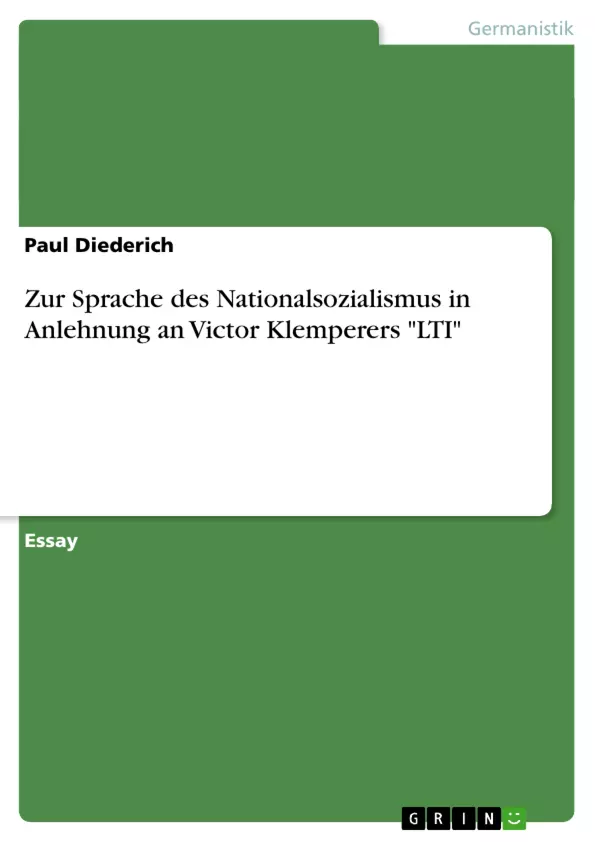Alles, was in Deutschland zur Zeit der Nationalsozialisten gedruckt wurde, war parteilich genormt. Unterschiede im Schreiben verschwanden, und am Ende stand die LTI. Von jedem gelesen, wurde sie dank der ihr eigenen Aufdringlichkeit irgendwann auch zum Wortschatz des normalen sprechenden Bürgers. Dass selbst verschiedene Juden nationalsozialistisch geprägte Wörter verwendeten, lässt erahnen, was für ein Ansteckungspotential diese Sprache durch ihre markanten Wörter und hunderttausendfache Wiederholungen besaß. Die Gleichheit der Redeform lässt sich also zum großen Teil als eine Folge der parteilichen Normung der Schriftsprache verstehen.
Klemperer schreibt in seinem LTI: “Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen, sie wurde durch nichts erzielt, was man mit bewußtem Denken oder bewußtem Fühlen in sich aufnehmen musste. Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewußt übernommen wurden.” (S.26)
Die Artikel, Einzelreden und Flugblätter waren dabei wohl die Kraft, die die Lawine ins Rollen brachte - aber erst durch die Einzelworte, Redewendungen und Wiederholungen glitt die Sprache ins Fleisch, also ins Unbewusste hinüber.
Klemperer kommt zu dem Schluss, dass die Sprache die Gefühle und das ganze seelische Wesen des Einzelnen steuern kann, und zwar umso mehr, je mehr sich dieser ihr überlässt und sie unbewusst benutzt. Die Nationalsozialisten versuchten also durch die Sprache die Menschen zu manipulieren und in ihre Gefühlswelten einzugreifen, was ihnen durchaus mit Erfolg gelang.
Es gibt dabei einige besonders hervorstechende Merkmale der Sprache des Nationalsozialismus. So waren zum Beispiel die tausendfachen Wiederholungen und verschiedene stark beanspruchte Wortschatzfelder - Sport, Religion usw. - aus dem alltäglichen Sprachgebrauch im Nationalsozialismus nicht mehr wegzudenken.
Zur Sprache des Nationalsozialismus -
In Anlehnung an Victor Klemperers LTI
Alles, was in Deutschland zur Zeit der Nationalsozialisten gedruckt wurde, war parteilich genormt. Unterschiede im Schreiben verschwanden, und am Ende stand die LTI. Von jedem gelesen, wurde sie dank der ihr eigenen Aufdringlichkeit irgendwann auch zum Wortschatz des normalen sprechenden Bürgers. Dass selbst verschiedene Juden nationalsozialistisch geprägte Wörter verwendeten, lässt erahnen, was für ein Ansteckungspotential diese Sprache durch ihre markanten Wörter und hunderttausendfache Wiederholungen besaß. Die Gleichheit der Redeform lässt sich also zum großen Teil als eine Folge der parteilichen Normung der Schriftsprache verstehen.
Klemperer schreibt in seinem LTI: “Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen, sie wurde durch nichts erzielt, was man mit bewußtem Denken oder bewußtem Fühlen in sich aufnehmen musste. Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewußt übernommen wurden.” (S.26)
Die Artikel, Einzelreden und Flugblätter waren dabei wohl die Kraft, die die Lawine ins Rollen brachte - aber erst durch die Einzelworte, Redewendungen und Wiederholungen glitt die Sprache ins Fleisch, also ins Unbewusste hinüber.
Klemperer kommt zu dem Schluss, dass die Sprache die Gefühle und das ganze seelische Wesen des Einzelnen steuern kann, und zwar umso mehr, je mehr sich dieser ihr überlässt und sie unbewusst benutzt. Die Nationalsozialisten versuchten also durch die Sprache die Menschen zu manipulieren und in ihre Gefühlswelten einzugreifen, was ihnen durchaus mit Erfolg gelang.
Es gibt dabei einige besonders hervorstechende Merkmale der Sprache des Nationalsozialismus. So waren zum Beispiel die tausendfachen Wiederholungen und verschiedene stark beanspruchte Wortschatzfelder - Sport, Religion usw. - aus dem alltäglichen Sprachgebrauch im Nationalsozialismus nicht mehr wegzudenken.
Das erste dieser Wortschatzfelder, das ich behandeln werde, ist das des Sports.
1) Sport
Da nach dem Versailler Vertrag Wehrpflicht verboten war, musste die Parteiführung versuchen, andere Möglichkeiten zu finden, um die jungen Männer zu kräftigen und gesunde, sportliche, kriegsfähige Soldaten auszubilden.
Da man diese Ausbildung nun nach dem ersten Weltkrieg natürlich nicht mehr auf der ernsten Ebene der Armee anbieten konnte respektive durfte, versuchte man, die Betreibung von Sport (die noch erlaubt war) allgemein zu fördern und die Sicht des Volkes auf den Sport positiver zu gestalten, indem man ihm einen immer größeren Stellenwert im Leben einräumte.
So wurden zum Beispiel berühmte deutsche Sportler (Autofahrer,…) über alle Maßen gelobt und bewundert und wie Helden behandelt. Sport wurde zu einer Form des nazistischen Heldentums, und es kam durch geschickte politische Manipulation zu einer allgemeinen Sportbegeisterung in Deutschland.
Diese Manipulation geschah, wie so vieles im Dritten Reich, zum Teil über den Weg der Sprache. So lässt sich auch heute noch feststellen, welch große Bedeutung dem Wortschatzfeld des Sports damals zukam.
Hitler liebte den Ausdruck “körperliche Ertüchtigung” (den er im Lexikon der Weimarer Konservativen gefunden hatte) und er stellte eine Rangordnung der zu fördernden Fähigkeiten auf.
Das Körperliche stand dabei klar im Vordergrund: zuerst sollte für die körperliche Ertüchtigung gesorgt werden, an zweiter Stelle kam die Ausbildung des Charakters, und erst an dritter Stelle, nur widerwillig zugelassen und verdächtigt, geschmäht und als “niedrig“ angesehen, stand die Ausbildung des Intellekt. Diese Zurückstellung des Denkens zeigt die Angst der Nationalsozialisten vor dem selbständig denkenden Menschen. Sie wollten das Volk über den Weg des Fühlens und des Glaubens erreichen und nicht über den Weg des Intellekts. Darauf wird noch im Absatz des Wortschatzfeldes “Religion” näher eingegangen werden.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung LTI?
LTI steht für "Lingua Tertii Imperii", die Sprache des Dritten Reiches, ein Begriff, den Victor Klemperer prägte.
Wie wirkte die Sprache des Nationalsozialismus auf die Menschen?
Laut Klemperer wirkte sie nicht primär durch Einzelreden, sondern durch die millionenfache Wiederholung von Einzelworten und Redewendungen, die unbewusst ins "Fleisch und Blut" der Menge übergingen.
Welche Rolle spielte das Vokabular des Sports?
Da die Wehrpflicht verboten war, wurde Sport zur körperlichen Ertüchtigung und Ausbildung kriegsfähiger Soldaten instrumentalisiert. Sportbegriffe dienten der Heroisierung.
Warum wurde der Intellekt in der NS-Sprache abgewertet?
Die Nationalsozialisten bevorzugten das Gefühl und den Glauben gegenüber dem Denken, um Menschen leichter manipulieren zu können und selbstständiges Denken zu unterdrücken.
Was war das Ziel der sprachlichen Normung?
Ziel war die Gleichschaltung der Redeform, um Unterschiede im Denken verschwinden zu lassen und die Ideologie der Partei allgegenwärtig zu machen.
- Arbeit zitieren
- MA Paul Diederich (Autor:in), 2009, Zur Sprache des Nationalsozialismus in Anlehnung an Victor Klemperers "LTI", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232062