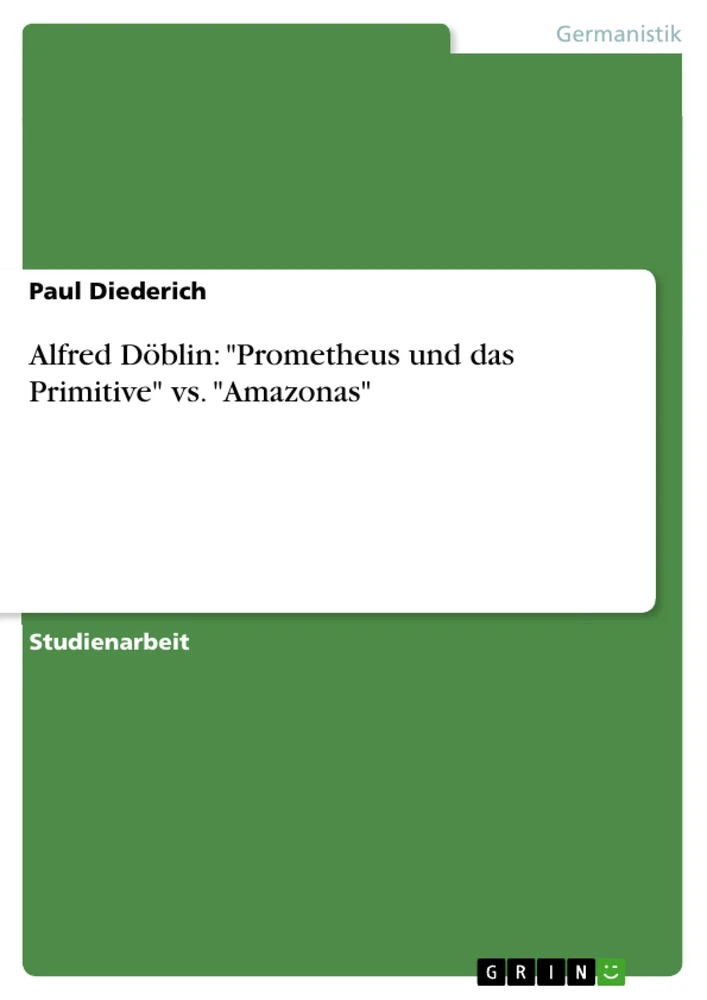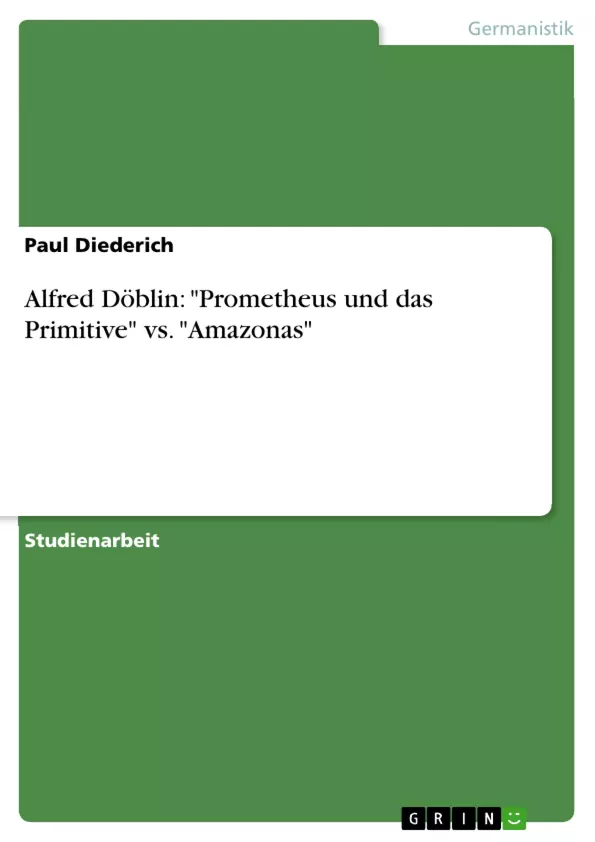Man könnte sich fragen, was Döblin Mitte der dreißiger Jahre, als die faschistische Gefahr schon deutlich sichtbar war, dazu motivieren konnte, einen Roman scheinbar so völlig losgelöst von der politischen Realität zu schreiben, wie die Erzählung über die frühen Eroberungen der Weißen in Südamerika - Amazonas. Manche warfen ihm sogar vor, dass es für einen Geschichtsroman die falsche Zeit sei und dass er sich doch bitte der gegenwärtigen Realität zuwenden solle.
Spätestens mit dem im Anschluss an die Amazonas-Trilogie erschienenen Essay Prometheus und das Primitive sollte allerdings deutlich geworden sein, dass sich die Trilogie durchaus mit der damaligen politischen Aktualität beschäftigte.
So kommt auch Kittstein zu dem Schluss, dass der Essay “zutiefst geprägt” ist “vom Gegenwartsinteresse des Verfassers” (Kittstein 2006, S.289) und in erster Linie das Ziel verfolgt, “den Nationalsozialismus aus der historischen Entwicklung Europas heraus verständlich zu machen.” (Kittstein 2006, S.289)
Betrachtet man die Amazonas-Trilogie also als ebensolchen Erklärungsversuch, so wird dem Vorwurf, es sei die falsche Zeit für einen Geschichtsroman, der Boden unter den Füßen weggezogen. Auch der Vorwurf mangelnder Kontinuität zwischen den Bänden kann in diesem Kontext zurückgewiesen werden...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zusammenhang zwischen Amazonas und Prometheus und das Primitive
- Die Sonderstellung des Menschen in der Welt und die Aufgaben der Technik
- Prometheus und das Primitive
- Tendenzen der Annäherung an den Gegenspieler
- Mystik und Pseudomystik
- Möglichkeit der Rückkehr zur Natur
- Möglichkeiten der Aufhebung der Vereinzelung
- Der absolute Staat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Alfred Döblins Amazonas-Trilogie und sein Essay Prometheus und das Primitive untersuchen die Ambivalenz des Menschen in seiner Beziehung zur Natur und der Technik. Der Essay ist stark durch die politische Situation der 1930er Jahre geprägt und dient als Hintergrund für das Verständnis der Trilogie, die die frühen Eroberungen der Weißen in Südamerika schildert.
- Die Sonderstellung des Menschen als Teil und gleichzeitig Gegenspieler der Natur
- Die Rolle der Technik als Versuch, die Natur zu überwinden und Isolation aufzuheben
- Die Dynamik von Prometheischem und Primitivem als Antriebe menschlicher Handlungen
- Der Entstehungsprozess totalitärer Staatsformen als Resultat von gesellschaftlichen Entwicklungen
- Die ambivalente Beziehung des Menschen zu seinem eigenen Wesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Döblins Amazonas-Trilogie und seinem Essay Prometheus und das Primitive dar und widerlegt Kritiken, die die Trilogie als losgelöst von der politischen Realität ansehen. Döblin nutzt die historische Erzählung als Mittel, um die Entstehung des Nationalsozialismus und totalitärer Staatsformen zu analysieren.
- Der Zusammenhang zwischen Amazonas und Prometheus und das Primitive: Das Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen der Trilogie und dem Essay, wobei betont wird, dass die Trilogie eine konkrete Darstellung menschlicher Erfahrungen unter den geschichtlichen Bedingungen liefert, während der Essay einen theoretischen Überbau bietet.
- Die Sonderstellung des Menschen in der Welt und die Aufgaben der Technik: Dieses Kapitel analysiert Döblins These, dass der Mensch als Teil der Natur gleichzeitig versucht, sich von ihr zu lösen. Die Technik wird als Versuch verstanden, die Natur zu überwinden und die Isolation des Menschen zu überwinden.
Schlüsselwörter
Döblins Werke beleuchten die Themen des Menschenbildes, Natur, Technik, Isolation, Prometheisches und Primitives, totalitärer Staat, Nationalsozialismus, historische Entwicklung und gesellschaftliche Strukturen. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz des Menschen in seiner Beziehung zur Natur und der Technik sowie auf der Entstehung des Nationalsozialismus als Resultat von geschichtlichen Prozessen.
- Arbeit zitieren
- MA Paul Diederich (Autor:in), 2009, Alfred Döblin: "Prometheus und das Primitive" vs. "Amazonas", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232063