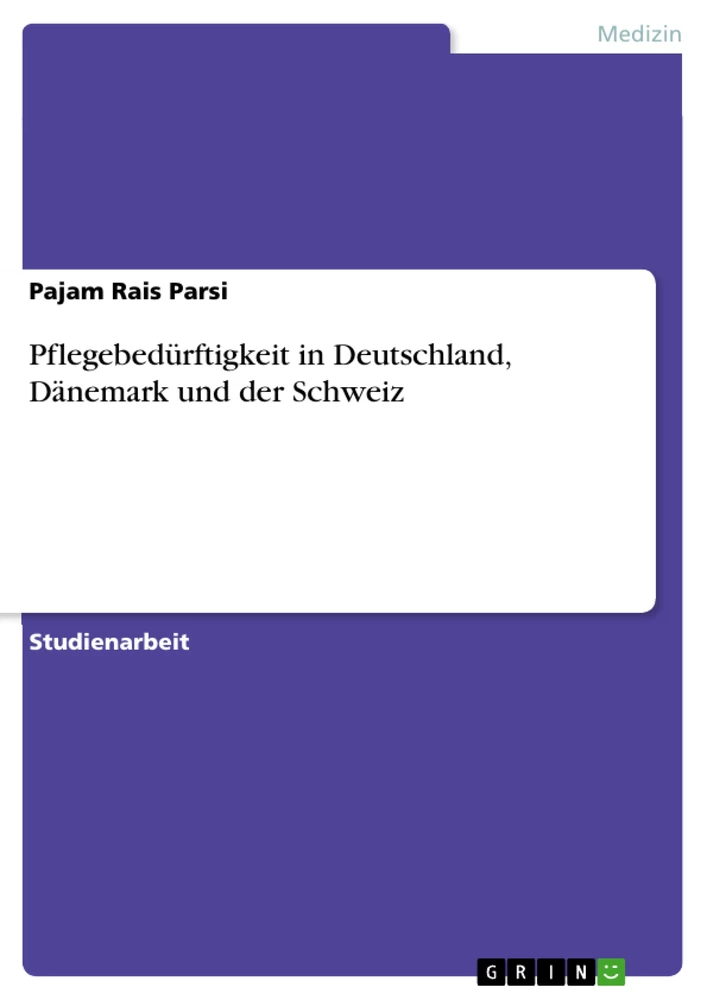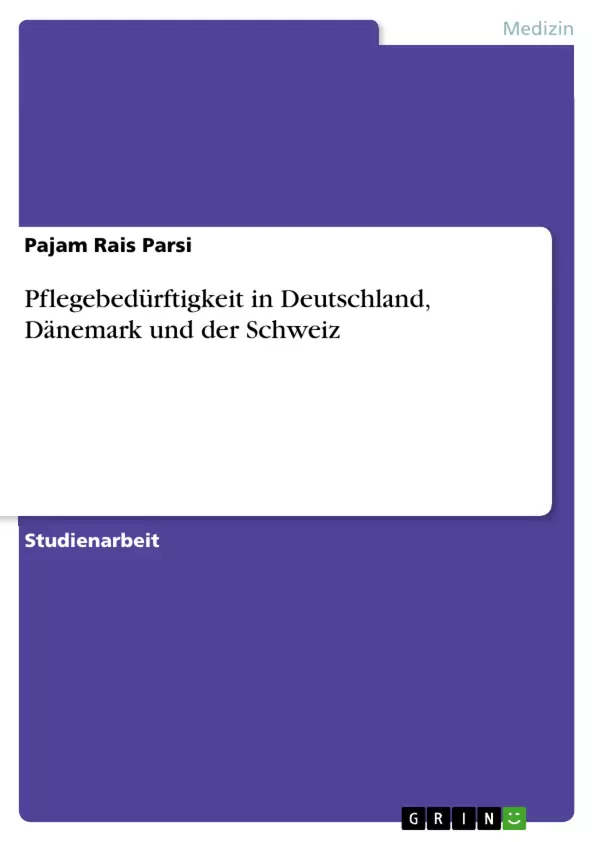Die Bevölkerungsentwicklung ist weltweit durch eine zunehmende Alterung der Bevölkerung geprägt. Der Anteil der Kinder sinkt weiter, während der Anteil der Älteren und Hochaltrigen weiter steigt. Europa gehört bereits heute zu den ältesten Regionen der Welt und aufgrund von Bevölkerungsvorausrechnungen kann angenommen werden, dass dieser Prozess weiter voranschreiten wird (Mai 2007). Auch wenn Alter und Krankheit bzw. Alter und Pflegebedürftigkeit nicht zwingend miteinander einhergehen, ist aufgrund der demografischen Entwicklung dennoch davon auszugehen, dass der Anteil der Pflegebedürftigen ebenfalls ansteigen wird (Kuhlmey/Blüher 2011).
Eine weitere Konsequenz dieser Bevölkerungsentwicklung besteht darin, dass der wachsenden Gruppe von Pflegebedürftigen eine immer kleiner werdende Gruppe von Pflegepersonen aus dem familiären Umfeld gegenüberstehen wird (Mai 2007). Aus diesem Grund kommt der professionellen Pflege eine immer größere Bedeutung zu, da die entstehenden Pflegebedarfe auf diesem Weg gedeckt werden müssen. Eine adäquate Versorgung der Pflegebedürftigen ist jedoch nur dann gewährleistet, wenn die Pflegebedürftigkeit angemessen definiert und der Hilfebedarf umfassend erhoben und finanziert wird.
Im Folgenden soll dargestellt werden, wie in verschiedenen Ländern – Deutschland, Dänemark und der Schweiz – in diesen Punkten verfahren wird. Die drei Länder können jeweils als Vertreter eines eigenen Typus des Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaates angesehen werden und auch die Finanzierung der Pflegeleistungen findet auf unterschiedlichen Wegen statt. Dennoch stehen alle drei Länder vor den gleichen, bereits beschriebenen, Herausforderungen.
Ziel dieser Arbeit ist es zunächst kurz darzustellen, wie die Pflegeleistungen in Deutschland, Dänemark und der Schweiz finanziert werden. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dann auf den verschiedenen Pflegebedürftigkeitsbegriffen sowie auf den Begutachtungsassessments, die zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit verwendet werden. Abschließend werden jeweils mögliche Vor- und Nachteile kurz angesprochen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hintergrund und Relevanz des Themas
3 Ländervergleich
3.1 Deutschland
3.1.1 Pflegebedürftigkeitsbegriff
3.1.2 Feststellung der Pflegebedürftigkeit
3.1.3 Zwischenfazit
3.2 Dänemark
3.2.1 Pflegebedürftigkeitsbegriff
3.2.2 Feststellung der Pflegebedürftigkeit
3.2.3 Zwischenfazit
3.3 Schweiz
3.3.1 Pflegebedürftigkeitsbegriff
3.3.2 Feststellung der Pflegebedürftigkeit
3.3.3 Zwischenfazit
4 Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Pajam Rais Parsi (Author), 2012, Pflegebedürftigkeit in Deutschland, Dänemark und der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232134