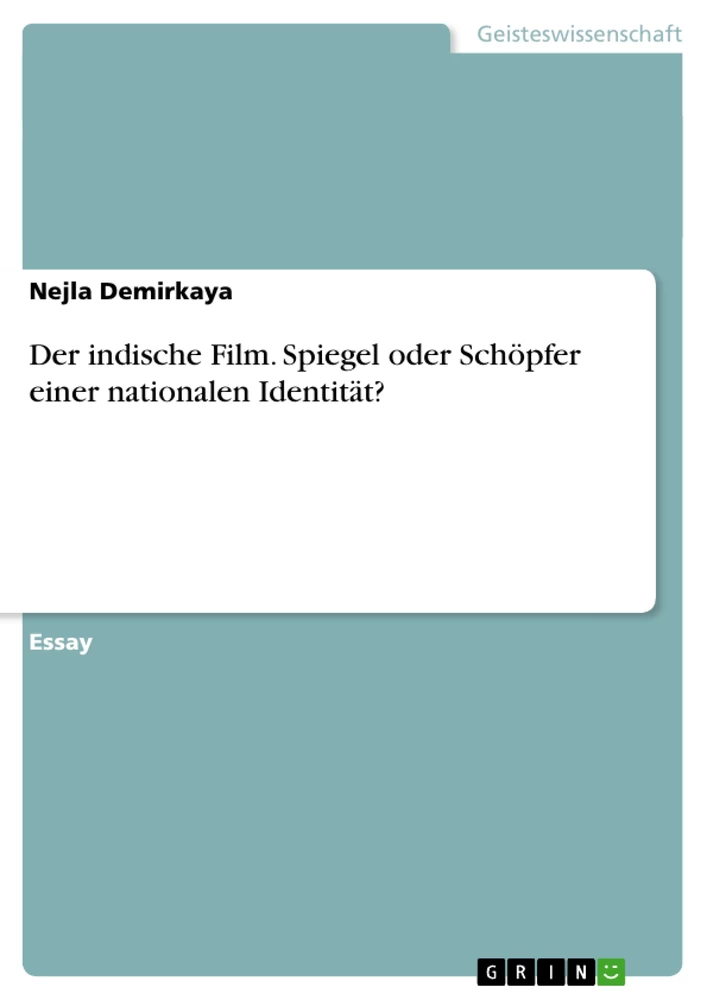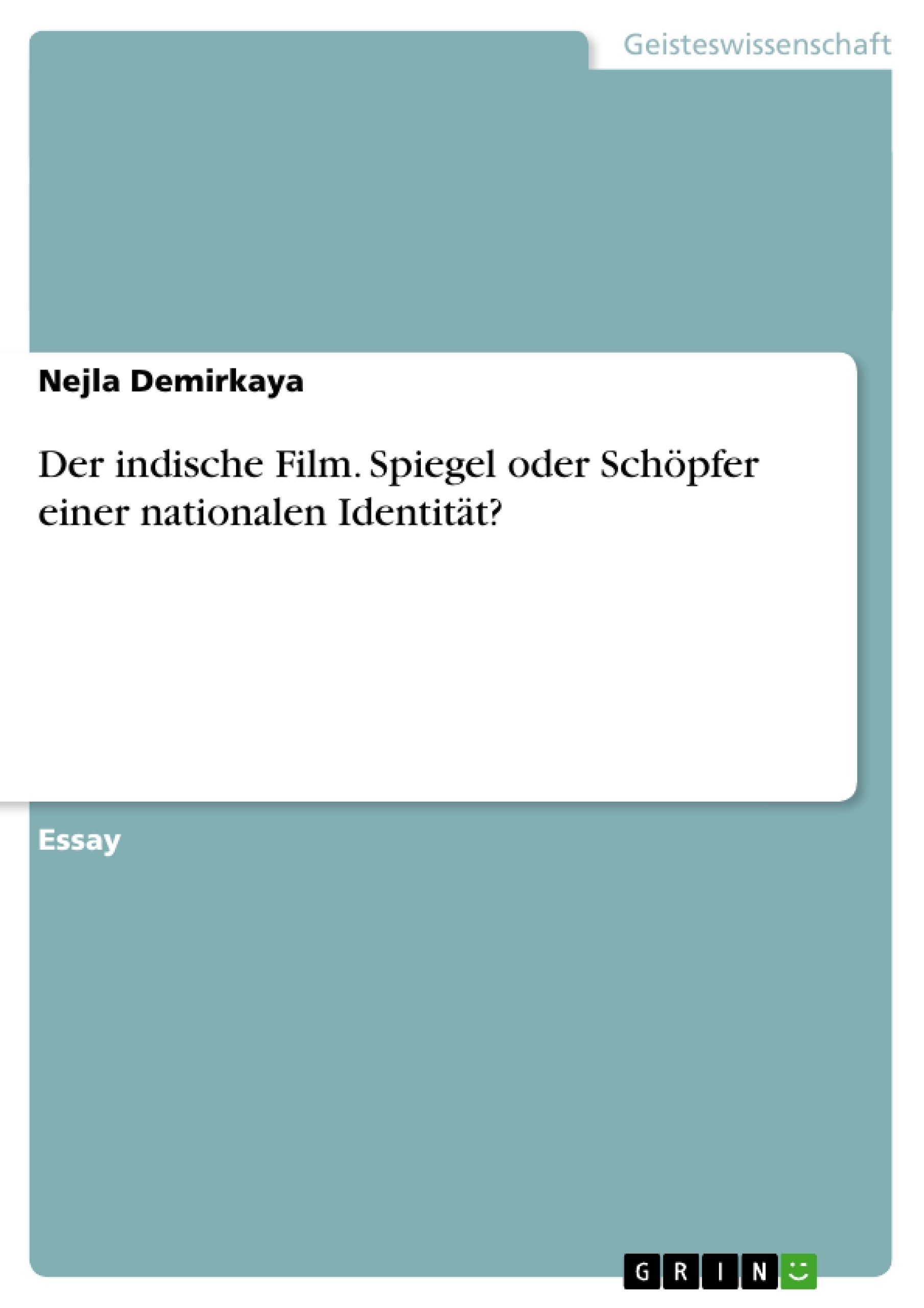Die Kultur der Republik Indien stellt ein Konglomerat aus den unterschiedlichsten Bräuchen und Traditionen, Sprachen und Mentalitäten dar. Dennoch fordern und fördern der Staat ebenso wie nationalistische Akteure in Politik, Gesellschaft und Kultur seit der Unabhängigkeit das Aufkommen eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, das all diese Trennlinien überwindet und das Volk zusammenführt. Gerade in Indien, wo es die dominierende kulturelle Institution darstellt (Mallot, 2012, S. 61), eignet sich das Massenmedium Film dazu, eine solche nationalistische Vision Wirklichkeit werden zu lassen – oder die wahrgewordene Nation zu repräsentieren. Inwiefern fungieren also indische Filme, seien es dokumentarische, Kurz- oder Spielfilme aus Bombay, als Spiegel oder als Schöpfer einer (pan-)indischen Identität? Im Folgenden soll anhand der ausführlichen Besprechung der genannten Gattungen mit Schwerpunkt auf dem Hindi-Film und besonders aussagekräftiger Phänomene aufgezeigt werden, dass beide Aspekte, der „spiegelnde“ und der „schöpferische“, durchaus ambivalent sind.
„The cinema is widely considered a microcosm of the social, political, economic, and cultural life of a nation. It is the contested site where meanings are negotiated, traditions made and remade, identities affirmed or rejected.“
-Sumita S. Chakravarty, 1993, S. 32.
Die Kultur der Republik Indien stellt ein Konglomerat aus den unterschiedlichsten Bräuchen und Traditionen, Sprachen und Mentalitäten dar. Dennoch fordern und fördern der Staat ebenso wie nationalistische Akteure in Politik, Gesellschaft und Kultur seit der Unabhängigkeit das Aufkommen eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, das all diese Trennlinien überwindet und das Volk zusammenführt. Gerade in Indien, wo es die dominierende kulturelle Institution darstellt (Mallot, 2012, S. 61), eignet sich das Massenmedium Film dazu, eine solche nationalistische Vision Wirklichkeit werden zu lassen – oder die wahrgewordene Nation zu repräsentieren. Inwiefern fungieren also indische Filme, seien es dokumentarische, Kurz- oder Spielfilme aus Bombay, als Spiegel oder als Schöpfer einer (pan-)indischen Identität? Im Folgenden soll anhand der ausführlichen Besprechung der genannten Gattungen mit Schwerpunkt auf dem Hindi-Film und besonders aussagekräftiger Phänomene aufgezeigt werden, dass beide Aspekte, der „spiegelnde“ und der „schöpferische“, durchaus ambivalent sind.
Schon früh erkannte die Regierung des unabhängigen Indien das Potenzial des Mediums als Instrument der Nationenbildung. Ziel war die Schaffung einer zumindest identitätspsychologisch homogenen Gesellschaft. In diesen Anfangsjahren nahmen Dokumentarfilme der staatlichen Films Division of India (FDI) am sichtbarsten diese Funktion an: Der Großteil der vom FDI produzierten und vertriebenen Filme waren pädagogischer Natur. Sie sollten das Volk mit dem vielgestaltigen kulturellen, historischen wie natürlichen Erbe ihres Landes vertraut machen und richteten sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen, Erwachsene ebenso wie Schulkinder. Hierbei kam die staatliche Propagierung der „unity in diversity“ unmissverständlich zum Ausdruck, die Vorstellung eines trotz oder gerade wegen seiner Verschiedenartigkeit und in seiner Loyalität gegenüber der politischen Führung, der staatlichen Repräsentation der Nation, geeinten Volkes. Kinobetreiber waren noch bis in die 1990er hinein dazu verpflichtet, diese Produktionen vor der eigentlichen Vorführung zu zeigen zwecks größtmöglicher Verbreitung; allerdings dürfte der angestrebte Effekt unter den Zuschauern letztendlich nicht eingetreten sein (Roy, 2002, S. 237 f.).
Denn es war vorallem der Spielfilm, die große gemeinsame Leidenschaft des indischen Volkes, welcher die Massen flächendeckend in seinen Bann zu schlagen und damit sogar sozio-kulturelle Grenzen zu überwinden vermochte (Guha, 2008, S. 709). Eine zunächst indirekte Wirkung kann dem Film dabei nicht abgesprochen werden: Bereits der bloße Besuch eines Kinos, in Indien immer auch als soziales Ereignis zelebriert (vgl. Srinivas, 2002), offenbart den einigenden Einfluss des Mediums Film: Das Publikum kommt zusammen, um sich in vielen Produktionen selbst repräsentiert zu sehen, und weiß um die Tatsache, dass nicht nur die fremden Sitznachbarn, sondern gleichzeitig unzählige andere Menschen im ganzen Land in einem Kinosaal sitzen, um möglicherweise sogar den selben Film zu schauen und sich mit ihm zu identifizieren (Mallot, 2012, S. 64.). Überregional verehrte Schauspieler[1] wie Raj Kapoor, Nargis und Amitabh Bachchan mögen nach wie vor ihren Teil dazu beitragen, dass das sich mit ihnen identifizierende Volk aufgrund der selben Favoriten und Idole auch untereinander ein Gemeinschaftsgefühl verspürt. Zudem wäre es wichtig zu ermessen, in welchem Ausmaß das Wissen um die Herkunft und den Glauben aller an einer Filmproduktion Beteiligten, falls vorhanden, Einfluss auf die Selbst- und Weltwahrnehmung der Zuschauer gehabt haben mag. Für „Sholay“ (1975), einem der Klassiker unter den Hindi-Filmen, kamen bspw. tamilische und bengalische Schauspieler, ein Regisseur aus Sindh und Autoren aus dem Punjab zusammen (Guha, 2008, S. 716 f.). Einige der populärsten Darsteller des Bombay-Kinos waren und sind Muslime; als gegenwärtiges Beispiel ist der Schauspieler Shah Rukh Khan zu nennen, der in seiner Heimat und darüber hinaus in allen denkbaren sozialen Gruppen kultische Verehrung genießt. Es darf gemutmaßt werden, dass all diese Ikonen des von der Zielgruppe zweifellos als „national“ empfundenen Kinos die Aufnahme anderer Gruppen in das Verständnis von der indischen Nation unterstützen.
Doch nicht nur die große Leinwand, auch das heimische Fernsehgerät vermochte die Massen überregional zu einer einzigen Zuschauerschaft zu verschmelzen. Die Ausstrahlung des „Ramayana“ in den 1980ern diente dem Ziel nationaler Integration, und tatsächlich fand diese Verfilmung des hinduistischen Epos flächendeckenden Anklang, ebenso wie wenige Jahre später die des „Mahabharata“. Da sich das Publikum in allen Regionen und Religionen Indiens finden ließ, kann in der Tat, wie von Politik und Presse erhofft und verbreitet, von der „Realisierung eines kollektiven Bewusstseins“ (Rajagopal, 2001, S. 207) gesprochen werden – zumindest temporär. Selbiges gilt auch für die Kurzfilme der „Vande-Mataram“-Reihe sowie weitere filmisch-musikalische Projekte aus dem Hause Bharatbala Productions, obgleich hierbei ein neuer und entscheidender Aspekt hinzukommt. Um die Jahrtausendwende beinhalten diese Videos eine der nationalistischen Ideologie des FDI ähnliche Botschaft: Die Einheit Indiens in all ihrer natürlichen und menschlichen Vielfalt unter der gemeinsamen Regierung, hier u.a. symbolisiert durch die safran-weiß-grüne Flagge. Nun gehen Mentalitätswandel und technologischer Fortschritt dabei Hand in Hand: Die Ausstrahlung eines den indischen „Helden“ und „Märtyrern“ des Kargil-Krieges zwischen Indien und Pakistan gewidmeten Videos nicht nur auf Fernsehkanälen, sondern zeitgleich im Internet markiert den Übergang vom in Indien ansässigen nationalen Individuum, wie er von der Verfassung seit 1950 vorgesehen war, zum auch im Ausland lebenden Angehörigen der Nation, der über einen einfachen Mausklick jederzeit Verbindung zur Heimat herstellen kann (Roy, 2002, S. 253). Doch dieser Übergang offenbart sich nicht nur in der globalen Verfügbarkeit dieser wenige Minuten umfassenden Produktionen, sondern noch unmittelbarer erfahrbar in den in Spielfilmen erzählten Geschichten. In jüngeren Werken des Bombay-Kinos, für die „Swades“ von 2004[2] beispielhaft ist, nimmt der indische Auswanderer, der trotz seiner körperlichen Entfernung vom Heimatland emotional noch immer mit diesem verbunden ist und es beim wirtschaftlichen Wachstum unterstützt, mehr und mehr Raum ein. Während der indische Migrant in älteren Filmen als verräterischer, moralisch verderbter Antagonist dargestellt wurde, erscheint er also nun in einem weitaus vorteilhafteren Licht, als das Idealbild des an die modernen Gegebenheiten angepassten, global wettbewerbsfähigen und vermögenden Inders, dessen Herz trotz seiner internationalen Versiertheit nach wie vor einzig seiner Heimat gehört. Er ist damit nicht länger ein Vertreter der „Anderen“, der „Nicht-Inder“, durch welche die Ideologen der Nationenbildung das indische Volk zu definieren versuchen (Ranganathan, 2010, S. 44 ff.).
[...]
[1] Fast ausschließlich der Hindi-Film aus Bombay brachte aufgrund der Größe des Sprachgebietes diese überregional verehrten Schauspieler hervor. Ihnen setzte sich v.a. in Südindien teilweise massiver Widerstand entgegen; vgl. hierzu Guha, 2008, S. 714 f.
[2] „Swades“, die Geschichte eines aus den USA Heimkehrenden, der in Indien seinen Nationalstolz und seine Verantwortung für das Vaterland entdeckt, erschien ein Jahr nach der Durchsetzung des Dual Citizenship Act, welcher erstmals in der Geschichte des unabhängigen Indiens zwei Staatsbürgerschaften akzeptiert; vgl. hierzu Ranganathan, 2010, speziell S. 47.
Häufig gestellte Fragen
Wie trägt der indische Film zur nationalen Identität bei?
Der indische Film, insbesondere aus Bollywood, fungiert als „Schöpfer“ einer pan-indischen Identität, indem er nationale Symbole nutzt und ein Gemeinschaftsgefühl über regionale und religiöse Grenzen hinweg erzeugt.
Was bedeutet "Unity in Diversity" im Kontext des indischen Kinos?
Es beschreibt die staatlich geförderte Idee, dass Indien trotz seiner enormen kulturellen und sprachlichen Vielfalt eine Einheit bildet, was oft in Dokumentar- und Spielfilmen thematisiert wird.
Welche Rolle spielt Shah Rukh Khan für die indische Gesellschaft?
Als muslimischer Superstar in einem mehrheitlich hinduistischen Land verkörpert er die integrative Kraft des Kinos und dient als Identifikationsfigur für Millionen von Menschen weltweit.
Wie hat sich die Darstellung von Auswanderern im indischen Film gewandelt?
Früher oft als „Verräter“ dargestellt, werden Migranten in modernen Filmen wie „Swades“ als patriotische Helden inszeniert, die ihre Heimat wirtschaftlich und emotional unterstützen.
Inwiefern spiegeln Filme die soziale Realität Indiens wider?
Filme dienen als Mikrokosmos der Gesellschaft, in dem soziale Konflikte, Traditionen und wirtschaftliche Veränderungen verhandelt und für ein Massenpublikum aufbereitet werden.
- Citation du texte
- Nejla Demirkaya (Auteur), 2013, Der indische Film. Spiegel oder Schöpfer einer nationalen Identität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232168