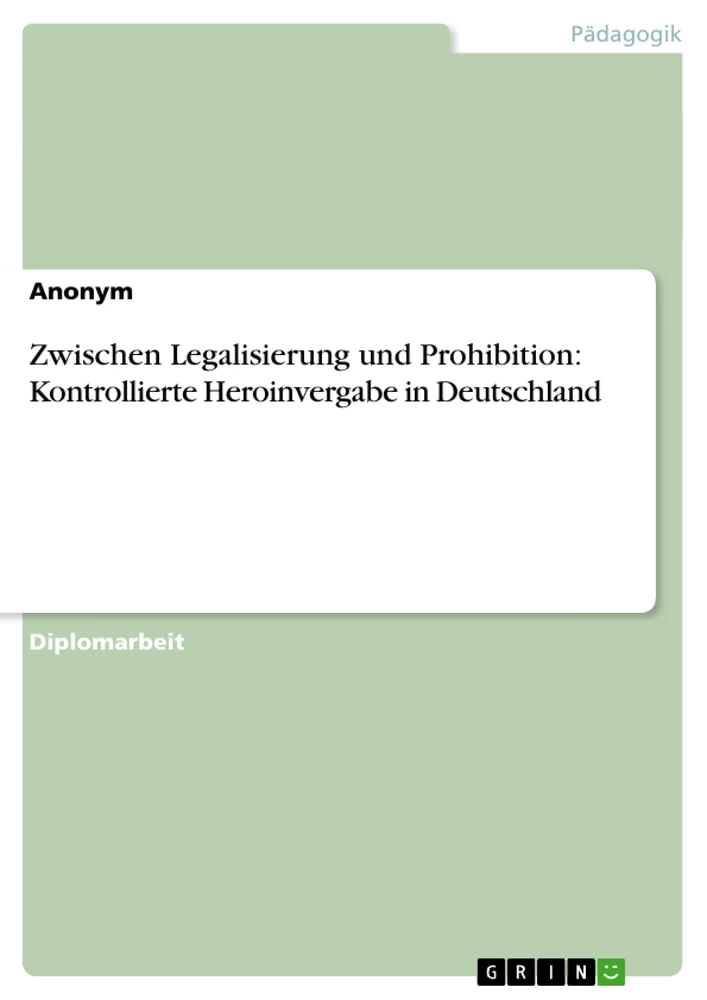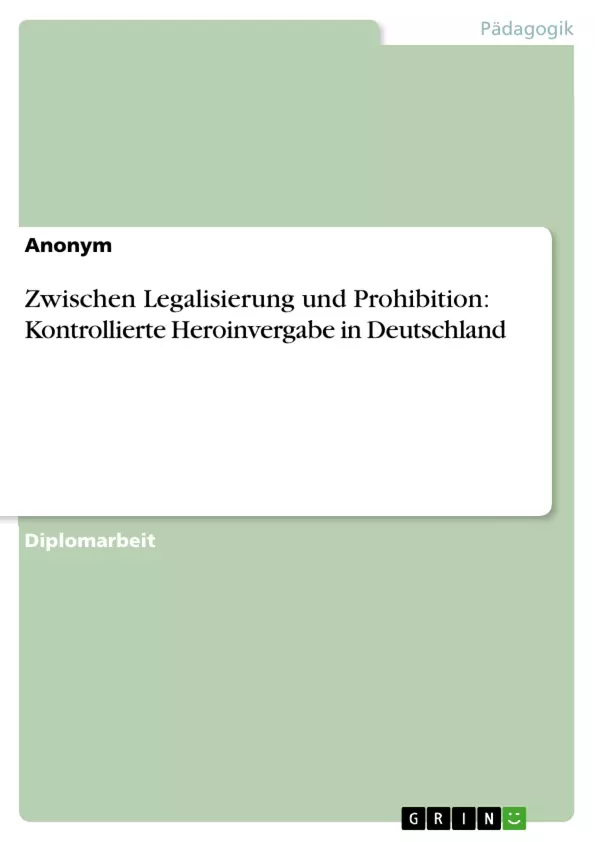Die prohibitiven und repressiven Maßnahmen der Drogenpolitik und die allein auf Abstinenz ausgerichtete Drogenhilfepraxis haben sich in der Vergangenheit als weitgehend ineffizient erwiesen und für die Konsumenten illegaler Drogen eine Reihe von Nebenfolgen bedingt. Vor dem Hintergrund zunehmender sozialer und gesundheitlicher Verelendung der Drogengebraucher, steigender HIV- und Hepatitisinfektionen sowie vermehrter Drogentodesfälle wurden neue Praxismodelle in der Drogenhilfe entwickelt. Seit Ende der 1980er Jahre befindet sich die Drogenhilfe in einer Umbruchsphase hin zu einem bedürfnis- und adressatenorientierten Hilfesystem. Angebote akzeptanzorientierter Drogenhilfe kamen hinzu, welche nicht mehr das primäre Ziel der Drogenabstinenz, sondern die Schadensminimierung und die Eigenverantwortung der Konsumenten illegaler Drogen betont. 1990 wurde in Deutschland eine gesetzliche Grundlage für die Substitution, d.h. die Vergabe von Ersatzstoffen wie Methadon an sogenannte „Schwerstabhängige“ 1 geschaffen. Seit Ende der 1980er Jahre wurde in der Bundesrepublik um ein Modellprojekt zur kontrollierten Heroinvergabe diskutiert, welches im September 1999 ausgeschrieben wurde und seit Ende 2001 realisiert wird.
Will man die Möglichkeiten und Grenzen einer kontrollierten Verschreibung von Heroin an Opiatabhängige untersuchen, so ist zu bedenken, daß ein solches Projekt nicht in einem gesellschaftlich und politisch unbeeinflußten Vakuum praktiziert wird. Daher ist es unumgänglich, zunächst einen Blick auf die derzeitige Forschungslandschaft zur Ursachendiskussion von „Sucht“ und „Drogenabhängigkeit“ zu werfen, sowie im Hinter-grund der Prämissen gegenwärtiger Drogenpolitik die Situation der Konsumenten illegaler Drogen sowie die Möglichkeiten und Grenzen der bisherigen Drogenhilfepraxis in Deutschland zu betrachten. Da das deutsche Modellprojekt auf die Erfahrungen in der Schweiz aufbaut, ist es notwendig, auf das Schweizer Projekt zur Verschreibung von Betäubungsmitteln einzugehen und im Anschluß an die Darstellung des deutschen Projektes einen Vergleich zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Begriffsklärungen
- "Droge"
- Die Drogen Heroin und Methadon
- Heroin
- Methadon
- "Drogengebrauch" und "Drogenmißbrauch"
- "Sucht" und "Abhängigkeit"
- Wissenschaftliche Theorien der Entstehung von Sucht und Drogenabhängigkeit
- Psychoanalytischer Ansatz
- Medizinisch-psychiatrischer Ansatz
- Lerntheoretischer Ansatz
- Das "Karriere-Modell"
- Fazit
- Drogenpolitische Hintergründe
- Maßnahmen und Zielsetzungen bundesdeutscher Drogenpolitik
- Wichtige betäubungsmittelrechtliche Vorschriften
- Prävention
- Die Situation der Heroinkonsumenten in Deutschland
- Verbreitung des Heroinkonsums
- Erscheinungsformen und Begleitfolgen des Gebrauchs von Heroin unter den Bedingungen der Prohibition
- Einfluß des Drogenverbots auf die Möglichkeit eines kontrollierten Heroinkonsums
- Auswirkungen der Prohibition auf die Konsumformen von Heroin-gebrauchern
- Einfluß der Repression auf selbstinitiierte Ausstiegsprozesse aus der Drogenabhängigkeit
- Gesundheitliche und soziale Folgen
- HIV und Hepatitis
- Soziale Ausgrenzung und Marginalisierung
- Drogentodesfälle
- Kritische Betrachtung repressiver Drogenpolitik
- Einordnung der kontrollierten Heroinvergabe in das bestehende Drogenhilfesystem
- Zur historischen Entwicklung des Hilfesystems für Abhängige illegaler Drogen
- Die Therapeutische Kette
- Grundlagen und Zielsetzungen akzeptanzorientierter Drogenhilfe
- Praktische Ausrichtung akzeptierender Drogenhilfe
- Akzeptanzorientierte Drogenhilfe im Spannungsverhältnis zwischen normativen Ansprüchen und faktischen Bedingungen
- Medizinalisierung der Drogenhilfe
- Die Vitalität kultureller Mythen
- Akzeptanzorientierte Drogenhilfe im Paradoxon von Prohibition und Akzeptanz
- Fazit
- Wege zu einer „Normalisierung“
- Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung der Drogenpolitik
- Totallegalisierung
- Partiallegalisierung
- Staatlich kontrollierte Partiallegalisierung
- Medizinisch indizierte Heroinabgabe (Medizinalisierungsmodell)
- Projekt zur Verschreibung von Betäubungsmitteln (PROVE) in der Schweiz
- Zur Entstehung von PROVE
- Rechtsgrundlage des PROVE
- Zielgruppe und Aufnahmekriterien von PROVE
- Zielsetzung von PROVE
- Forschungsfragen
- Forschungsplan
- Psychosoziale Begleitbetreuung
- Ergebnisse der Pilotphase
- Substanzbezogene Ergebnisse
- Patientenbezogene Ergebnisse
- Projektbezogene Ergebnisse
- Vergleich mit Befunden aus stationären Abstinenzbehandlungen und Substitutionsbehandlungen mit Methadon
- Schlußfolgerungen
- Die heroingestützte Behandlung HeGeBe
- Kritische Betrachtung des Schweizer Projektes zur Verschreibung von Betäubungsmitteln (PROVE)
- Trends in der internationalen Forschung
- Das bundesdeutsche Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger – eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte Therapiestudie
- Entstehung und Entwicklung des bundesdeutschen Modellprojekts
- Rahmenbedingungen und Durchführungsmodalitäten des Forschungsprojektes
- Begründung zur Durchführung der Studie
- Zielgruppen
- Ein- und Ausschlußkriterien
- Studieneinschluß
- Ausschlußkriterien
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Projekts
- Zielsetzung der Studie und Hypothesen
- Forschungsfragen und Teilhypothesen
- Zusätzliche Spezialstudien
- Zeitlicher Rahmen und Durchführung des Projekts
- Finanzierung und Kosten der Studie
- Die psychosoziale Begleitung
- Case Management mit integrierter Motivierender Gesprächsführung
- Psychoedukation und Drogenberatung
- Das bundesdeutsche Modellprojekt in der Stadt Bonn
- Städtewahl
- Organisation des Bonner Vergabeprojektes
- Trägerschaft
- Räumlichkeiten
- Teilnahme am Bonner Heroinprojekt
- Personal
- Erste Eindrücke der Heroinbehandlung
- Kritische Betrachtung des bundesdeutschen Modellprojekts zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger
- Konzeptionelle Kritik im Vergleich zum Schweizer Modell
- Kritische Betrachtung der psychosozialen Begleitung
- Case Management mit integrierter Motivierender Gesprächsführung versus Psychoedukation und Drogenberatung
- Kritische Betrachtung der Rahmenbedingungen psychosozialer Begleitung im bundesdeutschen Modellprojekt
- Heroinverschreibung in Deutschland - ein Weg zur Normalisierung?
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die kontrollierte Heroinvergabe in Deutschland. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes im Kontext der bestehenden Drogenpolitik und -hilfe zu analysieren. Dabei werden verschiedene wissenschaftliche Theorien der Suchtentstehung berücksichtigt.
- Kontrollierte Heroinvergabe als Alternative zur Prohibition
- Analyse der deutschen und schweizerischen Modellprojekte
- Bewertung der Effektivität verschiedener Drogenhilfemodelle
- Die Rolle der Drogenpolitik in der Entstehung sozialer und gesundheitlicher Probleme
- Herausforderungen der Akzeptanzorientierten Drogenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Ineffizienz repressiver Drogenpolitik und die Notwendigkeit neuer Ansätze in der Drogenhilfe. Es beschreibt den Wandel hin zu bedürfnis- und adressatenorientierten Hilfesystemen und die zunehmende Bedeutung der Schadensminimierung. Der Fokus liegt auf der kontroversen Diskussion um die kontrollierte Heroinvergabe in Deutschland und die Notwendigkeit, die derzeitige Forschungslandschaft, die Drogenpolitik und die Praxis der Drogenhilfe zu beleuchten, um das deutsche Modellprojekt im Kontext der Erfahrungen in der Schweiz zu verstehen.
Begriffsklärungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie "Droge," "Drogengebrauch," "Drogenmißbrauch," "Sucht," und "Abhängigkeit." Es legt die Grundlage für ein präzises Verständnis der in der Arbeit behandelten Themen und vermeidet Missverständnisse durch eine klare Begriffsbestimmung, insbesondere im Hinblick auf Heroin und Methadon. Die Definitionen dienen als Referenzpunkt für die spätere Diskussion der wissenschaftlichen Ansätze und der politischen Maßnahmen.
Wissenschaftliche Theorien der Entstehung von Sucht und Drogenabhängigkeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene wissenschaftliche Theorien zur Entstehung von Sucht und Drogenabhängigkeit, darunter den psychoanalytischen, medizinisch-psychiatrischen und lerntheoretischen Ansatz sowie das "Karriere-Modell". Die Darstellung verschiedener Perspektiven verdeutlicht die Komplexität des Phänomens und die Grenzen einzelner Erklärungsansätze. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Herangehensweisen an die Drogenproblematik und der Entwicklung von Präventions- und Interventionsstrategien.
Drogenpolitische Hintergründe: Dieses Kapitel beleuchtet die Maßnahmen und Zielsetzungen der bundesdeutschen Drogenpolitik, wichtige betäubungsmittelrechtliche Vorschriften und präventive Strategien. Es analysiert die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, die die aktuelle Drogenpolitik geprägt haben, sowie deren Auswirkungen auf die Situation der Drogenkonsumenten. Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen ist essentiell für das Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten der kontrollierten Heroinvergabe.
Die Situation der Heroinkonsumenten in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Verbreitung des Heroinkonsums in Deutschland und die Folgen der Prohibition auf die Konsumformen, Ausstiegsprozesse und die gesundheitliche sowie soziale Lage der Betroffenen. Es beleuchtet die dramatischen Auswirkungen der illegalen Beschaffung und des Konsums von Heroin, einschließlich der hohen Infektionsraten von HIV und Hepatitis sowie der sozialen Ausgrenzung und der hohen Sterberate. Die detaillierte Darstellung der Situation der Konsumenten dient als Argumentationsgrundlage für die Notwendigkeit alternativer Strategien.
Einordnung der kontrollierten Heroinvergabe in das bestehende Drogenhilfesystem: Dieses Kapitel betrachtet die historische Entwicklung des Drogenhilfesystems in Deutschland, die Grundlagen und Zielsetzungen akzeptanzorientierter Drogenhilfe und deren praktische Ausrichtung. Es analysiert die Spannungsfelder zwischen normativen Ansprüchen und faktischen Bedingungen, wie der Medizinalisierung und den kulturellen Mythen rund um Drogenkonsum. Das Kapitel positioniert die kontrollierte Heroinvergabe im Kontext der bestehenden Drogenhilfe und ihrer Entwicklung.
Wege zu einer „Normalisierung“: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Wege zur Normalisierung des Umgangs mit Drogen, unter besonderer Berücksichtigung der gesellschaftlichen und politischen Implikationen. Es analysiert mögliche Strategien und deren Chancen sowie Risiken, um einen informierten Diskurs über alternative Ansätze zur Drogenpolitik zu ermöglichen. Die „Normalisierung“ wird hier als ein Prozess verstanden, der den gesellschaftlichen Umgang mit Drogen und Sucht verändert und stigmatisierende Vorstellungen abbaut.
Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung der Drogenpolitik: Dieses Kapitel diskutiert die verschiedenen Modelle der Drogenpolitik, darunter die Total- und Partiallegalisierung, und beleuchtet deren Vor- und Nachteile. Es konzentriert sich insbesondere auf die staatlich kontrollierte Partiallegalisierung und das Medizinalisierungsmodell. Die Diskussion der unterschiedlichen Modelle ist zentral für das Verständnis der komplexen Abwägungen, die bei der Entwicklung einer effektiven Drogenpolitik zu berücksichtigen sind.
Projekt zur Verschreibung von Betäubungsmitteln (PROVE) in der Schweiz: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Schweizer Projekt PROVE, einschließlich seiner Entstehung, Rechtsgrundlage, Zielsetzung, Methodik und Ergebnisse. Es beleuchtet die Erfahrungen mit der kontrollierten Heroinvergabe in der Schweiz und dient als Vergleichsmaßstab für das deutsche Modellprojekt. Die detaillierte Darstellung des Schweizer Projekts ermöglicht eine fundierte Bewertung der Übertragbarkeit des Modells auf den deutschen Kontext.
Das bundesdeutsche Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger: Dieses Kapitel beschreibt das deutsche Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung, seine Entstehung, Rahmenbedingungen, Durchführung und die psychosoziale Begleitung. Es beleuchtet die Methodik der Studie und die Ergebnisse, sowie die Herausforderungen bei der Umsetzung im Vergleich zum Schweizer Modell. Die detaillierte Darstellung des deutschen Modellprojektes bildet den Kern der Arbeit.
Kritische Betrachtung des bundesdeutschen Modellprojekts zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Modellprojekt, indem es konzeptionelle Unterschiede zum Schweizer Modell, die psychosoziale Begleitung und die Frage nach einer möglichen Normalisierung des Heroinkonsums diskutiert. Es analysiert Stärken und Schwächen des Projekts und zieht Schlüsse aus den Erfahrungen. Die kritische Betrachtung ist wichtig für die Bewertung der langfristigen Auswirkungen des Projekts und der Entwicklung zukünftiger Strategien.
Schlüsselwörter
Kontrollierte Heroinvergabe, Drogenpolitik, Drogenhilfe, Sucht, Abhängigkeit, Prohibition, Schadensminimierung, Modellprojekt, Schweiz, Deutschland, Akzeptanzorientierte Drogenhilfe, Medizinalisierung, Prävention, Repression, Substitutionstherapie, Methadon, Heroin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kontrollierte Heroinvergabe in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die kontrollierte Heroinvergabe in Deutschland. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes im Kontext der bestehenden Drogenpolitik und -hilfe und berücksichtigt verschiedene wissenschaftliche Theorien der Suchtentstehung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. folgende Themen: kontrollierte Heroinvergabe als Alternative zur Prohibition, Analyse der deutschen und schweizerischen Modellprojekte (PROVE und das bundesdeutsche Modellprojekt), Bewertung der Effektivität verschiedener Drogenhilfemodelle, die Rolle der Drogenpolitik in der Entstehung sozialer und gesundheitlicher Probleme, Herausforderungen der Akzeptanzorientierten Drogenhilfe, wissenschaftliche Theorien zur Suchtentstehung (psychoanalytisch, medizinisch-psychiatrisch, lerntheoretisch, Karriere-Modell), die Situation von Heroinkonsumenten in Deutschland, die historische Entwicklung des deutschen Drogenhilfesystems und verschiedene Modelle der Drogenpolitik (Total- und Partiallegalisierung).
Welche wissenschaftlichen Theorien werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene wissenschaftliche Theorien der Suchtentstehung, darunter den psychoanalytischen, medizinisch-psychiatrischen und lerntheoretischen Ansatz sowie das "Karriere-Modell".
Wie wird die Situation der Heroinkonsumenten in Deutschland dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Verbreitung des Heroinkonsums in Deutschland und die Folgen der Prohibition auf die Konsumformen, Ausstiegsprozesse und die gesundheitliche sowie soziale Lage der Betroffenen. Es werden die dramatischen Auswirkungen der illegalen Beschaffung und des Konsums von Heroin beleuchtet, einschließlich der hohen Infektionsraten von HIV und Hepatitis sowie der sozialen Ausgrenzung und der hohen Sterberate.
Welche Rolle spielt die Drogenpolitik?
Die Arbeit analysiert die Maßnahmen und Zielsetzungen der bundesdeutschen Drogenpolitik, wichtige betäubungsmittelrechtliche Vorschriften und präventive Strategien. Sie analysiert die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, die die aktuelle Drogenpolitik geprägt haben, sowie deren Auswirkungen auf die Situation der Drogenkonsumenten.
Wie wird die kontrollierte Heroinvergabe im bestehenden Drogenhilfesystem eingeordnet?
Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung des Drogenhilfesystems in Deutschland, die Grundlagen und Zielsetzungen akzeptanzorientierter Drogenhilfe und deren praktische Ausrichtung. Sie analysiert die Spannungsfelder zwischen normativen Ansprüchen und faktischen Bedingungen, wie der Medizinalisierung und den kulturellen Mythen rund um Drogenkonsum.
Welche Modelle der Drogenpolitik werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Modelle der Drogenpolitik, darunter die Total- und Partiallegalisierung, und beleuchtet deren Vor- und Nachteile. Es konzentriert sich insbesondere auf die staatlich kontrollierte Partiallegalisierung und das Medizinalisierungsmodell.
Welche Modellprojekte werden im Detail beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert das Schweizer Projekt PROVE und das bundesdeutsche Modellprojekt zur heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger, einschließlich ihrer Entstehung, Rechtsgrundlage, Zielsetzung, Methodik und Ergebnisse. Ein Vergleich beider Projekte wird durchgeführt.
Wie wird das Schweizer Projekt PROVE bewertet?
Das Schweizer Projekt PROVE wird detailliert dargestellt und dient als Vergleichsmaßstab für das deutsche Modellprojekt. Die Erfahrungen mit der kontrollierten Heroinvergabe in der Schweiz werden beleuchtet.
Wie wird das deutsche Modellprojekt kritisch betrachtet?
Die Arbeit bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Modellprojekt, indem es konzeptionelle Unterschiede zum Schweizer Modell, die psychosoziale Begleitung und die Frage nach einer möglichen Normalisierung des Heroinkonsums diskutiert. Es analysiert Stärken und Schwächen des Projekts und zieht Schlüsse aus den Erfahrungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kontrollierte Heroinvergabe, Drogenpolitik, Drogenhilfe, Sucht, Abhängigkeit, Prohibition, Schadensminimierung, Modellprojekt, Schweiz, Deutschland, Akzeptanzorientierte Drogenhilfe, Medizinalisierung, Prävention, Repression, Substitutionstherapie, Methadon, Heroin.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2003, Zwischen Legalisierung und Prohibition: Kontrollierte Heroinvergabe in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23222