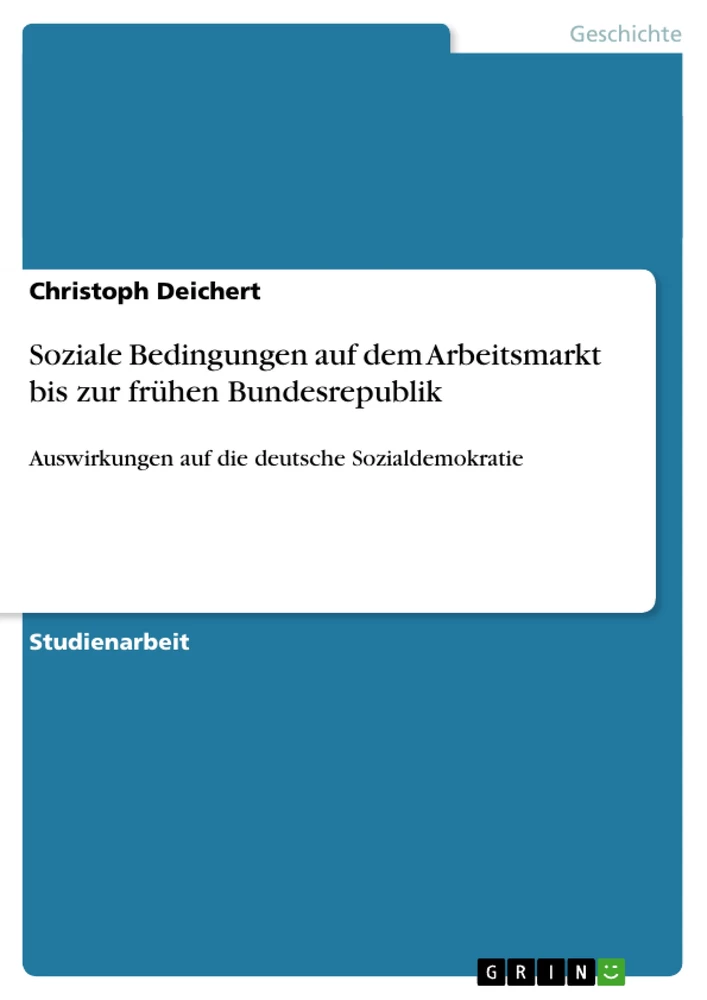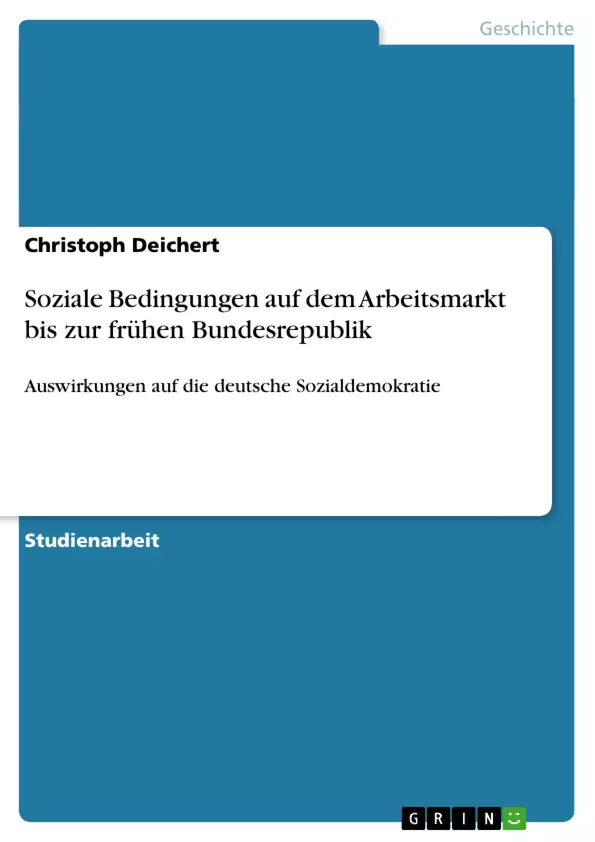Die Periodisierung der "Industriellen Revolution" oder der Industrialisierung gestaltet sich, wie bei vielen Entwicklungsprozessen, schwierig. "Das Manifest der Kommunistischen Partei" zeigt 1848, dass sich eine neue politische Philosophie entwickeln konnte. Dieses Manifest beginnt mit einer Kritik an den Herrschenden, aber auch an der Gesellschaftsordnung, an den Gesellschaften nach den napoleonischen Kriegen, durch die ausdrückliche Erwähnung Metternichs, dem Architekten der Nachkriegsordnung. Dieses Manifest ist gerade mit Blick auf die SPD von Bedeutung, da es keinerlei Verfizierung zwischen Kommunisten und Sozialisten, Anarchisten und "Social-Demokraten" gab. Was auf die damals gemeinsame Ideologie zurückzuführen ist.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
I.1 Forschungsstand
I.2 Fragestellung
I.3 Methode
I.4 Literaturdiskussion
II. Basis der Industriearbeit und Entstehung der SPD
II.1 Schlussfolgerungen
III. Entwicklung industrieller Arbeit und der SPD im Kaiserreich
III.1 Schlussfolgerungen
IV. Entwicklung in der Weimarer Republik
IV.1 Schlussfolgerungen
V. „Wirtschaftswunder“ und „Godesberger Programm“
V.1 Schlussfolgerung
VI. Fazit
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Die Periodisierung der „Industriellen Revolution“ oder der Industrialisierung gestaltet sich, wie bei vielen Entwicklungsprozessen, schwierig. „In der deutschen wirtschaftshistorischen Forschung war man deshalb eher geneigt, den Beginn der Industrialisierung Deutschlands mit folgenden Entwicklungen zu verknüpfen: 1. der Gründung des deutschen Zollvereins 1834; 2. der Fertigstellung der ersten Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Führt 1835; 3. dem konjunkturellen Aufschwung Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts oder 4. dem „Take-off“ nach 1850.“1
„Das Manifest der Kommunistischen Partei“ zeigt 1848, dass sich eine neue politische Philosophie entwickeln konnte. Dieses Manifest beginnt mit einer Kritik an den bisher Herrschenden, aber auch einer Kritik an der Gesellschaftsordnung, an den Gesellschaften nach den napoleonischen Kriegen, durch die ausdrückliche Erwähnung Metternichs, dem Architekten der Nachkriegsordnung.2
Desweiteren gehen Marx und Engels von einer Polarisierung der Gesellschaft in Bourgeois und Proletarier aus, die darüber hinaus sich feindlich gegenüber stehen. Zur Bourgeoisie werden die Industriellen gezählt, die durch die Industrialisierung ihr Kapital vermehren konnten.3
„Der Proletarier ist eigentumslos; sein Verhältnis zu Weib und Kindern hat nichts mehr gemein mit dem bürgerlichen Familienverhältnis; die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital …“4
Dieses Manifest ist gerade mit Blick auf die SPD von Bedeutung, da es keinerlei Verifizierung zwischen Kommunisten und Sozialisten, Anarchisten und „Social- Demokraten“ gab. Was auf die damals gemeinsame Ideologie zurückzuführen ist.5
I.1 Forschungsstand
Heinrich Potthoff und Susanne Miller haben über die Geschichte der SPD geforscht von ihrer Gründung bis zur jüngeren Vergangenheit.6 Desweiteren hat Friedrich-Wilhelm Henning unter anderem über die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen von 1914 bis 1992 geforscht und faktenreich zusammengetragen.7 Die beiden Themen wurde nur in der Forschung zur „industriellen Revolution“ mit einander verknüpft, so zum Beispiel von Hubert Kiesewetter, da die Entstehung der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung als ein Randphänomen betrachtet wird.8 Über eine Einzelbetrachtung der sozialen Umstände und der SPD und als Randphänomen der „industriellen Revolution“, gibt es keinen nennenswerten Literaturstand.
I.2 Fragestellung
In welchem Kontext stehen der Arbeitsmarkt im Bereich der Industrie und Veränderungen innerhalb der Sozialdemokratie? Je mehr sich die sozialen Bedingungen am Arbeitsmarkt verändert haben, desto mehr musste sich die Sozialdemokratie anpassen.
I.3 Methode
Diese strukturgeschichtliche Arbeit, beginnt mit der menschlichen Basis der Industriearbeit und das Entstehen der SPD. Danach wird auf die Entwicklung industrieller Arbeit am Arbeitsmarkt während des I. Weltkriegs exemplarisch und der SPD im deutschen Kaiserreich eingegangen. Im Anschluss wird die Rolle des Arbeitsmarktes und die Politik der SPD in der Weimarer Republik kurz dargelegt. Vor dem abschließenden Fazit wird auf die Rolle der sozialen Entwicklung am Arbeitsmarkt während des „Wirtschaftswunders“ eingegangen, sowie auf das „Godesberger Programm“. Die NS-Zeit wird nicht beachtet, da die SPD in dieser Zeit nicht politisch aktiv war. Wobei das Ziel dieser Hausarbeit ist, einen Zusammenhang zwischen sozialen Bedingungen in dem Bereich der industriellen Arbeit am Beispiel des Arbeitsmarktes und der deutschen Sozialdemokratie anhand von ausgewählten Beispielen, darzustellen.
I.4 Literaturdiskussion
Diese Arbeit basiert hauptsächlich auf den Büchern die „Kleine Geschichte der SPD“ und „das industrialisierte Deutschland von 1914 bis 1992“, deshalb wird nur für diese eine explizite Literaturdiskussion angestellt.
Zunächst über die „Kleine Geschichte der SPD“, von Heinrich Potthoff und Susanne Miller. Heinrich Potthoff bezeichnet im Vorwort das Werk als kritisch korrigiert, allerdings bedankt er sich auch für die Mitwirkung der SPD-nahen Friedrich-Ebert- Stiftung.9 Nicht nur durch diese Unterstützung muss die kritische Distanz der Autoren zur Sozialdemokratie hinterfragt werden, sondern auch durch Formulierung wie exemplarisch auf Seite 126, in der es heißt: „…, bewusst den Bruch mit den Sozialdemokraten herbeiführte, um die eigenen finanz- und sozialpolitischen Vorstellungen zu verwirklichen, …“.10 In diesem speziellen Punkt könnte man auch zu der Erkenntnis gelangen DVP und Zentrum wollte ihrer eigenen Wählerschaft gerecht werden.
Der Autor der zweiten zu Grunde liegenden Literatur, Friedrich-Wilhelm Henning, veröffentliche drei Bände „Wirtschafts- und Sozialgeschichte“, Band 1 beginnt im 8. Jahrhundert und Band 3 endet im Jahr 1992. Im Vorwort setzt sich Henning ein Ziel, eine übersichtliche Darstellung von Fakten, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung darzustellen.11 Dieses Ziel hat der Autor auch erreicht, allerdings kommen die Bedingungen in einzelnen Betrieben oder für das Individuum nicht zum Tragen und somit können keine Unterschiede festgestellt werden.
II. Basis der Industriearbeit und Entstehung der SPD
Die Bevölkerung nahm in ihrer Dichte in den Industriestädten zu, zum einen durch Zuwanderung aus den agrarisch geprägten Regionen, zum anderen durch eine Zunahme der Geburtenrate.12
Solange die Anziehungskraft großer Städte in ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht anhielt, kam es zu Land-Stadt-Wanderungen. Die Verdienstmöglichkeiten für Handwerksgesellen und Landarbeiter waren in der Stadt gut. Junge Mädchen konnten sich in den Haushalten der gehobenen Schichten betätigen. Die Schattenseiten in einer Industriestadt waren kleine und teure Wohnungen, lange Wege zur Arbeitsstelle. Ohne diese Wanderung wäre die Arbeiterklasse wohl nicht entstanden.13
Ein weiteres Phänomen über die Land-Stadt-Wanderung hinaus, stellt die Kinderarbeit dar. Kinder konnten ohne Rücksicht auf deren Gesundheit massenhaft in Fabriken eingesetzt werden. Darüber hinaus war in den Produktionsstätten kein Grundwissen mehr erforderlich. Desweiteren war zum Bedienen der Maschinen keine oder kaum Muskelkraft nötig.14
Aus diesen und anderen Gründen, legte Lasalle in einem Schreiben am 1. März 1863 seine Ansichten für die Verbesserung der Arbeiter im sozialen und politischen Bereich, dar. Dieser Aufruf zur Gründung einer Arbeiterpartei kam an. Am 23. Mai 1863 wurde der „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ durch Delegierte aus 11 Orten gegründet. Ferdinand Lasalle wurde zum Präsidenten dieses Vereins gewählt.15
Die wesentlichen Programmpunkte dieser ca. 4600 Mitglieder zählenden Arbeiterpartei waren ein allgemeines und freies Wahlrecht aber auch Begriffe wie Ausbeutung und „Klassenkampf“ erhielten einen festen Platz.16
In Eisenach wurde im ersten Drittel des Augusts 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Somit entstand neben dem ADAV eine weitere deutsche Arbeiterpartei. Ihre Mitglieder stammten größtenteils aus Süd- und Mitteldeutschland. Teile aus der Mitgliedschaft waren unzufriedene ehemalige ADAV Mitglieder.17
Das Programm enthielt viele konkrete Punkte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diese waren gesetzliche Höchstarbeitszeit und Einschränkung der Frauen- und ein Verbot der Kinderarbeit. Zu den abstrakteren Forderungen zählte unter anderem ein allgemeines, gleiches und direktes Wahlrecht.18
Nach der Reichsgründung setzte eine staatliche Repressionspolitik ein, besonders Staatsanwalt Tessendorf eiferte in diesem Bereich. Die 1873 einsetzende Rezession, brachte in beiden Parteien das Augenmerk auf die dringendsten Probleme der Arbeiterschaft. Diese Probleme waren unter anderen Wohnungsnot und Streikkämpfe. Gerade einfache Mitglieder aus beiden Parteien drängten deshalb auf eine Verschmelzung beider Parteien. Vom 23. -27. Mai 1875 fand in Gotha ein Einigungsparteitag statt. Am Ende dieses Parteitags gab es die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit einem einheitlichen Programm.19
II.1 Schlussfolgerungen
Ein rekrutieren der Arbeiterschaft durch Land-Stadt-Wanderungen erscheint, gerade unter Berücksichtigung der Entwicklung der Städte im Mittelalter, wo ebenfalls eine Wanderung zu Zentren einsetzte, nicht verwunderlich.20
Allerdings das Phänomen der Kinderarbeit verwundert ein wenig, denn immerhin bestand allgemeine Schulpflicht und dies wirft die Frage nach dem behördlichen durchsetzen derselben auf. Allerdings spielten bei der Abnahme der Kinderarbeit weniger humanitär-philanthropische Gesichtspunkte eine Rolle, sondern die Befürchtung einer Beeinträchtigung der Militärtauglichkeit.21 Dieses recht konkrete Beispiel wurde aufgegriffen, um aufzuzeigen, dass die SAP-Forderung sehr nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen war.
Desweiteren erscheint der Zusammenschluss beider Parteien der „Arbeiterklasse“ zu einer gemeinsamen Partei nicht überraschend. Gerade wenn man berücksichtigt, dass beide Parteien auf abstrakter Ebene einen demokratischen legitimierten Staatsaufbau erreichen wollten. Die Ziele gegen Ausbeutung und der Begriff „Klassenkampf“ können auch heute als Abstraktion der konkreten Anliegen der SAP für die Arbeiterschaft gesehen werden. Aber gerade unter der Berücksichtigung der territorialen Einheit Deutschlands und den gemeinsamen Zielen, ist doch ein wenig befremdlich, dass beide Parteien durch die einfache Mitgliedschaft zur Verschmelzung gedrängt wurden. Dies wirft durchaus einige Fragen auf, deren Beantwortung über den thematischen Rahmen dieser Hausarbeit hinausführen würde. Hatten die Führungen beider Parteien nicht ein ebenso hohes Interesse wie ihre Mitglieder an einer Verschmelzung? Wollte man sich bei der Darstellung der Parteieinheit bewusst von Staatseinheit abgrenzen? Erkannten die Funktionäre es nicht als Chance, erstarkt gegen die sozialen Probleme vorzugehen?
III. Entwicklung industrieller Arbeit und der SPD im Kaiserreich
Die wichtigsten Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt zur Zeit des I.
[...]
1 Kiesewetter, Hubert: Industrielle Revolution in Deutschland. Regionen als Wachstumsmotoren, Wiesbaden 2004, S. 19.
2 Vgl.: Fetscher, Ingrid (Hg.): Manifest der Kommunistischen Partei. Grundsätze des Kommunismus, Stuttgart 2004, S. 19.
3 Vgl.: Manifest der Kommunistischen Partei, 2004, S. 19 - 21.
4 Manifest der Kommunistischen Partei, 2004, S. 31.
5 Vgl.: Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 3. Band, München 1995, S. 902.
6 Vgl.: Potthoff Heinrich und Miller, Susanne: Kleine Geschichte der SPD. 1848 - 2002, Bonn 2002.
7 Vgl.: Henning, Friedrich-Wilhelm: Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Das industrialisierte Deutschland 1914 - 1992, Band 3, Paderborn 1993.
8 Vgl.: Industrielle Revolution in Deutschland. Regionen als Wachstumsmotoren, Wiesbaden 2004.
9 Vgl.: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 5.
10 Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 126.
11 Vgl.: Das industrialisierte Deutschland 1914 - 1992, 1993, S. 10.
12 Vgl.: Industrielle Revolution in Deutschland, 2004, S. 127.
13 Vgl.: Industrielle Revolution in Deutschland, 2004, S. 133.
14 Vgl.: Dittmann, Linda: Kinderarbeit im 19. Jahrhundert. Norderstedt 2005, S. 5
15 Vgl.:: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 33.
16 Vgl.: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 33 -34.
17 Vgl.: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 40.
18 Vgl.: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 40.
19 Vgl.: Kleine Geschichte der SPD, 2002, S. 42.
20 Vgl.: Engel, Evamaria: Die deutsche Stadt im Mittelalter. München 1993, S. 20
21 Vgl.: Schulz, Günther: Schulpflicht, Kinderschutz, technischer Fortschritt und öffentliche Meinung. Die Beschäftigung von Kindern in Fabriken und die Ursache ihres Rückgangs, in: Schulz, Günther(Hg.):Von der Landwirtschaft zur Industrie (Wirtschaftlicher und Gesellschaftlicher Wandel im 19. Und 20. Jahrhundert), Paderborn 1996, S. 76.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen die industrielle Revolution und die Entstehung der SPD zusammen?
Die Industrialisierung schuf die Arbeiterklasse (Proletariat), deren soziale Notlage zur Gründung von Arbeiterparteien wie dem ADAV und der SAP (später SPD) führte.
Was war der "Allgemeine Deutsche Arbeiterverein" (ADAV)?
Der 1863 von Ferdinand Lassalle gegründete Verein war die erste Vorläuferorganisation der SPD und forderte das allgemeine Wahlrecht und soziale Verbesserungen.
Warum war Kinderarbeit ein zentrales Thema der frühen Sozialdemokratie?
Kinder wurden in Fabriken massiv ausgenutzt. Die Arbeiterbewegung forderte ein Verbot, wobei staatliche Einschränkungen oft eher aus Sorge um die spätere Militärtauglichkeit erfolgten.
Was passierte beim Gothaer Einigungsparteitag 1875?
Die beiden großen Strömungen der Arbeiterbewegung verschmolzen zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), um ihre politischen Kräfte zu bündeln.
Welche Rolle spielte die Land-Stadt-Wanderung?
Die Wanderung aus agrarischen Gebieten in die Industriestädte war die Voraussetzung für die Entstehung der urbanen Arbeiterklasse und der späteren Gewerkschaftsstrukturen.
Was ist das "Godesberger Programm"?
Ein 1959 verabschiedetes Grundsatzprogramm, mit dem sich die SPD von einer Klassenpartei zu einer Volkspartei wandelte und sich zur Marktwirtschaft bekannte.
- Citar trabajo
- Christoph Deichert (Autor), 2012, Soziale Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bis zur frühen Bundesrepublik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232230