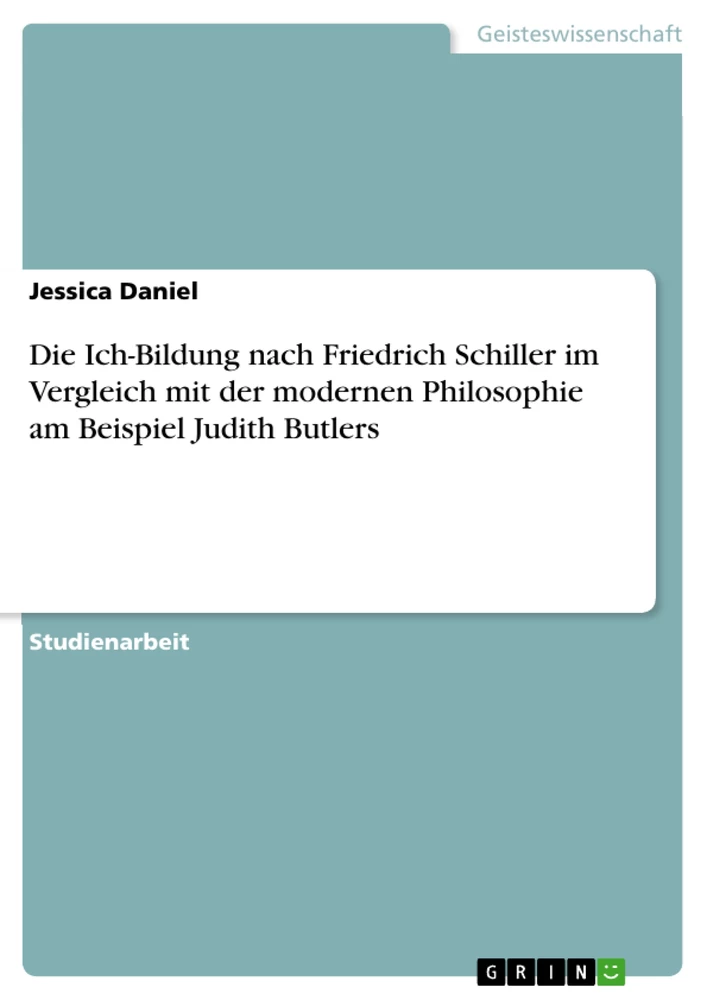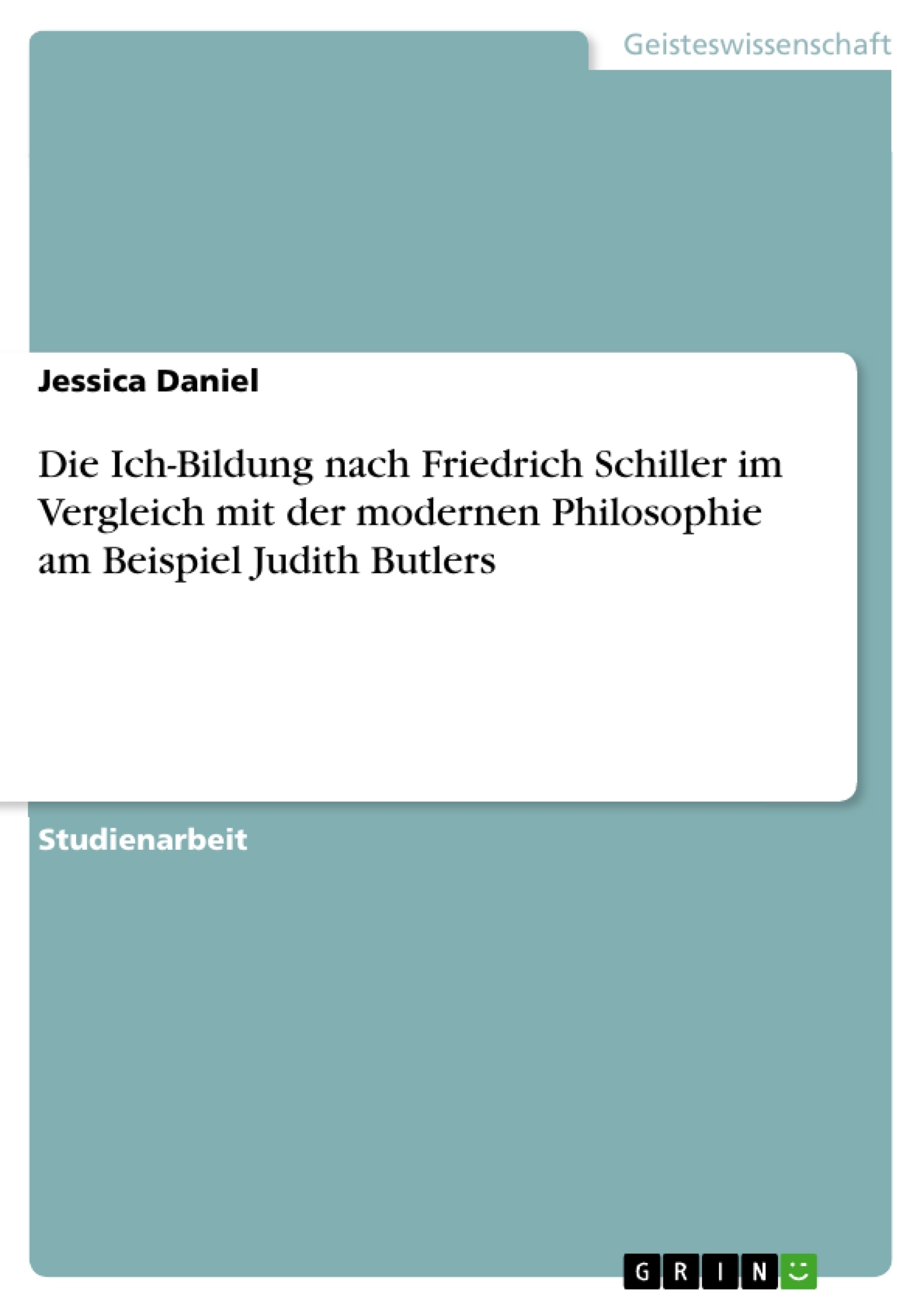Verfasst in einem Seminar über Friedrich von Schiller. Eine Modulabschlussarbeit, in der hinterfragt wird, wie die Bildung des Charakters, des "Ichs" nach Schiller von statten geht.
Verglichen wird seine Theorie mit der einer modernen Philosophin, Judith Butler.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Form-, Stoff- und Spieltrieb bei Schiller
- 2.1 Der Stofftrieb
- 2.2 Der Formtrieb
- 2.3 Der Spieltrieb
- 3. Das Ich und das Verhältnis zu einem Du nach Judith Butler
- 4. Vergleich von Friedrich Schillers und Judith Butlers Theorie der Ich-Bildung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Friedrich Schillers anthropologische Theorie, wie sie in seinen "Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen" dargelegt wird, darzustellen und mit der Theorie der Ich-Bildung von Judith Butler zu vergleichen. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Konzepte des Individuums und dessen Entstehung, sowie auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Theorien.
- Schillers Konzept des Form- und Stofftriebes
- Das Verhältnis von Empfindung und Vernunft bei Schiller
- Butlers Theorie der Ich-Bildung
- Vergleich der anthropologischen Ansätze von Schiller und Butler
- Die Bedeutung der ästhetischen Erziehung für die Ich-Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Sie beschreibt Schillers Werk "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" und seine Entstehung im Kontext der Französischen Revolution, sowie die Relevanz der pädagogischen Anthropologie Schillers. Es wird der Vergleich mit der Philosophie Judith Butlers angekündigt und die verwendeten Quellen genannt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Konzepte des Individuums und dessen Entstehung bei beiden Denkern.
2. Form-, Stoff- und Spieltrieb bei Schiller: Dieses Kapitel erläutert Schillers anthropologisches Prinzip, welches auf der Interaktion von Form- und Stofftrieb basiert. Der Stofftrieb repräsentiert die sinnliche, empfindungsgeleitete Seite des Menschen, während der Formtrieb die Vernunft, die Moral und das Streben nach Wahrheit verkörpert. Schiller beschreibt den "Wilden", der nur dem Stofftrieb folgt, und den "Barbar", der nur vom Formtrieb geleitet wird. Die ausgewogene Entwicklung beider Triebe ist zentral für Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung. Es wird der Einfluss Kants auf Schillers Denken diskutiert, aber auch die Abgrenzung von Kants rein vernunftorientiertem Ansatz herausgearbeitet. Die Bedeutung des Spieltriebs als verbindendes Element zwischen Form- und Stofftrieb wird angedeutet, jedoch nicht detailliert ausgeführt, da der Fokus auf Form- und Stofftrieb liegt.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, ästhetische Erziehung, Ich-Bildung, Formtrieb, Stofftrieb, Judith Butler, Anthropologie, Vernunft, Empfindung, pädagogische Anthropologie, Moral, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der anthropologischen Theorien Schillers und Butlers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit vergleicht die anthropologischen Theorien von Friedrich Schiller (insbesondere seine "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen") und Judith Butler. Der Fokus liegt auf den Konzepten des Individuums und dessen Entstehung, sowie auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Ansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Schillers Konzept des Form- und Stofftriebs, das Verhältnis von Empfindung und Vernunft bei Schiller, Butlers Theorie der Ich-Bildung, einen Vergleich der anthropologischen Ansätze beider Denker und die Bedeutung der ästhetischen Erziehung für die Ich-Bildung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Schillers Form-, Stoff- und Spieltrieb, ein Kapitel zu Butlers Theorie der Ich-Bildung, ein Kapitel zum Vergleich beider Theorien und ein Fazit. Es werden außerdem Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel bereitgestellt.
Was ist Schillers anthropologisches Prinzip?
Schillers anthropologisches Prinzip basiert auf der Interaktion von Form- und Stofftrieb. Der Stofftrieb repräsentiert die sinnliche, empfindungsgeleitete Seite des Menschen, während der Formtrieb die Vernunft, Moral und das Streben nach Wahrheit verkörpert. Ein ausgewogenes Verhältnis beider Triebe ist zentral für Schillers Theorie der ästhetischen Erziehung.
Welche Rolle spielt der Spieltrieb bei Schiller?
Der Spieltrieb wird als verbindendes Element zwischen Form- und Stofftrieb angedeutet, wird aber in dieser Arbeit nicht detailliert ausgeführt, da der Fokus auf Form- und Stofftrieb liegt.
Was ist Butlers Theorie der Ich-Bildung?
Die Arbeit beschreibt Butlers Theorie der Ich-Bildung, jedoch ohne detaillierte Ausführungen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit Schillers Theorie.
Wie werden Schiller und Butler verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte des Individuums und dessen Entstehung bei Schiller und Butler, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer anthropologischen Ansätze herauszuarbeiten.
Welche Bedeutung hat die ästhetische Erziehung bei Schiller?
Die ästhetische Erziehung ist zentral für Schillers Theorie der Ich-Bildung, da sie ein ausgewogenes Verhältnis von Form- und Stofftrieb fördert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, ästhetische Erziehung, Ich-Bildung, Formtrieb, Stofftrieb, Judith Butler, Anthropologie, Vernunft, Empfindung, pädagogische Anthropologie, Moral, Identität.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit nennt die verwendeten Quellen, die für weiterführende Informationen konsultiert werden können.
- Arbeit zitieren
- Jessica Daniel (Autor:in), 2012, Die Ich-Bildung nach Friedrich Schiller im Vergleich mit der modernen Philosophie am Beispiel Judith Butlers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232232