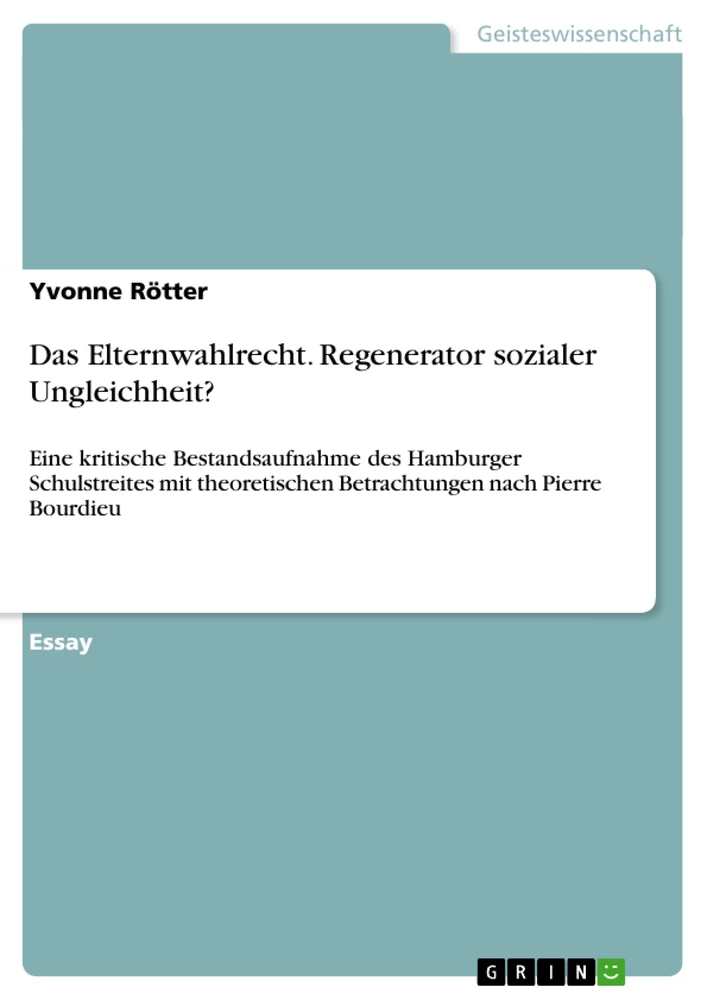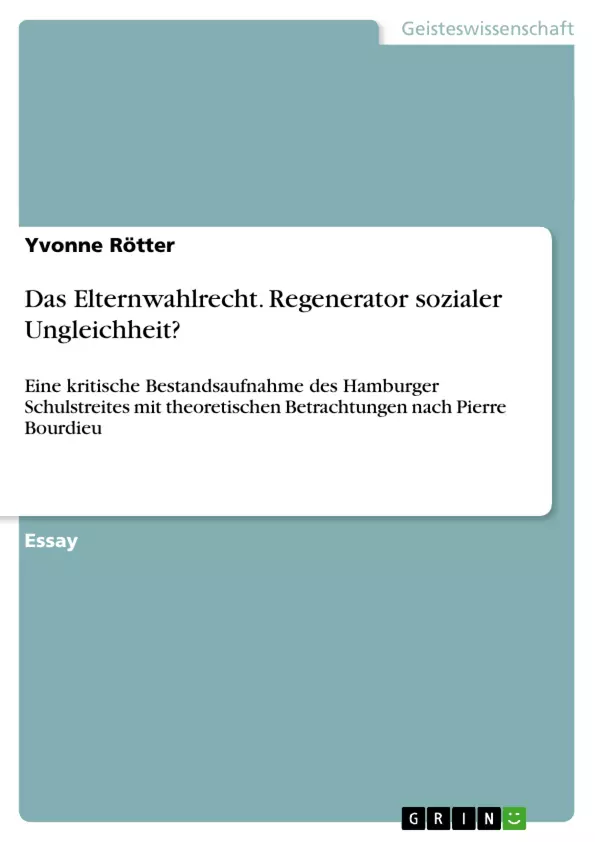Am 18. Juli 2010 wird in Hamburg gewählt. An jenem Sonntag bekommt das Volk die Möglichkeit über die Schulpolitik Hamburgs abzustimmen. Erstmals stehen seit der Gründung der Bundesrepublik in einem Volksentscheid die Parteien unterschiedlicher Couleur geschlossen einem Großteil der Hamburger Landesbürger gegenüber. Grund dafür ist die von der Hamburger Bürgerschaft unter Führung der CDU und der Grünen Alternativen Liste (GAL) beschlossene Änderung des Hamburger Schulgesetzes, die anstelle der vierjährigen Grundschule die Einführung einer sechsjährigen Primarschule vorsieht. Ursprünglich sollte mit der Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre auch das Elternwahlrecht, also das Recht der Eltern über die Wahl der weiterführenden Schulform ihres Kindes, weitestgehend eingeschränkt werden. Hier kam es jedoch zu einem erbitterten Widerstand der Elternschaft in Form eines Volksbegehrens, sodass die Bürgerschaft sich darauf einigte, das Elternwahlrecht auf die sechste Klasse zu verschieben. Allerdings ist sowohl die Primarschule als auch die damit einhergehende Verschiebung des Elternwahlrechtes bei Hamburger Eltern stark umstritten. Auf diese Weise formierte sich die Elterninitiative „Wir wollen Lernen“, die für ein Elternwahlrecht ab Klasse vier sowie für die Beibehaltung weiterführender Schulen ab der fünften Klasse plädiert. Sie schaffte es, die für einen Volksentscheid benötigten 180.000 Stimmen einzusammeln und so einen Volksentscheid zu erwirken. Darum wird am 18. Juli 2010 in Hamburg gewählt.
„Je freier die Elternwahl, desto größer die soziale Ungleichheit.“
(Zitat: Klaus Klemm 2010, Schulforscher).[1]
Am 18. Juli 2010 wird in Hamburg gewählt. An jenem Sonntag bekommt das Volk die Möglichkeit über die Schulpolitik Hamburgs abzustimmen. Erstmals stehen seit der Gründung der Bundesrepublik in einem Volksentscheid die Parteien unterschiedlicher Couleur geschlossen einem Großteil der Hamburger Landesbürger gegenüber. Grund dafür ist die von der Hamburger Bürgerschaft unter Führung der CDU und der Grünen Alternativen Liste (GAL) beschlossene Änderung des Hamburger Schulgesetzes, die anstelle der vierjährigen Grundschule die Einführung einer sechsjährigen Primarschule vorsieht.[2] Ursprünglich sollte mit der Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre auch das Elternwahlrecht, also das Recht der Eltern über die Wahl der weiterführenden Schulform ihres Kindes, weitestgehend eingeschränkt werden.[3] Hier kam es jedoch zu einem erbitterten Widerstand der Elternschaft in Form eines Volksbegehrens, sodass die Bürgerschaft sich darauf einigte, das Elternwahlrecht auf die sechste Klasse zu verschieben.[4] Allerdings ist sowohl die Primarschule als auch die damit einhergehende Verschiebung des Elternwahlrechtes bei Hamburger Eltern stark umstritten. Auf diese Weise formierte sich die Elterninitiative „Wir wollen Lernen“, die für ein Elternwahlrecht ab Klasse vier sowie für die Beibehaltung weiterführender Schulen ab der fünften Klasse plädiert.[5] Sie schaffte es, die für einen Volksentscheid benötigten 180.000 Stimmen einzusammeln und so einen Volksentscheid zu erwirken. Darum wird am 18. Juli 2010 in Hamburg gewählt.
Warum aber stellen sich so viele Eltern vehement gegen die Abschaffung des Elternwahlrechtes? Welchen Beitrag leistet zudem das Elternwahlrecht zur Regenerierung sozialer Ungleichheit?[6] Diese Fragen sollen im Folgenden aus soziologischer Perspektive, mit Hilfe der Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, betrachtet werden. Als These dient dabei das Zitat des Schulforschers Klaus Klemm, welches besagt, dass ein freieres Elternwahlrecht zu größerer sozialer Ungleichheit beitrage.
Die Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 2000 zur Überprüfung der Leistungen von Schülern aus aller Welt haben gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und schulischer Leistung besteht. So ergibt sich aus der Schulleistungsstudie z.B. ein direkter Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz von Schülern und ihrem sozioökonomischem Hintergrund. Dabei wurde vor allem der wirtschaftliche, soziale und kulturelle Status der Eltern in Verbindung mit den Schulleistungen der Schüler gesetzt. Schüler aus privilegierteren sozialen Schichten schnitten tendenziell besser ab als solche aus sozial schwächeren Familien. Soziologisch betrachtet liegt die Ursache für das bessere Abschneiden der Schüler aus den oberen sozialen Schichten darin begründet, dass deren Eltern über ein Mehr an Kapital[7] verfügen, von dem die Kinder entsprechend profitieren können.[8] Je größer das ökonomische Kapital der Eltern ist, desto größer ist in der Regel auch das soziale Kapital, d.h. das Netzwerk an sozialen Beziehungen, von dem ein Kind wiederum profitieren kann. So knüpft beispielsweise ein Kind einer großbürgerlichen Familie aus Blankenese andere soziale Beziehungen als ein Kind, das in einem sozial benachteiligten Elternhaus aus Billstedt sein soziales Umfeld hat. Außerdem haben Eltern mit einem großen ökonomischen Kapital mehr Möglichkeiten ihre Kinder mittels Nachhilfe oder der Finanzierung hochwertiger Lehrmaterialien beim Aufbau von kulturellem Kapital in Form von schulischem Wissen zu unterstützen. Dieses Beispiel verdeutlicht die Rolle des (ökonomischen) Kapitals der Eltern für die schulischen Leistungen des Kindes.
In Bezug auf das Elternwahlrecht hat die sozioökonomische Stellung der Eltern ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss. Eltern aus den gehobenen sozialen Schichten neigen sogar dazu, ihre Kinder trotz schlechter schulischer Leistungen auf ein Gymnasium zu schicken.[9] Durch ihre hohe Ausstattung mit ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital sind allerdings die Chancen, dass das Kind diese Herausforderung dennoch schafft, größer als z.B. für ein Kind aus der sozialen Mittel- oder Unterschicht. Des Weiteren verfügen Eltern aus den bürgerlichen oder großbürgerlichen Schichten aufgrund ihres Kapitals über ein stärkeres Selbstvertrauen sowie über eine andere Wahrnehmung der schulischen Leistung ihres Kindes. Ferner variieren die Bildungsaspirationen zwischen den einzelnen sozialen Schichten.[10] Tendenziell neigen Eltern allerdings dazu, die Leistungen ihrer Kinder zu überschätzen. Insbesondere Eltern mit hoher akademischer Ausbildung neigen dazu, ihre Bildungsaspirationen für ihr Kind an ihrer eigenen Bildung, Beruf und an ihrem sozialen Status auszurichten, wie eine Gruppe von Berliner Bildungsforschern vor kurzem feststellte.[11] Ihr erhöhtes Kapital ermöglicht es ihnen dennoch, die Leistungsdefizite ihres Kindes abzumildern, sodass ein erfolgreicher Abschluss eines eigentlich ungeeigneten Kindes auf dem Gymnasium wahrscheinlicher ist, als der z.B. eines ungeeigneten Arbeiterkindes. Eltern mit geringerer Bildung und einer niedrigeren Ausstattung an Kapital gehen allerdings bei der Schulwahl ihres Kindes pragmatischer vor, indem sie eine „Kosten-Nutzen-Kalkulation“[12] in Bezug auf die höhere Schulbildung ihres Kindes anstellen. Familien aus den unteren sozialen Schichten verfügen in der Regel nicht über das Kapital, das Risiko des schulischen Scheiterns ihres Kindes auszugleichen, falls sie es entgegen der Lehrerempfehlung auf eine höhere weiterführende Schule schicken. Außerdem verfügen unterprivilegierte Eltern selber nur über ein vermindertes inkorporiertes kulturelles Kapital wie z.B. Wissen oder Bildung, sodass sie sich der Wichtigkeit der Wahl der weiterführenden Schule nicht so stark bewusst sind wie diejenigen Eltern, die selber über eine hohe Bildung verfügen.[13] Dadurch manifestiert sich die soziale Ungleichheit weiterhin, sie wird quasi von den Generationen regeneriert. Bedenkt man, dass im deutschen Bildungssystem der Wechsel von der Grund-, bzw. Primarschule, auf die weiterführende Schule eine signifikante Weichenstellung für den weiteren Bildungsweg darstellt, so kommt dem Elternwahlrecht folglich eine große Bedeutung zu.[14] Das Elternwahlrecht lastet den Eltern demnach eine große Verantwortung bezüglich des sozialen Fortkommens ihres Nachwuchses auf.
[...]
[1] Friedmann/Kaiser (2010): www.spiegel.de (31.05.2010).
[2] vgl. Pergande 2010: www.faz.net (31.05.2010).
[3] vgl. Friedmann/Kaiser 2010: www.spiegel.de (31.05.2010).
[4] vgl. Pergande 2010: www.faz.net (31.05.2010).
[5] vgl. Honnigfort 2010: www.fr-online.de (31.05.2010).
[6] Unter sozialer Ungleichheit versteht man in der Soziologie die unterschiedliche Ausstattung mit Ressourcen, bzw. die Entstehung von unterschiedlichen Chancen begehrte soziale Positionen zu erreichen.
[7] Gemäß des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) gibt es vier verschiedenen Arten von Kapital: 1.) ökonomisch, 2.) kulturell, 3.) sozial und 4.) symbolisch. Das ökonomische Kapital umfasst alle materiellen Güter (z.B. Geld). Das kulturelle Kapital hingegen bezieht sich auf die personengebundenen Aneignung von Wissen (inkorporiert), materielle Träger von Kultur (objektiviert) und die Attestierung von kulturellem Kapital (institutionalisiert). Soziales Kapital entsteht in einem Netz von sozialen Beziehungen. Das symbolische Kapital beinhaltet die gesellschaftliche Anerkennung von Kapitalien. Diese Kapitalformen sind ineinander konvertierbar, d.h. kulturelles, soziales oder ökonomisches Kapital lassen sich unter bestimmten Bedingungen in einander umwandeln.
[8] vgl. OECD 2001: 220ff.
[9] vgl. Friedmann/Kaiser 2010: www.spiegel.de (31.05.2010).
[10] vgl. Becker/Lauterbach 2008: 170ff.
[11] vgl. Friedmann/Kaiser 2010: www.spiegel.de (31.05.2010).
[12] Becker/Lauterbach 2008: 249.
[13] vgl. Becker/Lauterbach 2008: 167ff.
[14] vgl. Becker/Lauterbach 2008: 250ff.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für den Volksentscheid in Hamburg am 18. Juli 2010?
Der Anlass war die geplante Einführung einer sechsjährigen Primarschule und die damit verbundene Einschränkung des Elternwahlrechts bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Inwiefern fördert das Elternwahlrecht soziale Ungleichheit?
Laut dem Schulforscher Klaus Klemm führt ein freies Elternwahlrecht dazu, dass privilegierte Eltern ihre Kinder eher auf höhere Schulen schicken, was die soziale Schichtung verfestigt.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieus Kapitaltheorie in diesem Kontext?
Eltern mit hohem ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital können Bildungsdefizite ihrer Kinder besser ausgleichen und haben höhere Bildungsaspirationen, was den Bildungserfolg sichert.
Warum entscheiden sich bildungsnahe Eltern oft für das Gymnasium?
Akademisch gebildete Eltern orientieren die Schulwahl oft an ihrem eigenen Status und verfügen über das Selbstvertrauen sowie die Ressourcen (z.B. Nachhilfe), um das Risiko eines Scheiterns zu minimieren.
Was versteht man unter der „Kosten-Nutzen-Kalkulation“ bei der Schulwahl?
Familien aus unteren sozialen Schichten wägen das Risiko eines schulischen Scheiterns stärker gegen die Kosten ab, da sie weniger Ressourcen haben, um einen Misserfolg auf einer höheren Schule abzufedern.
Was forderte die Initiative „Wir wollen Lernen“?
Die Initiative plädierte für die Beibehaltung des Elternwahlrechts ab der vierten Klasse und gegen die Einführung der sechsjährigen Primarschule.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Rötter (Autor:in), 2010, Das Elternwahlrecht. Regenerator sozialer Ungleichheit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232330