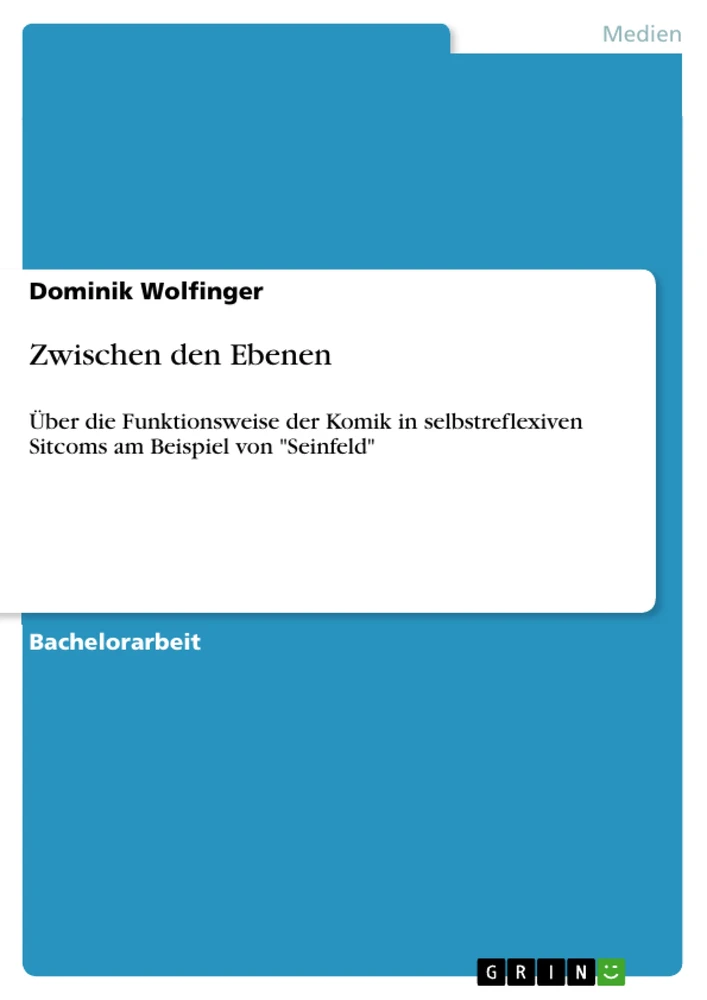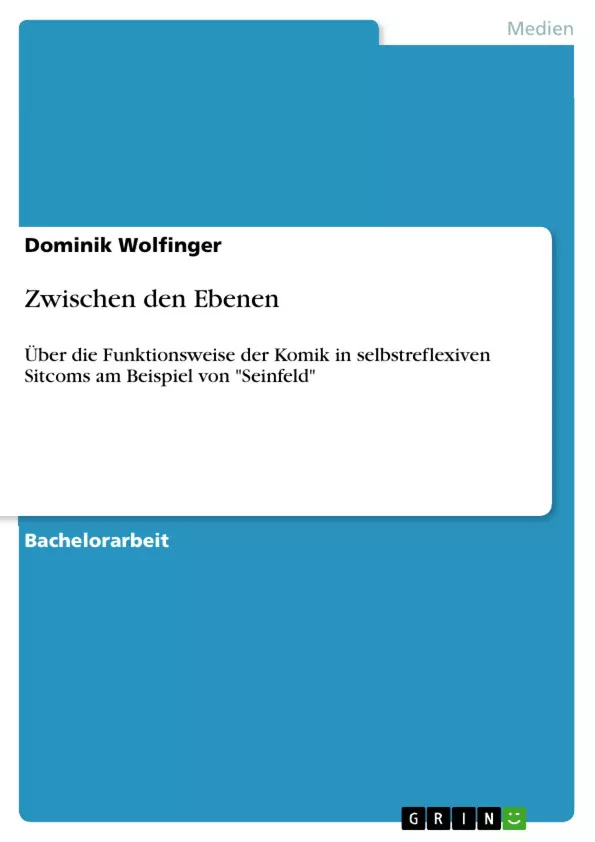Als Kind wuchs ich mit einem Fernseher auf. Nicht dass ich kein intaktes Elternhaus hatte, nein, mich fesselte der Fernsehapparat, da dieser meine Sucht nach Geschichten befriedigen konnte. Eine Sucht, die ich als Kind hatte, jetzt noch habe und hoffentlich immer haben werde. Bereits als Kind
war mir klar, dass ich ebenfalls Geschichten erzählen will. Über die Jahre und mit nicht abklingendem Interesse widmete ich mich den verschiedenen Theorien, wie eine gute Geschichte gebaut werden muss. Grundsätzlich ist jede Theorie einfach. Zumindest wenn sie in der Theorie bleibt. Wenn von der Theorie in die Praxis gedacht wird, so stellt sich das Erzählen einer
Geschichte als nicht so einfach heraus wie gedacht. Niemand interessiert sich für eine Geschichte, die man bereits kennt, die langweilig ist oder die keine Empathie für die Figuren weckt. Doch es gibt genügend Geschichten, die funktionieren und alle teilen sie etwas gemeinsames – in ihnen schlägt ein Herz.
Als Kind – vor allem als Fernsehkind – verfolgte ich natürlich die Serien, die die Fernsehkanäle damals boten. Hierbei darf ich sagen, dass ich mich nur kindgerechten Programmen gewidmet habe, wie «Speedy Gonazles» (USA, 1955), «Tom und Jerry» (USA, 1940), «Die Schlümpfe» (USA, BEL, 1981), «die Kickers» (JPN, 1986), «Batman: Animated Series» (USA, 1992) und noch etliche weitere. Dabei erforschte ich bereits als Kind – und hier sei gesagt, dass dies nur in einem kleinen Rahmen war, also wie man als Kind
eben «forscht» – die unterschiedlichen narrativen Strategien dieser Kinderserien. «Speedy Gonzales» beispielsweise erzählt in ihren Kurzepisoden eine geschlossene Geschichte der mexikanischen Maus «Speedy Gonzales», die als schnellste Maus von Mexiko mit ihrem Geschick und ihrer Intelligenz rasch jegliches Hindernis beseitigt und den Antagonisten besiegt. Anders «Tom und Jerry», eine Art antagonistische Buddy-Story einer Maus und einer Katze, die sich stets bekämpfen, um ihre unterschiedlichen Ziele zu erreichen (meist ein Stück Käse für Jerry und meist das Fangen von
Jerry für Tom).[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorrede
- 1. Einleitung
- 1. 1 Thema der Arbeit
- 1. 2 Fragestellung
- 2. Hauptteil
- 2. 1 Das Format Sitcom
- 2. 1. 1 Charakteristika der Sitcom
- 2. 1. 2 Die Sitcom Seinfeld
- 2. 2 Die Funktionsweise der Selbstreflexion
- 2. 3 Die Funktionsweise der Komik
- 2. 3. 1 Thomas Hobbes – Lachen als Akt der Selbstaffirmation
- 2. 3. 2 Immanuel Kant - Auflösung gespannter Erwartung
- 2. 4 Die Funktionsweise der Komik in nicht selbstreflexiven Seinfeld Episoden
- 2. 5 Die Funktionsweise der Komik in selbstreflexiven Seinfeld Episoden
- 3. Schlusswort
- 4. Quellenverzeichnis
- Literatur
- Film
- Sitcom
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser wissenschaftliche Essay analysiert die Funktionsweise der Komik in selbstreflexiven Sitcoms, insbesondere am Beispiel von Seinfeld. Das Ziel ist es, die spezifischen Elemente und Strategien der Komik in dieser Sitcom im Kontext von Selbstreflexion zu untersuchen.
- Analyse der Charakteristika und Merkmale des Sitcom-Formats
- Erforschung der Rolle der Selbstreflexion in Seinfeld
- Untersuchung der Komik in Seinfeld im Kontext von philosophischen Theorien des Lachens (Hobbes, Kant)
- Vergleich der Komik in selbstreflexiven und nicht selbstreflexiven Seinfeld Episoden
- Identifizierung spezifischer komischer Elemente und Strategien in Seinfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Fragestellung sowie den Fokus der Analyse auf die Funktionsweise der Komik in selbstreflexiven Sitcoms dar.
Der Hauptteil beginnt mit einer detaillierten Betrachtung des Sitcom-Formats, wobei die Charakteristika der Sitcom und die Besonderheiten der Sitcom Seinfeld beleuchtet werden. Anschließend werden die Funktionsweise der Selbstreflexion und der Komik in der Serie untersucht, unter Einbezug philosophischer Ansätze von Hobbes und Kant. Abschließend werden die Unterschiede in der komischen Funktionsweise in nicht selbstreflexiven und selbstreflexiven Seinfeld Episoden herausgestellt.
Schlüsselwörter
Selbstreflexive Sitcom, Komik, Seinfeld, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, philosophische Ansätze zum Lachen, komische Elemente, komische Strategien.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die Sitcom „Seinfeld“ besonders?
Seinfeld gilt als selbstreflexive Sitcom, die oft als „Serie über nichts“ bezeichnet wird und klassische Erzählstrukturen sowie das Genre selbst thematisiert.
Wie funktioniert Komik laut Thomas Hobbes?
Hobbes sieht Lachen als einen Akt der Selbstaffirmation, bei dem man sich über die Schwächen anderer erhebt.
Welchen Ansatz verfolgt Immanuel Kant zur Komik?
Für Kant entsteht Lachen durch die plötzliche Auflösung einer gespannten Erwartung in nichts.
Was unterscheidet selbstreflexive von nicht selbstreflexiven Episoden?
In selbstreflexiven Episoden bricht die Serie die „vierte Wand“ oder thematisiert ihre eigene Produktion, was eine zusätzliche Ebene der Komik erzeugt.
Warum werden narrative Strategien von Kinderserien in der Einleitung erwähnt?
Sie dienen als Vergleichsbasis, um die Entwicklung von einfachen, geschlossenen Geschichten hin zu komplexen, modernen Formaten wie der Sitcom zu verdeutlichen.
- Citation du texte
- Dominik Wolfinger (Auteur), 2013, Zwischen den Ebenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232433