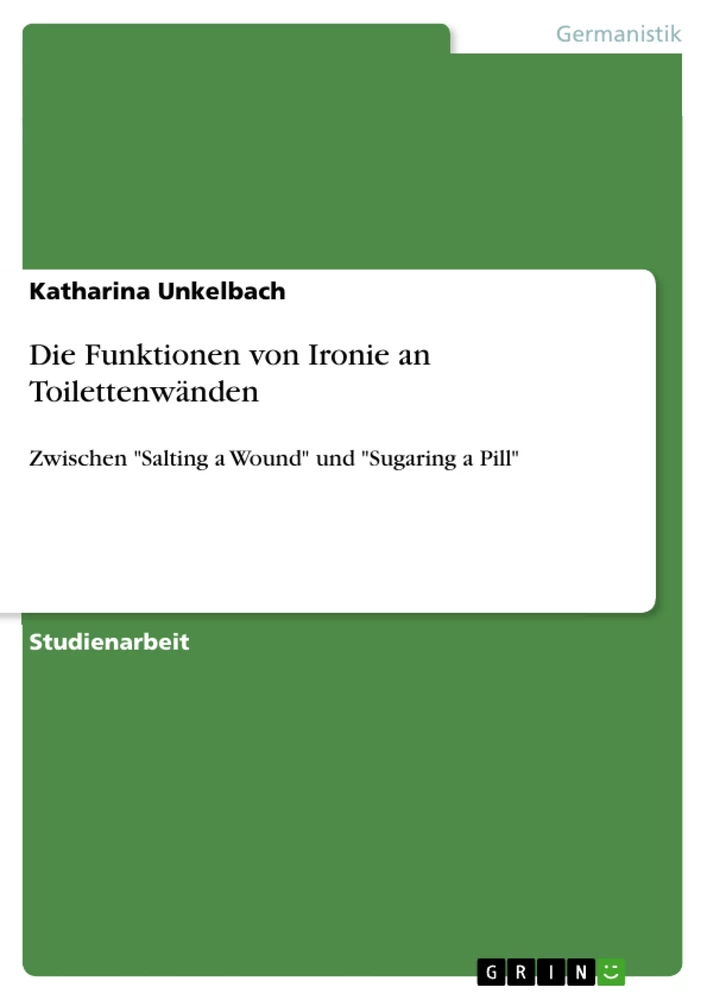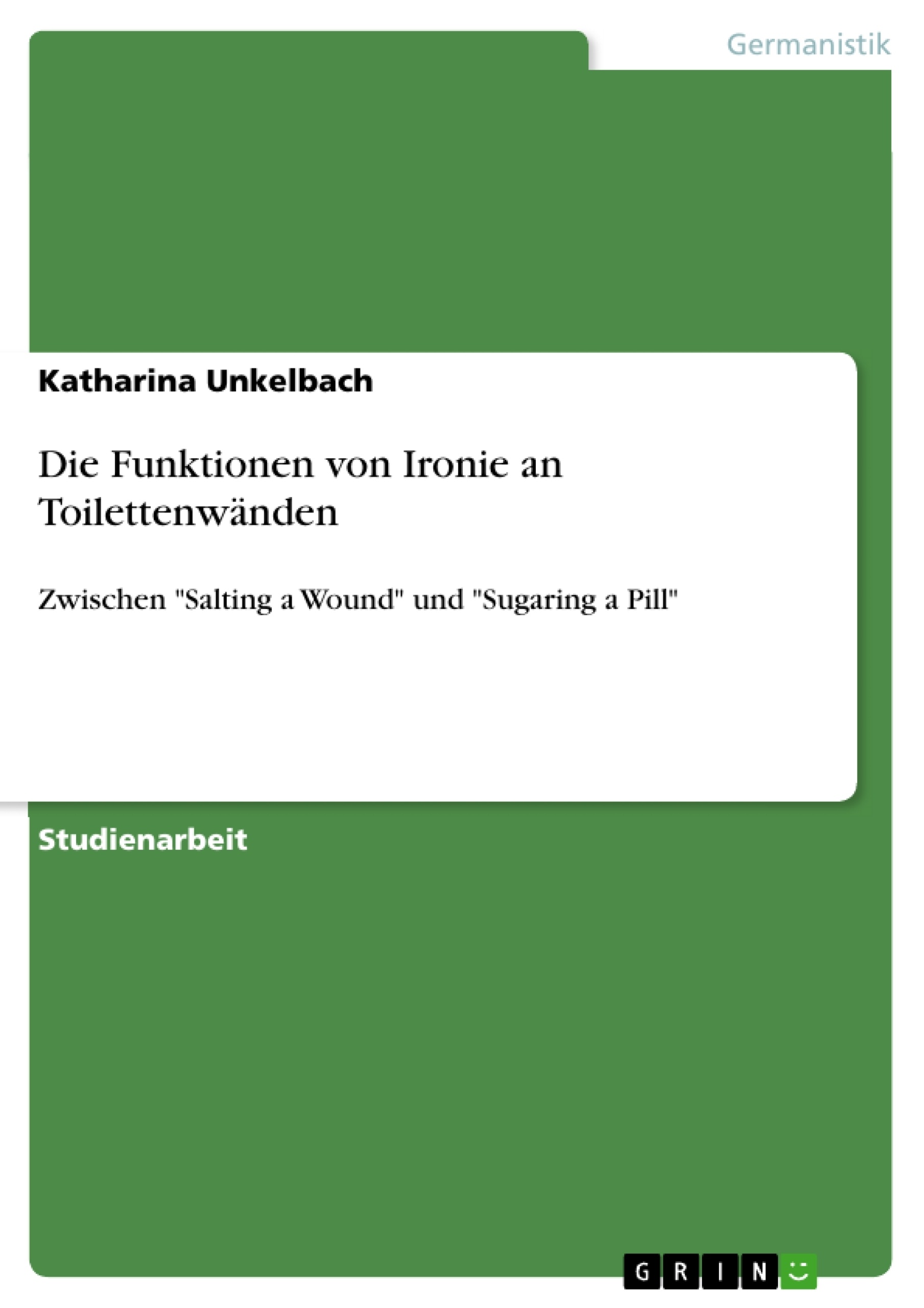Fungiert Ironie, wie Goethe einst sinnierte, als „Das Körnchen Salz, durch welches das Aufgetischte überhaupt erst genießbar wird“ (GOETHE, zitiert nach MANN 2006: 16) oder doch eher als „Das Salz in der Wunde“ (vgl. COLSTON 2007), das diese umso furchtbarer brennen lässt? In den vergangenen Jahrzehnten wurde Ironie mit Hilfe verschiedener Theorieansätze (siehe WILSON & SPERBER 1981; CLARK & GERRIG 1984; BROWN & LEVINSON 1987; KUMON-NAKAMURA 1993) zwar eingehend untersucht, was Ironie ist und wie diese entsteht; der funktionalen Komponente jedoch wurde weitaus weniger Beachtung geschenkt. Ich möchte argumentieren, dass die konkrete Funktion von Ironie in einer bestimmten Situation, die formale Seite in signifikantem Maße determiniert. Aus diesem Grund ist eine Betrachtung der funktionalen Komponente von Ironie unerlässlich und soll im Augenmerk der folgenden Analyse stehen.
Aufgrund des beschränkten Rahmens dieser Arbeit fokussiert sich die Betrachtung auf einen speziellen, (nicht nur hinsichtlich der Ironie) unerforschten Kommunikationskontext: Die Toilettenwände der Mainzer Universität. Hierbei soll primär untersucht werden, welche konkreten Funktionen Ironie im Kontext „Toilette“ für den Schreibenden sowie den Adressaten erfüllt. In diesem Zusammenhang wird das quantitative Vorkommen der fünf Hauptironietypen jocularity, sarcasm, hyperbole, rhetorical question, understatements (nach GIBBS 2007: 339) betrachtet. Zudem soll die Hypothese überprüft werden, ob Ironie an Toilettenwänden – aufgrund der außergewöhnlichen sozio-kommunikativen Grundkonstellation (siehe Kapitel 3) – primär der Verstärkung negativer Kritik dient.
Um die Ergebnisse der Studie in einen klar definierten Kontext einordnen zu können, erhält der Leser in Kapitel 2 zunächst einen Einblick in die Datengrundlage des verwendeten Bildkorpus sowie etwaige Problematiken, die bei der Auswertung und Interpretation der Daten auftreten können. In Kapitel 3 wird knapp die sozio-kommunikative Grundkonstellation an der Toilettenwand skizziert, da diese in ursächlichem Zusammenhang mit der funktionalen Verwendung von Ironie steht. Anschließend wird in Kapitel 4 das quantitative Vorkommen verschiedener Ironietypen betrachtet. Kapitel 5 thematisiert zunächst die prinzipiell möglichen Funktionen von Ironie, die anschließend im Kontext „Toilette“ analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Datengrundlage, Ironieverständnis und Problematik
- Sozio-kommunikative Grundkonstellation „ Toilettenwand"
- Ironietypen an der Toilettenwand
- Potenzielle Funktionen von Ironie
- Bewertung: Kritik und „Spiegelfunktion"
- Interpersonelle (soziale) Funktionen
- Funktionen von Ironie im Kontext „Toilette"
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktionen von Ironie in einem spezifischen Kommunikationskontext: an den Toilettenwänden der Universität Mainz. Ziel ist es, die konkreten Funktionen von Ironie in diesem Kontext zu analysieren und die Hypothese zu überprüfen, ob Ironie an Toilettenwänden primär der Verstärkung negativer Kritik dient.
- Analyse der Funktionen von Ironie an Toilettenwänden
- Untersuchung der sozio-kommunikativen Grundkonstellation an Toilettenwänden
- Quantitative Analyse des Vorkommens verschiedener Ironietypen
- Vergleich der Funktionen von Ironie im Kontext „Toilette" mit den allgemeinen Funktionen von Ironie
- Überprüfung der Hypothese, ob Ironie an Toilettenwänden primär der Verstärkung negativer Kritik dient
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 gibt einen Einblick in die Datengrundlage der Studie, die aus 394 Inschriften ausgewählter Frauen- und Männertoiletten der Universität Mainz besteht. Die Analyse konzentriert sich auf 24 als „ironisch" wahrgenommene Äußerungen. Kapitel 3 beschreibt die sozio-kommunikative Grundkonstellation an der Toilettenwand, die durch Anonymität des Senders, partielle Anonymität des Empfängers und asynchrone, indirekte Kommunikation gekennzeichnet ist. Kapitel 4 betrachtet das quantitative Vorkommen verschiedener Ironietypen, wobei die Kategorie „Scherzhaftigkeit" am häufigsten vertreten ist, gefolgt von „Übertreibung" und „Rhetorischer Frage". Kapitel 5 analysiert die potenziellen Funktionen von Ironie, sowohl im Allgemeinen als auch im Kontext „Toilette". Es wird deutlich, dass die humoristische Funktion von Ironie an Toilettenwänden eine herausragende Rolle spielt, während die Funktion der Verstärkung negativer Kritik nur in einem Fall beobachtet werden konnte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Funktionen von Ironie, die sozio-kommunikative Grundkonstellation an Toilettenwänden, die verschiedenen Ironietypen, die Analyse von Inschriften an Toilettenwänden, die Universität Mainz, die humoristische Funktion von Ironie, die Verstärkung negativer Kritik, die Anonymität des Senders und des Empfängers, die asynchrone und indirekte Kommunikation sowie die quantitative Analyse des Vorkommens von Ironietypen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktionen erfüllt Ironie an Toilettenwänden?
Ironie dient in diesem Kontext primär humoristischen Zwecken, der Unterhaltung und in selteneren Fällen der Verstärkung von Kritik.
Welche Ironietypen kommen am häufigsten vor?
Die Untersuchung zeigt, dass „Scherzhaftigkeit“ (jocularity) am häufigsten vertreten ist, gefolgt von Übertreibungen und rhetorischen Fragen.
Was charakterisiert die Kommunikation an Toilettenwänden?
Die sozio-kommunikative Grundkonstellation ist geprägt durch Anonymität des Senders, asynchrone Zeitabläufe und indirekte Interaktion.
Dient Ironie an Toilettenwänden primär der negativen Kritik?
Entgegen der ursprünglichen Hypothese ergab die Studie der Universität Mainz, dass die humoristische Funktion weitaus dominanter ist als die negative Kritik.
Wie viele Inschriften wurden für die Studie analysiert?
Es wurden insgesamt 394 Inschriften an Toiletten der Universität Mainz untersucht, von denen 24 explizit als ironisch eingestuft wurden.
- Citation du texte
- Katharina Unkelbach (Auteur), 2013, Die Funktionen von Ironie an Toilettenwänden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232544