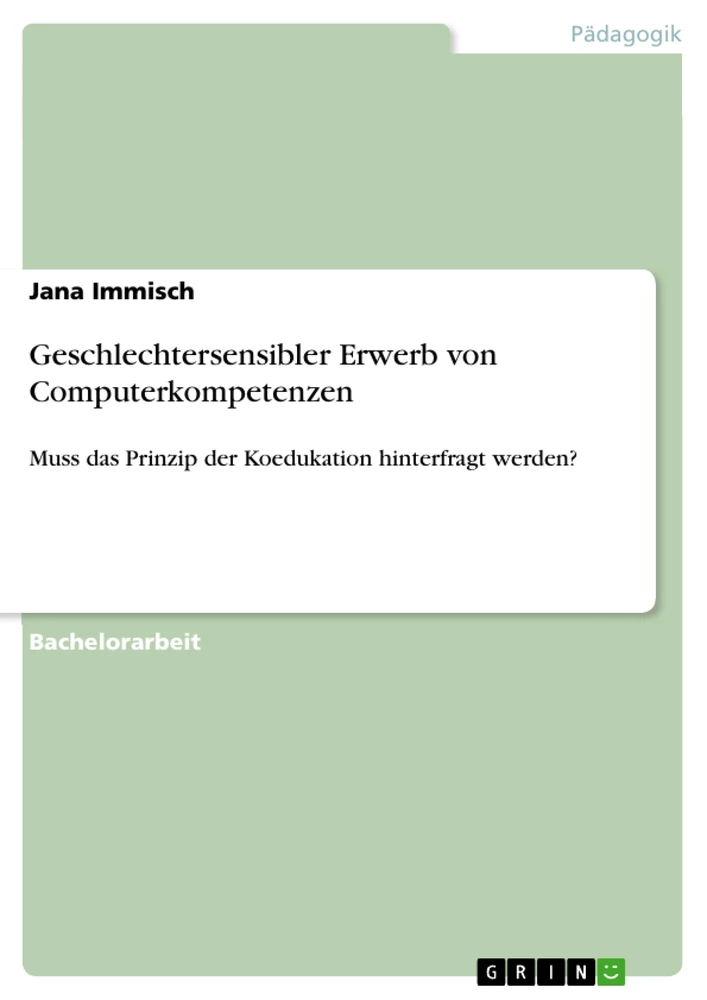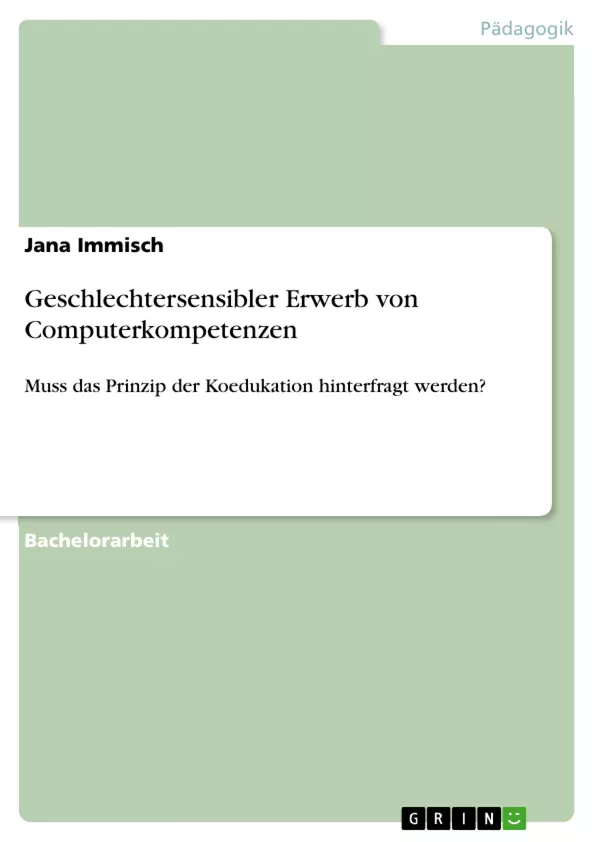„Medienkinder von Geburt an“ (Theunert 2007, S.9) hieß es auf einer Tagung des
Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (JFF). Hervor ging dabei, dass ein medienfreier Raum „Kindheit“ Illusion sei (vgl. Theunert/Demmler 2007, S.92). In Betracht dazu kommt, dass im Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt verbindlich festgelegt wurde, dass Schüler bereits im Grundschulalter an den reflektierenden Umgang mit verschiedenen Medien (als Informations- und Kommunikationsmittel) heranzuführen sind (vgl. Kultusministerium Sachsen-Anhalt, Grundsatzband 2007, S. 9, vgl. URL 1). Daran ist abzulesen, dass im 21. Jahrhundert Medienkompetenz ein Teil von Lebenskompetenz geworden ist und ihre Vermittlung ein Bestandteil des Aufwachsens darstellt (vgl. Zacharias 2005, S.30). Die jährlich erhobene KIM-Studie bestätigt diese Annahme und machte 2010 deutlich, dass vor allem der Computer nicht mehr aus der Kindheit wegzudenken ist. Bereits für Sechs- bis Siebenjährige ist der Computerumgang in der Schule, als auch zu Hause für die Schule eine vertraute Realität (vgl. KIM-Studie 2010, S.29f, vgl. URL 2). Grundlegende Computerkenntnisse müssten demzufolge bereits im Elementarbereich erworben werden. Bislang liegen jedoch nur wenige empirisch fundierte Untersuchungen im frühkindlichen Bereich, im Zusammenhang mit dem Erwerb von Medienkompetenzen, vor (vgl. Luca/Aufenanger 2007, S.25). Im Altersbereich der Vierbis Fünfjährigen gibt es nur vereinzelt Forschungen darüber, wie diese Altersgruppe lernt (vgl. Hasselhorn 2011, S.19). Kompetenzen erwerben die Kinder im Schulunterricht auf Basis koedukativer Unterrichtung. Monoedukative Strukturen lassen sich ebenso kaum im Elementarbereich auffinden. Demnach hat sich das Prinzip der Koedukation, im staatlichen Elementar- und Primarbereich des 21. Jahrhunderts durchgesetzt. Kinder lernen folglich in gemischtgeschlechtlichen Gruppen oder Klassen zusammen. Dabei wirft sich die Frage auf, ob dieses koedukative Prinzip sich im Hinblick zum Erwerb von Computerkompetenzen bewähren kann? Ausnahme jener koedukativen Regelung im Schulbereich, stellt der Spotunterricht dar. Auf Grund der offensichtlichen körperlichen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gestaltet sich der Sportunterricht überwiegend getrenntgeschlechtlich. Doch sollten die Geschlechterunterschiede nur im Sportunterricht geschlechtersensibel behandelt werden?[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Prinzip der Koedukation im Primar- und Elementarbereich
- 2.1 Begriffsklärung Koedukation
- 2.2 Geschichtlicher Abriss des Unterrichts in der Primarstufe, ab 20. Jahrhundert
- 2.3 Medien: „alte Medien“ und „neue Medien“.
- 2.4 Medienarbeit im Elementarbereich, Ende 20. Jahrhundert bis Heute
- 3. Frühkindliche Entwicklungen, bezogen auf die Entstehung der eigenen Geschlechtsidentität, Geburt bis sechs Jahre
- 3.1 Vorgeburtliche, biologische Einflussfaktoren
- 3.2 Von der eigenen Identität zur Geschlechtsidentität
- 3.3 Entwicklungsabriss der kindlichen Gehirnentwicklung
- 3.4 Die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten
- 3.5 Die Entwicklung frühkindlichen Spiels
- 4. Geschlechtersensible Entwicklungen, bis sechs Jahre
- 4.1 Begriffsklärung Sozialisation
- 4.2 Frühkindliche geschlechtsspezifische Entwicklungen und Sozialisation
- 4.2.1. Allgemeine geschlechtsspezifische Entwicklungsunterschiede
- 4.2.2 Die primäre Sozialisationsinstanz: Eltern
- 4.2.3 Die primäre Sozialisationsinstanz: Geschwister
- 4.2.4 Die sekundäre Sozialisationsinstanz: Kindergarten
- 4.2.5 Die tertiäre Sozialisationsinstanz: Gleichaltrige
- 4.2.6 Die tertiäre Sozialisationsinstanz: Medien
- 5. Geschlechtersensibler Erwerb von Computerkompetenzen, Kinder bis sechs Jahre
- 5.1 Frühkindliches Einstiegsalter für den Erwerb von Computerkompetenzen
- 5.2 Sollte der Erwerb von Computerkompetenzen geschlechtersensibel erfolgen?
- 5.3 Muss das Prinzip der Koedukation hinterfragt werden?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entwicklung von Computerkompetenzen im frühen Kindesalter im Kontext des Prinzips der Koedukation. Sie untersucht, ob und inwiefern dieses Prinzip im Hinblick auf den Erwerb von Computerkompetenzen durch Jungen und Mädchen neu betrachtet werden sollte. Die Arbeit befasst sich zudem mit den verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Geschlechtsidentität und den Einfluss dieser Faktoren auf die Lernprozesse im Elementarbereich.
- Entwicklung von Computerkompetenzen im frühen Kindesalter
- Geschlechtsspezifische Unterschiede und Entwicklungen
- Das Prinzip der Koedukation im Elementarbereich
- Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Geschlechtsidentität
- Lernprozesse im Elementarbereich
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt einen Überblick über den Themenbereich und stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext der wachsenden Bedeutung von Medienkompetenz im 21. Jahrhundert dar.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Prinzip der Koedukation im Primar- und Elementarbereich und untersucht dessen historischen Hintergrund und aktuelle Bedeutung im Hinblick auf die Vermittlung von Medienkompetenz.
- Kapitel 3: Das Kapitel beleuchtet frühkindliche Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die Entstehung der eigenen Geschlechtsidentität, und beleuchtet verschiedene Einflussfaktoren wie biologische Faktoren, Gehirnentwicklung, sprachliche Fähigkeiten und Spielverhalten.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel widmet sich der geschlechtersensiblen Entwicklung bis zum sechsten Lebensjahr und analysiert die Rolle verschiedener Sozialisationsinstanzen wie Eltern, Geschwister, Kindergarten und Gleichaltrige.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel befasst sich mit dem geschlechtersensiblen Erwerb von Computerkompetenzen bei Kindern bis sechs Jahren und analysiert das frühkindliche Einstiegsalter, die Notwendigkeit eines geschlechtersensiblen Ansatzes und die mögliche Relevanz einer kritischen Betrachtung des Prinzips der Koedukation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenbereiche Computerkompetenz, Koedukation, Geschlechtsidentität, frühkindliche Entwicklung, Sozialisation, Medienpädagogik und Elementarbereich. Sie betrachtet empirische Studien und theoretische Ansätze zu geschlechtersensiblen Lernprozessen und analysiert die Rolle von Medien im Kontext der frühkindlichen Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Koedukation im Elementarbereich?
Es ist das gemeinsame Lernen von Jungen und Mädchen in gemischten Gruppen, wie es heute in Kindergärten und Grundschulen Standard ist.
Sollten Computerkompetenzen geschlechtersensibel vermittelt werden?
Die Arbeit hinterfragt, ob das koedukative Prinzip beim Computererwerb ausreicht oder ob Jungen und Mädchen unterschiedliche Herangehensweisen benötigen.
Wann ist das richtige Einstiegsalter für Computerkompetenzen?
Schon für Vier- bis Sechsjährige ist der Umgang mit Computern oft Realität; die Arbeit diskutiert den Erwerb grundlegender Kenntnisse bereits im Elementarbereich.
Welche Rolle spielen Eltern bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation?
Eltern gelten als primäre Sozialisationsinstanz, die oft unbewusst Geschlechterrollen und den Zugang zu Medien prägen.
Gibt es Unterschiede in der Gehirnentwicklung von Jungen und Mädchen?
Die Arbeit beleuchtet biologische Einflussfaktoren und den Entwicklungsabriss der kindlichen Gehirnentwicklung im Kontext der Geschlechtsidentität.
- Arbeit zitieren
- B.A. Kultur- und Medienpädagoge Jana Immisch (Autor:in), 2012, Geschlechtersensibler Erwerb von Computerkompetenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232547