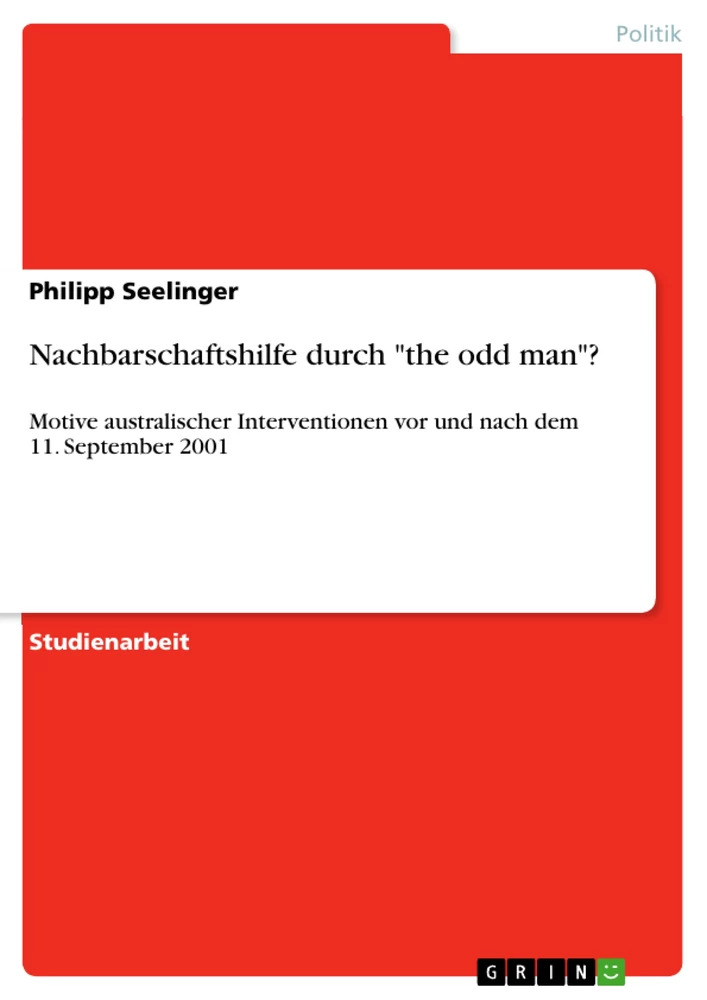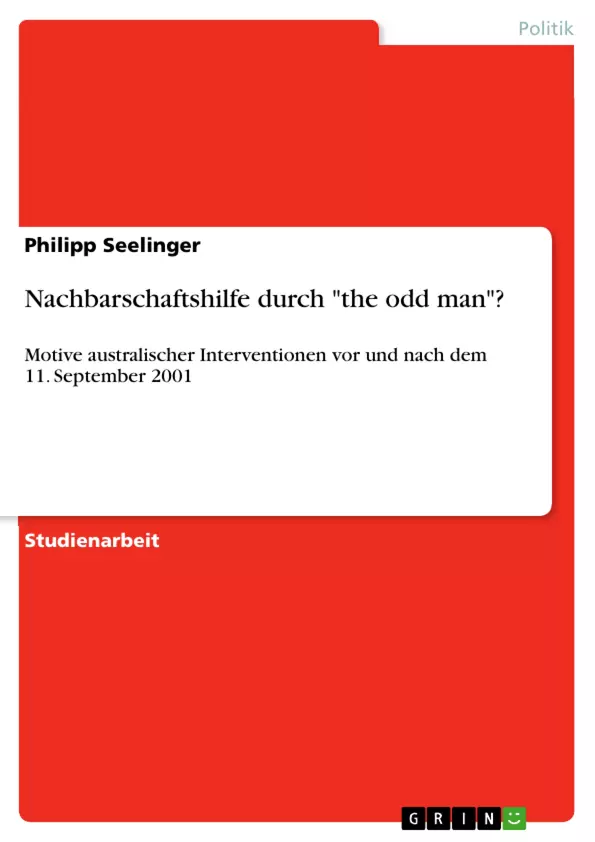Die Außenpolitik Australiens wird seit jeher stark davon beeinflusst, dass das Land als Mitglied der westlichen Wertegemeinschaft geographisch fernab der übrigen westlichen Industrieländer liegt.
Nach der Dekolonisation der pazifischen Nachbarstaaten beschränkte Australien seinen Einfluss in der Region auf umfangreiche Entwicklungshilfe für die unterentwickelten Nachbarstaaten. Militärisches Engagement oder gar Interventionen in den pazifischen Kleinstaaten standen kaum zur Debatte.
Auch nach dem Ende des Kalten Krieges änderte sich zunächst wenig an dieser Praxis, wenngleich sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die sicherheitspolitischen Doktrinen Forward Defence und Defence of Australia regelmäßig abwechselten.
Um die Jahrtausendwende jedoch intervenierte Australien zweimal in seiner Nachbarschaft: Im Jahr 1999 wurden die International Forces East Timor (INTERFET) als Reaktion auf blutige Auseinandersetzungen zwischen Unabhängigkeitsbefürwortern und –gegnern entsandt und 2003 sollte die Regional Assistance Mission in Solomon Islands (RAMSI) ähnliche Unruhen zwischen verschiedenen indigenen Gruppen beenden und dem Gesetz wieder Geltung verschaffen.
Auf den ersten Blick scheinen beide Interventionen sehr ähnlich: In beiden Fällen waren soziale Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände der Anlass für die Intervention, beide Male war es die liberal-konservative Regierung, die den Einsatz beschloss, jeweils stand die Bevölkerungsmehrheit hinter dem militärischen Engagement und je gelang es schnell die Gewalttaten zu beenden.
Bei genauerer Betrachtung ergeben sich jedoch wesentliche Unterschiede. Für INTERFET gab es eine Sicherheitsrats-Resolution, die den Einsatz mandatierte, RAMSI ist aufgrund der fehlenden UN-Mandatierung völkerrechtlich zumindest umstritten. Osttimor war zum Zeitpunkt der Intervention kein völkerrechtlich anerkannter, souveräner Staat.
Zudem fanden zwischen den beiden Interventionen mit den Anschlägen auf das WTC und Diskotheken auf Bali zwei Ereignisse statt, die den sicherheitspolitischen Diskurs sowie das strategische Denken nachdrücklich veränderten und die Aufmerksamkeit auf sogenannte failing states lenkten, die Terroristen als Unterschlupf dienen, von denen sie mungestört operieren können.
Ob sich das veränderte sicherheitspolitische Umfeld auf die Begründung der RAMSI-Mission niederschlägt, soll die vorliegende Arbeit durch die Analyse der Argumente für die beiden Interventionen ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Literaturbericht
- Wann greifen Demokratien zu den Waffen?
- Australiens Interventionen in der Nachbarschaft
- Konflikthintergrund
- INTERFET: Australien interveniert in Osttimor
- Nine-eleven und Bali-Bombing
- RAMSI: Australien greift auf den Salomonen ein
- Australiens Motive für die Interventionen
- INTERFET
- RAMSI
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Motive australischer Interventionen in Osttimor und auf den Salomonen vor und nach dem 11. September 2001. Sie untersucht, wie die australische Regierung unter Premierminister John Howard die Einsätze von Truppen in beiden Ländern rechtfertigte und welche Rolle humanitäre Aspekte sowie Sicherheitsbedrohungen dabei spielten.
- Die Theorie des Demokratischen Friedens und ihre Relevanz für militärische Interventionen von Demokratien
- Die Rolle humanitärer Interventionen in der australischen Außenpolitik
- Der Einfluss des 11. Septembers und der Bali-Bombenanschläge auf die australische Sicherheitspolitik
- Die Bedeutung von gescheiterten Staaten (failed states) im Kontext der internationalen Sicherheitspolitik
- Die australische Strategie gegenüber seinen pazifischen Nachbarn
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der australischen Interventionen in Osttimor und auf den Salomonen ein. Sie erläutert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die verfügbare Literatur.
Kapitel 2 analysiert die Theorie des Demokratischen Friedens und ihre Relevanz für militärische Interventionen von Demokratien. Es wird argumentiert, dass Demokratien neben der unmittelbaren Verteidigung gegen einen Angriff auch militärisch tätig werden, wenn sie eine gute Chance auf Erfolg ohne erhebliche Verluste sehen. Es werden zwei Hauptmotive für militärische Interventionen von Demokratien identifiziert: humanitäre Motive und Sicherheitsbedrohungen.
Kapitel 3 beleuchtet den Konflikthintergrund in Osttimor und auf den Salomonen. Es wird die Geschichte der Konflikte in beiden Ländern sowie die Ereignisse des 11. Septembers und der Bali-Bombenanschläge dargestellt. Es wird gezeigt, wie diese Ereignisse die australische Sicherheitspolitik beeinflussten und die Wahrnehmung von gescheiterten Staaten als Bedrohung für die internationale Sicherheit veränderten.
Kapitel 3.2 analysiert die Motive Australiens für die Interventionen in Osttimor und auf den Salomonen. Es wird gezeigt, dass die australische Regierung in Osttimor primär von humanitären Motiven geleitet wurde, während die Intervention auf den Salomonen stärker von Sicherheitsbedrohungen beeinflusst war.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die australische Außenpolitik, Interventionen, Osttimor, Salomonen, 11. September, Bali-Bombenanschläge, Demokratischer Frieden, humanitäre Interventionen, Sicherheitsbedrohungen, gescheiterte Staaten (failed states), Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche zwei großen Interventionen Australiens werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die INTERFET-Mission in Osttimor (1999) und die RAMSI-Mission auf den Salomonen (2003).
Wie unterschieden sich die rechtlichen Grundlagen der beiden Einsätze?
Für INTERFET gab es eine UN-Sicherheitsrats-Resolution, während RAMSI aufgrund fehlender UN-Mandatierung völkerrechtlich umstritten war.
Welchen Einfluss hatten 9/11 und die Bali-Anschläge auf die australische Politik?
Diese Ereignisse veränderten den Sicherheitsdiskurs und lenkten die Aufmerksamkeit auf "failing states" (gescheiterte Staaten) als potenzielle Unterschlupfe für Terroristen.
Was besagt die Theorie des "Demokratischen Friedens" in diesem Kontext?
Die Theorie legt nahe, dass Demokratien militärisch intervenieren, wenn humanitäre Motive vorliegen oder Sicherheitsbedrohungen bestehen und die Erfolgsaussichten hoch sind.
Was war das Hauptmotiv für die RAMSI-Intervention?
Im Gegensatz zu den primär humanitären Motiven in Osttimor war die RAMSI-Mission stärker von Sicherheitserwägungen im veränderten geopolitischen Umfeld nach 2001 geprägt.
- Quote paper
- Philipp Seelinger (Author), 2009, Nachbarschaftshilfe durch "the odd man"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232602