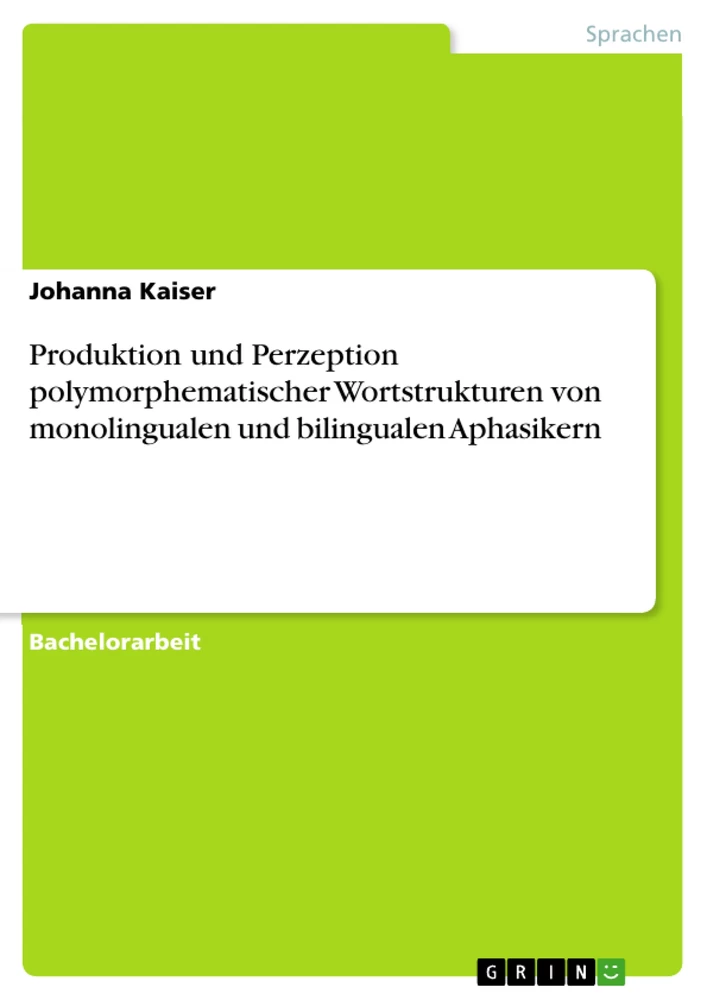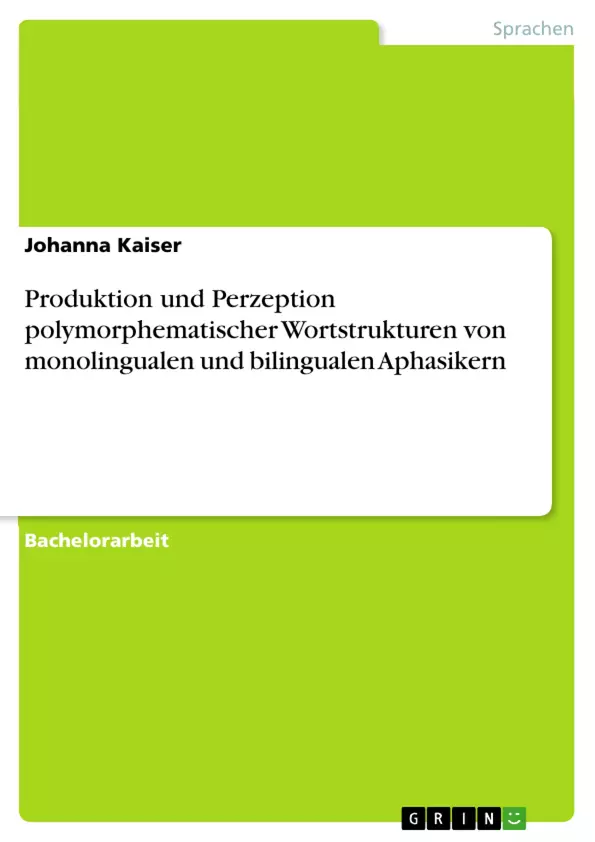„Sprache ist ein ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen.“ (Edward, Sabir 1991)
Doch was geschieht, wenn dieses System durch Krankheit, einen Unfall o.ä., gestört wird? Läsionen der linken Gehirnhemisphäre in der das sog. Sprachzentrum lokalisiert ist, wirken sich negativ auf die Sprachperzeption bzw. – produktion aus und können jegliche Bereiche des Sprachverständnisses als auch der sprachlichen Verbalisierung beeinträchtigen.
In der vorliegende Ausführung soll der Frage nachgegangen werden, ob der Aspekt der Monolingualität bzw. der Bilingualität des aphasischen Sprechers die Produktion bzw. Perzeption von polymorphematischen Wortstrukturen beeinflusst bzw. inwiefern sich die Leistungen hinsichtlich der Kompositaverarbeitung beim mono- und beim bilingualen aphasischen Sprecher unterscheiden.
Die vorliegende Ausführung setzt sich aus aufeinander aufbauenden sechs Teilen zusammen. Nach der Einleitung in die Thematik wird in Punkt zwei zunächst auf die anatomische Lokalisation des Sprachzentrums eingegangen und es werden die verschiedenen Sprach- und Sprechstörung im Hinblick auf deren Symptomatik kontrastiv dargestellt, um daran anknüpfend im Speziellen auf die Broca- und die Wernicke-Aphasie einzugehen.
Punkt drei beinhaltet die Beschreibung des Wortbildungsmusters „Komposition“ und die kontrastive Darstellung der Eigenschaften französischer und deutscher Komposita. Außerdem werden die verschiedenen Kompositionstypen, im Hinblick auf deren Form, innere Struktur und semantischen Gehalt, untersucht.
Nachdem in Punkt zwei und Punkt drei ein allgemeiner Überblick zu der Aphasie und der Komposition gegeben wurde, soll Punkt vier als Grundlage für die in Punkt fünf beschriebenen Studien zur Kompositaperzeption– und produktion beim aphasischen Sprecher gesehen werden. Nachdem in Punkt vier auf verschiedene Sprachverarbeitungsmodelle eingegangen wird und Modellvorstellungen speziell zur Kompositatverarbeitung erläutert werden, beinhaltet der darauffolgende Punkt fünf die Darstellung vierer Studien. Innerhalb dieser Studien wird sich mit der Wortverarbeitung polymorphematischer Wortstrukturen befasst. Da das Französische und das Italienische hinsichtlich der Komposita sehr ähnlich organisiert sind, soll die italienische Sprache innerhalb des Gliederungspunktes fünf als Platzhalter für romanische Sprachen fungieren.
Inhaltsverzeichnis
- Sprache
- Die Lokalisation des Sprachzentrums
- Beeinträchtigung der Sprachproduktion und der Sprachrezeption
- Erworbene Sprach- und Sprechstörungen
- Aphasie
- Ursachen für Aphasien
- Die Broca- und die Wernicke-Aphasie
- Die Broca-Aphasie
- Der Agrammatismus als Leitsymptom der Broca-Aphasie
- Die Wernicke-Aphasie
- Der Paragrammatismus als Leitsymptom der Wernicke Aphasie
- Aphasie im bilingualen Individuum
- Die Komposition als Wortbildungsmuster
- Deutsche und französische Komposita im Vergleich
- Typisierung der Komposita
- Determinativkomposita (endozentrische Komposita)
- Possessivkomposita als Untertyp der Determinativkomposita
- Kopulativkomposita
- Zusammenfassende Unterschiede der französischen und deutschen Komposita
- Modelle der Sprachverarbeitung
- Das Logogen-Modell nach Morton (1969)
- Das Zwei-Stufen-Modell nach Levelt (1989)
- Modellvorstellungen zur Kompositaverarbeitung
- Die Produktion und Perzeption von Komposita beim mono- und beim bilingualen Aphasiker
- Die Verarbeitung von Komposita beim monolingualen Aphasiker
- Die Verarbeitung von Komposita beim deutschsprachigen Aphasiker
- Die Verarbeitung von Nominalkomposita bei Aphasie (A. Lorenz, 2007)
- The production of nominal compounds in Aphasia (G. Blanken, 2000)
- Die Verarbeitung von Komposita beim bilingualen Aphasiker
- The processing of compound word: A Study in Aphasia" (M. Delazer/C. Semenza, 1998)
- Zusammenfassung
- Die Verarbeitung von Komposita beim bilingualen Aphasiker
- The Bilingual Brain: Bilingual Aphasia (Fabbro, 2001)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Lokalisation und Funktionsweise des Sprachzentrums
- Symptome und Ursachen von Aphasie, insbesondere Broca- und Wernicke-Aphasie
- Wortbildungsverfahren der Komposition im Deutschen und Französischen
- Modelle der Sprachverarbeitung und die Verarbeitung von Komposita im mentalen Lexikon
- Analyse von Studien zur Kompositaverarbeitung bei monolingualen und bilingualen Aphasikern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Produktion und Perzeption polymorphematischer Wortstrukturen bei monolingualen und bilingualen Aphasikern zu untersuchen. Sie analysiert, ob und inwiefern die Bilingualität des aphasischen Sprechers die Verarbeitung von Komposita beeinflusst.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel 'Sprache' bietet einen Überblick über die Lokalisation des Sprachzentrums und die verschiedenen Sprach- und Sprechstörungen, insbesondere Aphasie. Es werden die Ursachen, Symptome und Klassifikationen von Aphasie, mit besonderem Fokus auf Broca- und Wernicke-Aphasie, erläutert. Das Kapitel 'Die Komposition als Wortbildungsmuster' beschreibt das Wortbildungsverfahren der Komposition im Deutschen und Französischen. Es werden verschiedene Kompositionstypen, wie Determinativkomposita und Kopulativkomposita, gegenübergestellt und ihre Eigenschaften im Vergleich analysiert.
Das Kapitel 'Modelle der Sprachverarbeitung' stellt verschiedene Sprachverarbeitungsmodelle vor, insbesondere das Logogen-Modell von Morton und das Zwei-Stufen-Modell von Levelt. Es werden verschiedene Modellvorstellungen zur Kompositaverarbeitung, wie die full-listing Hypothese und die full-parsing Hypothese, diskutiert. Das Kapitel 'Die Produktion und Perzeption von Komposita beim mono- und beim bilingualen Aphasiker' analysiert verschiedene Studien zur Kompositaverarbeitung bei monolingualen und bilingualen Aphasikern. Es werden die Ergebnisse von Studien von Lorenz, Blanken, Delazer und Semenza vorgestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Aphasie, Bilingualität, Komposition, Wortverarbeitung, Sprachproduktion, Sprachperzeption, mentales Lexikon, Broca-Aphasie, Wernicke-Aphasie, Determinativkomposita, Kopulativkomposita, Logogen-Modell, Zwei-Stufen-Modell, full-listing Hypothese, full-parsing Hypothese, Dual-Route-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Aphasie?
Eine Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung, die nach einer Schädigung der linken Gehirnhälfte (z.B. durch Schlaganfall) auftritt und Bereiche wie Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben beeinträchtigen kann.
Unterscheiden sich Broca- und Wernicke-Aphasie in der Wortbildung?
Ja. Broca-Aphasiker leiden oft unter Agrammatismus (kurze Sätze, Probleme mit komplexen Strukturen), während Wernicke-Aphasiker eher zu Paragrammatismus und Wortverwechslungen neigen.
Wie verarbeiten Aphasiker Komposita (zusammengesetzte Wörter)?
Die Arbeit untersucht, ob Aphasiker Komposita als Ganzes abrufen (Full-listing) oder in ihre Bestandteile zerlegen (Full-parsing). Oft zeigt sich eine Beeinträchtigung bei der Zerlegung polymorphematischer Strukturen.
Haben bilinguale Aphasiker andere Schwierigkeiten als monolinguale?
Die Forschung zeigt, dass bei Bilingualen die Verarbeitung je nach Sprache variieren kann, insbesondere wenn die Sprachen unterschiedliche Wortbildungsregeln haben (z.B. Deutsch vs. Französisch).
Was ist das Logogen-Modell?
Es ist ein Sprachverarbeitungsmodell, das erklärt, wie Wörter im mentalen Lexikon aktiviert werden, wenn ein bestimmter Schwellenwert durch auditive oder visuelle Reize erreicht wird.
- Arbeit zitieren
- Johanna Kaiser (Autor:in), 2012, Produktion und Perzeption polymorphematischer Wortstrukturen von monolingualen und bilingualen Aphasikern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232644