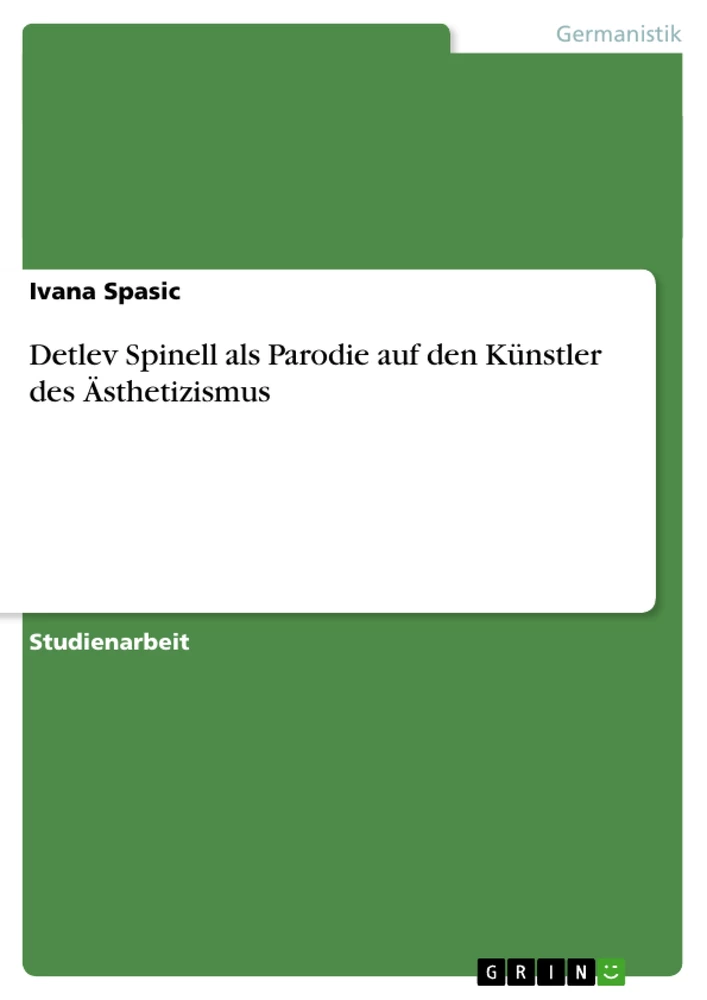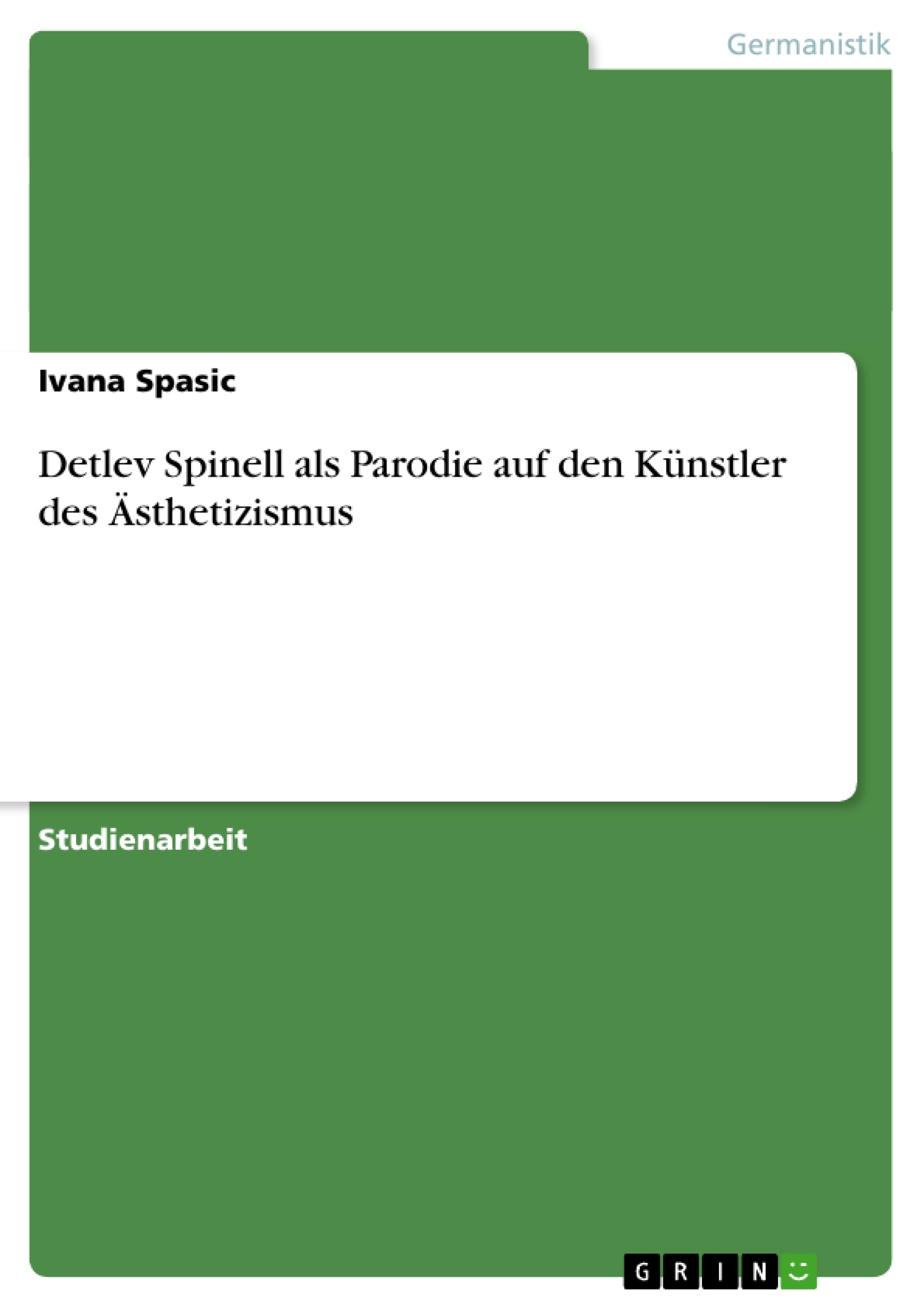Durch das in den Mittelpunkt dieser Arbeit gestellte Werk, „Tristan“, versuchte Thomas Mann 1901 die Gestalten der keltischen Sage von Tristan und Isolde wieder zu beleben. Dabei griff er nicht nach dem höfischen Epos Gottfried von Straßburgs, sondern bediente sich der rauschhaft-romantischen Oper Richard Wagners, dessen Kenntnis damals seiner Meinung nach ein unerlässlicher Teil der bürgerlichen Bildung war.
Thomas Mann jedoch blickte nicht nach dem mittelalterlichen Irland, sondern versetzte die Handlung ins wilhelminische Deutschland, wo sich eine „zu Sentimentalität und Kitsch neigende Variante“ 1 der internationalen Kunstbewegung entwickelt hatte, und zog den tugendhaften Tristan in das makabre Kleid des Fin de Siècles 2 um. Durch die Nachahmung des Wagnerschen „Tristan“ setzte er sich daher nicht nur mit Wagners Oper, sondern mit der modernen Kunstauffassung auseinander. Thomas Mann brachte die überschriebenen Satzfragmente in den verzerrten zeitgeschichtlichen Kontext, mischte das Ernste und das Komische, das Komische und das Grausige und schuf damit eine vielfache Parodie. Die vorliegende Arbeit will nun versuchen, Thomas Manns Parodie auf einen stilisierten Fin-de-Siècle-Künstlertyp und dessen Verkörperung, Detlev Spinell, sichtbar zu machen. Mein Hauptaugenmerk richtet sich deshalb auf die Maßstäbe und Erscheinungsformen dieser Epoche, von der sich Thomas Mann zu distanzieren versuchte. Um Spinells Benehmen als Folge dieser Weltanschauung aufzeigen zu können, wird Spinell zunächst den anderen Figuren der Novelle gegenübergestellt: den Mitgliedern der Familie Klöterjahn. Erst danach bietet sich die Identifizierung der einseitigen ästhetischen Haltung Spinells als ein unbezweifelbares Kennzeichen der Dekadenz, des eigentlichen Objekts der Parodie, an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ästhet in seiner Umwelt
- Spinell in Gegenüberstellung mit Klöterjahn
- Spinell in Gegenüberstellung mit Gabriele
- Gabriele als beliebter Frauentyp der Jahrhundertwende
- Spinell als lebensfeindlicher Verführer
- Der junge Klöterjahn – Spinells Lebensflucht
- Karikatur des dekadenten Ästheten
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Manns Novelle "Tristan" und untersucht die Darstellung des dekadenten Ästheten Detlev Spinell als Parodie. Das Hauptziel ist es, Spinells Verhalten im Kontext der Fin-de-Siècle-Ästhetik zu beleuchten und dessen Distanzierung von den bürgerlichen Werten aufzuzeigen.
- Parodie des dekadenten Künstlers
- Gegenüberstellung von Spinell und der bürgerlichen Gesellschaft (Klöterjahn)
- Spinells Lebensflucht und Ablehnung bürgerlicher Werte
- Die Darstellung von Gabriele als Frauentypus der Jahrhundertwende
- Ironie und Komik in Manns Erzählweise
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie beschreibt Thomas Manns Novelle "Tristan" als eine Wiederbelebung der Tristan und Isolde-Sage im Kontext des wilhelminischen Deutschlands und der Fin-de-Siècle-Ästhetik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Detlev Spinell als stilisierter Künstlerfigur und Parodie auf den dekadenten Ästheten, wobei die Distanzierung Manns von dieser Ästhetik im Mittelpunkt steht. Die Methode der Gegenüberstellung Spinells mit anderen Figuren, insbesondere der Familie Klöterjahn, wird erläutert.
Ästhet in seiner Umwelt: Dieses Kapitel analysiert Spinell im Kontext seiner Umwelt, indem es ihn mit Klöterjahn und Gabriele vergleicht. Klöterjahn wird als Repräsentant der gesunden, vitalen und bürgerlichen Welt dargestellt, im Gegensatz zu Spinells Dekadenz und Lebensverweigerung. Gabriele, als Spinells "Isolde", wird als eine Frau der Jahrhundertwende beschrieben, die in ihrer Krankheit und Sehnsucht ein Gegenstück zu Spinells ästhetischer Haltung bildet. Die Gegenüberstellung dieser Figuren verdeutlicht Spinells Ablehnung der bürgerlichen Normen und seines Rückzugs in eine Welt der Kunst und Ästhetik, die letztlich als leer und selbstzerstörerisch entlarvt wird. Der Abschnitt über Klöterjahns Sohn unterstreicht die Kontrastierung zwischen gesundem, vitalem Leben und Spinells Dekadenz. Klöterjahns naive und pragmatische Sichtweise steht im scharfen Gegensatz zu Spinells übertriebener Kunstfertigkeit und Lebensverachtung.
Karikatur des dekadenten Ästheten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung Spinells als Karikatur des dekadenten Künstlers. Manns ironische und satirische Erzählweise wird analysiert, um die Überzeichnung und Lächerlichkeit von Spinells ästhetischer Haltung aufzuzeigen. Spinells physische Erscheinung, sein Verhalten und seine Lebensauffassung werden als groteske Übertreibung des Fin-de-Siècle-Ästheten präsentiert. Der Fokus liegt darauf, wie Mann durch diese Karikatur seine eigene Ablehnung dieser Ästhetik zum Ausdruck bringt und die Leere und Künstlichkeit der dekadenten Lebensweise aufdeckt.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Tristan, Novelle, Fin de Siècle, Dekadenz, Ästhetizismus, Parodie, Detlev Spinell, Klöterjahn, Gabriele, bürgerliche Gesellschaft, Kunst, Ironie, Satire.
Thomas Mann's "Tristan": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas Manns Novelle "Tristan" mit Fokus auf die Darstellung des dekadenten Ästheten Detlev Spinell als Parodie. Sie untersucht Spinells Verhalten im Kontext der Fin-de-Siècle-Ästhetik und seine Distanzierung von bürgerlichen Werten. Die Analyse verwendet die Methode der Gegenüberstellung, insbesondere zwischen Spinell und der Familie Klöterjahn.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Parodie des dekadenten Künstlers; Gegenüberstellung von Spinell und der bürgerlichen Gesellschaft; Spinells Lebensflucht und Ablehnung bürgerlicher Werte; die Darstellung von Gabriele als Frauentypus der Jahrhundertwende; Ironie und Komik in Manns Erzählweise.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Spinell im Kontext seiner Umwelt (Vergleich mit Klöterjahn und Gabriele), ein Kapitel über die Karikatur des dekadenten Ästheten und eine Schlussfolgerung. Die Einleitung beschreibt die Novelle als Wiederbelebung der Tristan und Isolde-Sage im Kontext des wilhelminischen Deutschlands und der Fin-de-Siècle-Ästhetik und erläutert die methodische Vorgehensweise.
Wie wird Spinell dargestellt?
Spinell wird als stilisierte Künstlerfigur und Parodie auf den dekadenten Ästheten dargestellt. Seine Dekadenz und Lebensverweigerung stehen im Gegensatz zu der gesunden, vitalen und bürgerlichen Welt, repräsentiert durch die Familie Klöterjahn. Manns ironische und satirische Erzählweise überzeichnet und lächerlich Spinells ästhetische Haltung.
Welche Rolle spielt Gabriele?
Gabriele wird als Spinells "Isolde" beschrieben, als eine Frau der Jahrhundertwende, deren Krankheit und Sehnsucht ein Gegenstück zu Spinells ästhetischer Haltung bildet. Sie verdeutlicht weiterhin die Ablehnung bürgerlicher Normen durch Spinell.
Welche Rolle spielt die Familie Klöterjahn?
Die Familie Klöterjahn repräsentiert die bürgerliche Gesellschaft und steht im scharfen Kontrast zu Spinells Dekadenz und Lebensverweigerung. Der Vergleich mit Klöterjahn verdeutlicht Spinells Ablehnung bürgerlicher Normen und seinen Rückzug in eine Welt der Kunst und Ästhetik, die als leer und selbstzerstörerisch dargestellt wird.
Wie wird Manns eigene Haltung dargestellt?
Manns eigene Ablehnung der dekadenten Ästhetik wird durch die Karikatur Spinells zum Ausdruck gebracht. Die Arbeit zeigt die Leere und Künstlichkeit der dekadenten Lebensweise auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas Mann, Tristan, Novelle, Fin de Siècle, Dekadenz, Ästhetizismus, Parodie, Detlev Spinell, Klöterjahn, Gabriele, bürgerliche Gesellschaft, Kunst, Ironie, Satire.
- Citation du texte
- Ivana Spasic (Auteur), 2003, Detlev Spinell als Parodie auf den Künstler des Ästhetizismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23272