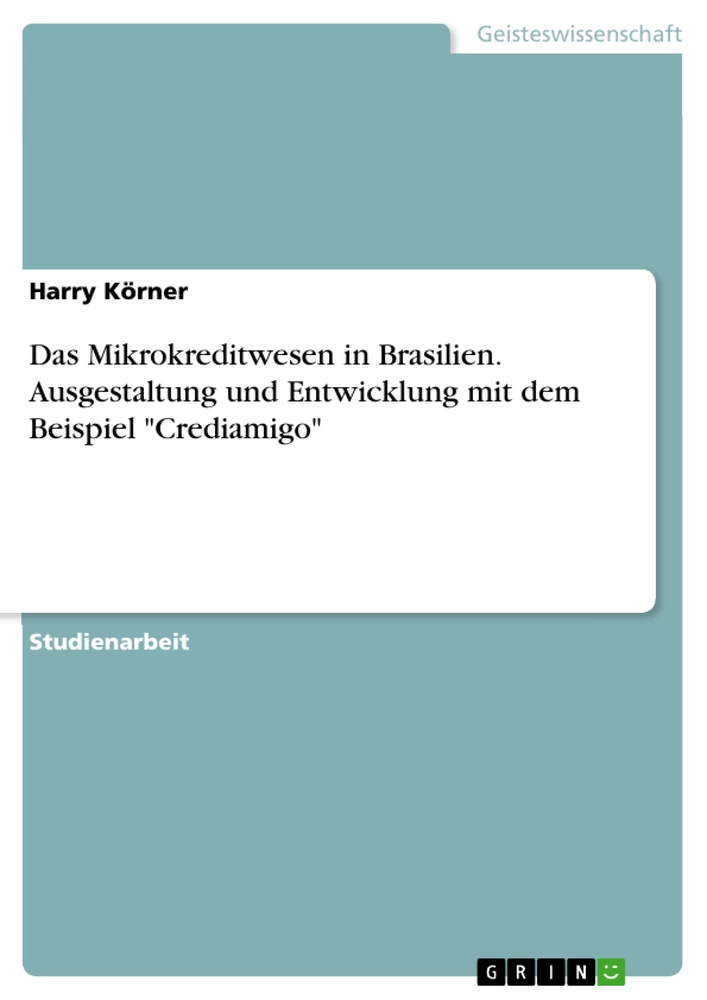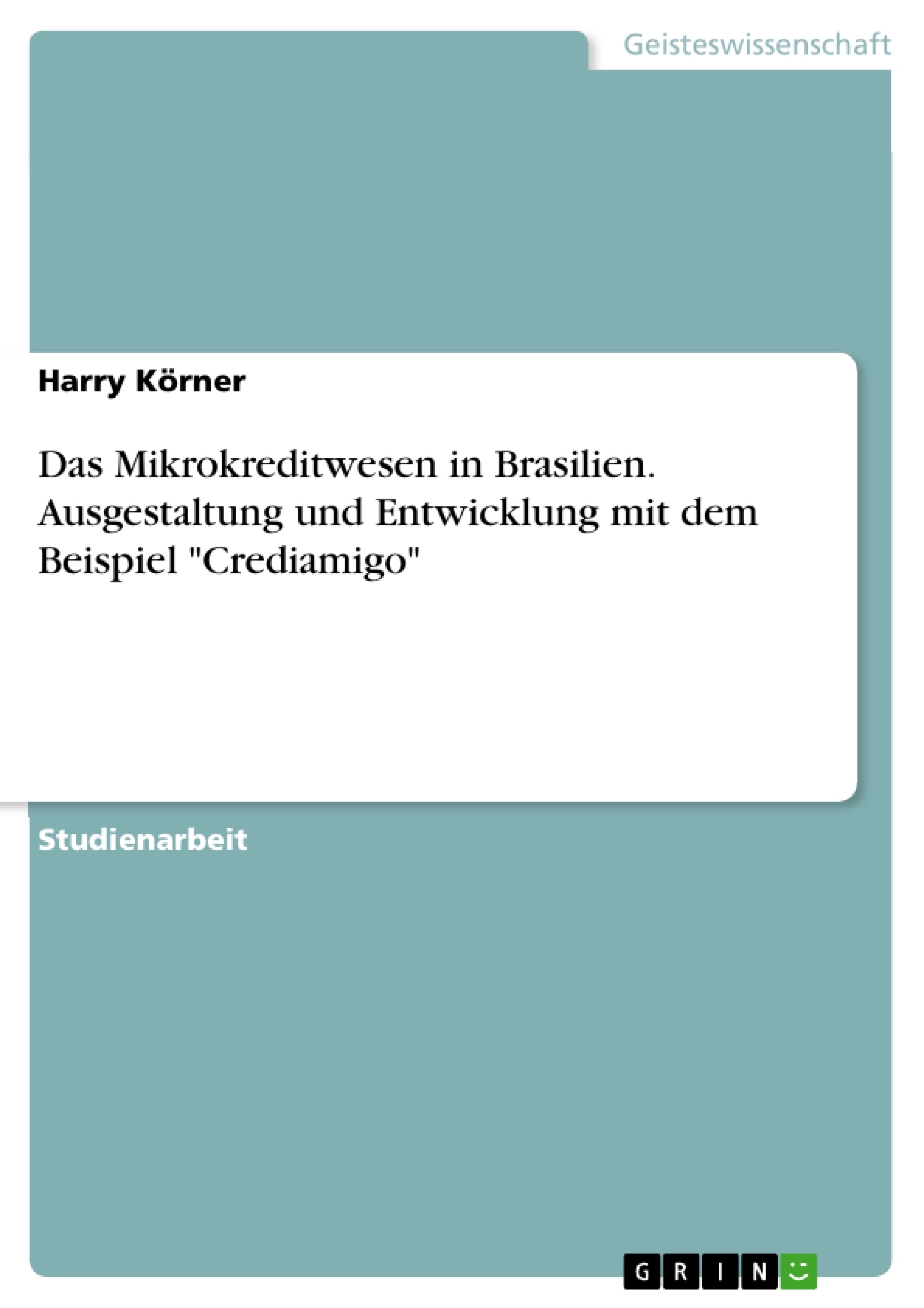Mikrokredite werden von einer breiten, oftmals fachfremden Öffentlichkeit in der Regel als soziale Maßnahme gesehen, welche den Ärmsten der Armen zugute kommt und klar wohlfahrtliche Effekte mit sich bringt und somit überwiegend positiv in ihren Auswirkungen ist. Auch aus der Branche der Mikrofinanz selbst wird diese Ansicht wenig überraschenderweise vertreten, und die anfänglichen Intentionen im Bangladesch der 1970er Jahre waren wohl auch dergestalt.1 Allerdings gibt es ebenfalls viele Stimmen, welche behaupten, durch Mikrokredite würden vergleichsweise ärmere Staaten mit weniger stark ausgebildeten Sozialstaatsstrukturen – im Folgenden Entwicklungsländer genannt – verleitet, sich noch weiter aus dieser Verantwortung zu ziehen und den Mikrofinanzinstituten das Feld bei der Gestaltung allzu produktiver Wohlfahrtstaatsmuster zu überlassen; sowie negative Auswüchse im Gebaren jener Institute anprangern, die durch die Mikrokreditvergabe eigentlich Linderung herstellen sollten.2 Brasilien als mit seinen über 190 Millionen Einwohnern weitaus größtes lateinamerikanisches Land ist in den Sozialwissenschaften seit jeher ob seiner potenziellen Reichtümer, sei es an Menschen, Fläche oder natürlichen Ressourcen, einerseits und seiner paradoxen grassierenden sozialen Ungleichheit andererseits ein Forschungsobjekt von großem Interesse gewesen. Was seine Sozialpolitik angeht, so handelt es sich laut der indisch-US-amerikanischen Politologin Nita Rudra um einen dualen Wohlfahrtsstaat aus einer Mixtur kommodifizierender als auch dekommodifizierender Elemente, wobei Letztere überwiegen, was den schwachen dualen Charakter des brasilianischen Wohlfahrtsregimes konstituiere.3 In dieser Studie untersucht Rudra, wie Brasiliens Sozialpolitik im Zuge des Globalisierungsdrucks reformiert wurde, wobei sie feststellt, dass zwar sowohl partielle Einschnitte in protektiven Schemata stattgefunden haben als auch teilweise verstärkt in produktive investiert worden ist, jedoch wesentliche Eigenheiten des dualen Wohlfahrtssystems prinzipiell unverändert blieben: „Trotzdem bestehen wichtige Elemente institutioneller Kontinuität fort, was das Versagen, höhere Bildung zu verbessern, angeht und die fortgesetzte Priorisierung protektiver Wohlfahrtsschemata, die signifikante Schichtungseffekte haben. Somit sind die hauptsächlichen Problemfelder die folgenden: ...
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der brasilianische schwache duale Wohlfahrtsstaat: Ein Überblick
3 Das brasilianische Mikrokreditwesen
3.1 Politisch-rechtliche Implementierung
3.2 Der wichtigste Akteur im brasilianischen Mikrokreditsektor - Crediamigo
3.2.1 Allgemeines und Ausgestaltung
3.2.2 Die Kreditnehmer
3.2.3 Zugang zum Finanzsektor
4 Fazit
5 Glossar
6 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am brasilianischen Mikrokreditwesen?
Brasilien nutzt Mikrokredite in einem „schwachen dualen Wohlfahrtsstaat“, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen und Menschen ohne Zugang zum klassischen Bankensystem Kredite zu ermöglichen.
Was ist „Crediamigo“?
Crediamigo ist der wichtigste Akteur im brasilianischen Mikrokreditsektor. Es handelt sich um ein Programm, das Kleinstunternehmern hilft, wirtschaftlich unabhängig zu werden.
Wer sind die typischen Kreditnehmer von Mikrokrediten?
Die Kreditnehmer sind meist einkommensschwache Personen oder Kleinstunternehmer, die keine Sicherheiten für traditionelle Bankkredite vorweisen können.
Gibt es Kritik an Mikrokrediten?
Einige Forscher kritisieren, dass Staaten durch Mikrokredite ihre soziale Verantwortung an private Institute abgeben, anstatt echte Wohlfahrtsstrukturen aufzubauen.
Wie hat die Globalisierung Brasiliens Sozialpolitik verändert?
Der Globalisierungsdruck führte zu Reformen, bei denen teilweise protektive Schemata gekürzt und verstärkt in produktive Maßnahmen wie Bildungs- und Kreditprogramme investiert wurde.
- Citar trabajo
- Harry Körner (Autor), 2013, Das Mikrokreditwesen in Brasilien. Ausgestaltung und Entwicklung mit dem Beispiel "Crediamigo", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232760