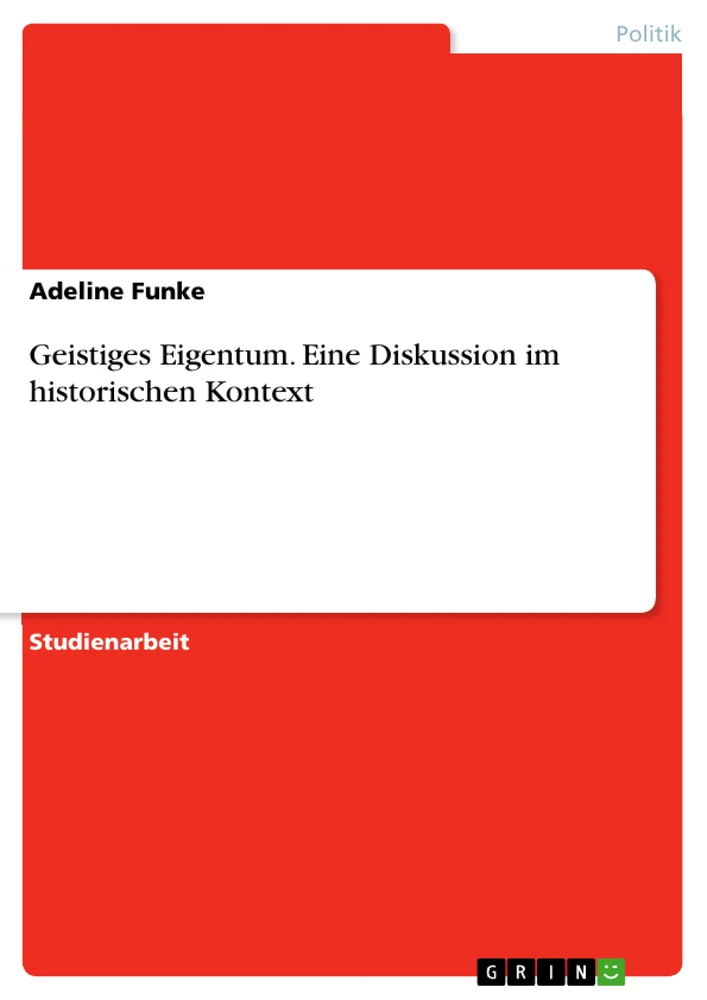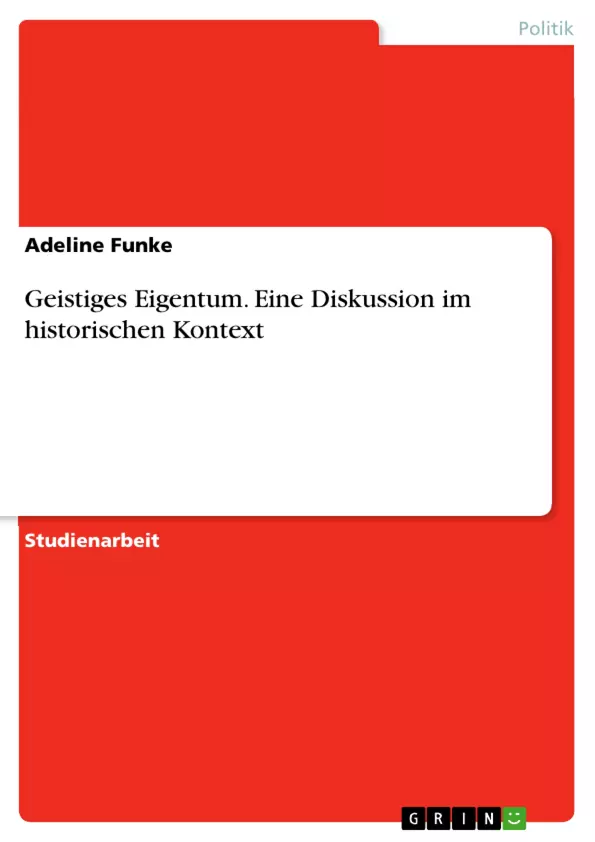Stehen einem Erfinder bzw. Autor per se die Eigentumsrechte an seinen Entwicklungen bzw. Büchern/literarischen Werken zu, oder stellen sie einen so großen gesellschaftlichen Nutzen dar, dass das Recht am Eigentum in den Hintergrund tritt? Dies ist die Hauptfrage, welche in dieser Hausarbeit beleuchtet werden soll. Diese Frage ist natürlich nicht leicht
beantwortbar, da sehr viele Kriterien wirken und verschiedene Perspektiven zu diesem Thema bestehen. Als erstes ist es daher wichtig den theoretischen Rahmen, welcher die Basis für das weitere Verstehen liefert. Dazu erfolgt sowohl die Betrachtung von Ideengeschichtlichen Ansätzen
(Eigentum nach Hobbes und Locke) als auch eine gesonderte Darstellung des Utilitarismus und des Naturrechts. Von ebenso großer Bedeutung sind Kenntnisse über die ökonomische Herangehensweise bezüglich Eigentumsrechten und dem Allmendeproblem.
Abschließend erfolgt im ersten Abschnitt eine kurze Beschreibung des Begriffs „Geistiges Eigentum“.
Des Weiteren besitzt die historische Entwicklung von Geistigem Eigentum eine große Relevanz, da die Wurzeln dieser Bewegung Aufschluss über ihre weitere Entwicklung geben könnten. Im Blickfeld steht sowohl die allgemeine Entwicklung von Geistigem Eigentum als auch die Entwicklungen der unterschiedlichen Bewegungen in England, Frankreich und im deutschsprachigem Raum. Welche Entwicklungen bestehen in der Gegenwart? Zu diesem Punkt, gibt das Kapitel vier Auskunft. Hierzu wird die Wissensgesellschaft und die dazugehörige Problematik vorgestellt. Ein weiterer Punkt zeigt auf, dass Geistiges Eigentum auch als Geistige Monopolrechten angesehen werden können. Abschließend in diesem Teil ergeht eine volkswirtschaftliche
Betrachtung der geistigen Monopolrechte. Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden die internationalen Abkommen zu diesem Thema
kurz erläutert. Das TRIPS-Abkommen steht dabei im Zentrum der Untersuchung. Hier ist nun auch die Frage nach der Position der Entwicklungsländer ein besonderes Thema, welches hier erläutert werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Ideengeschichtliche Ansätze zum Eigentum
- 2.1.1 Der Hobbes'sche Ansatz
- 2.1.2 Der Locke'sche Ansatz
- 2.2 Utilitarismus und Naturrecht
- 2.2.1 Der Utilitarismus
- 2.2.2 Das Naturrecht
- 2.3 Volkswirtschaftliche Ansätze
- 2.3.1 Eigentumsrechte
- 2.3.2 Das Allmende-Problem
- 2.4 Der Begriff „Geistiges Eigentum“
- 2.1 Ideengeschichtliche Ansätze zum Eigentum
- 3 Die Historische Entwicklung von Geistigen Eigentumsrechten
- 3.1 Die Entstehung von Geistigen Eigentumsrechten nach Eckl
- 3.2 Die Entwicklung von Geistigen Eigentumsrechten innerhalb Europas
- 3.2.1 England
- 3.2.2 Frankreich
- 3.2.3 Deutschland und der deutschsprachige Raum
- 4 Die Wissensgesellschaft
- 4.1 Die Problematik der Wissensgesellschaft nach Eckl
- 4.2 Geistige Monopolrechte statt Geistiges Eigentum
- 4.3 Die volkswirtschaftliche Betrachtung von Geistigen Monopolrechten
- 5 Internationale Abkommen zum Geistigen Eigentum
- 5.1 Das TRIPS-Abkommen
- 5.2 Die Position der Entwicklungsländer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Frage, ob einem Erfinder bzw. Autor per se die Eigentumsrechte an seinen Entwicklungen bzw. Büchern/literarischen Werken zustehen, oder ob sie einen so großen gesellschaftlichen Nutzen dartellen, dass das Recht am Eigentum in den Hintergrund tritt. Die Arbeit betrachtet verschiedene Perspektiven auf diese Frage, beginnend mit der Darstellung der Ideengeschichte des Eigentums bei Hobbes und Locke sowie einer Analyse des Utilitarismus und des Naturrechts. Zusätzlich werden volkswirtschaftliche Ansätze zu Eigentumsrechten und dem Allmendeproblem beleuchtet. Im ersten Abschnitt wird der Begriff "Geistiges Eigentum" kurz beschrieben.
- Ideengeschichtliche Ansätze zum Eigentum (Hobbes, Locke)
- Utilitarismus und Naturrecht
- Volkswirtschaftliche Ansätze zum Eigentum
- Historische Entwicklung von Geistigen Eigentumsrechten
- Die Wissensgesellschaft und ihre Problematik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit stellt die Hauptfrage, die im weiteren Verlauf untersucht wird: ob das Recht am Eigentum an geistigen Schöpfungen im Vordergrund steht oder ob der gesellschaftliche Nutzen diese Rechte in den Hintergrund drängt. Es werden zudem die wichtigsten Begriffe und Konzepte eingeführt, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind.
Das zweite Kapitel setzt sich mit dem theoretischen Hintergrund der Eigentumsproblematik auseinander. Es analysiert die Ansätze von Hobbes und Locke, die eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der geistigen Eigentumsrechte spielen. Weiterhin werden der Utilitarismus und das Naturrecht als wichtige Bezugspunkte für die Diskussion um geistiges Eigentum vorgestellt. Der dritte Abschnitt dieses Kapitels behandelt volkswirtschaftliche Ansätze, die sich mit Eigentumsrechten und dem Allmendeproblem befassen. Schließlich wird der Begriff "Geistiges Eigentum" definiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der historischen Entwicklung von geistigen Eigentumsrechten. Es beleuchtet die Entstehung dieser Rechte nach Eckl und die spezifischen Entwicklungen in England, Frankreich und dem deutschsprachigen Raum.
Kapitel vier thematisiert die Wissensgesellschaft und ihre Problematik. Es wird die These aufgestellt, dass geistiges Eigentum in der heutigen Zeit zunehmend als "Geistige Monopolrechte" betrachtet werden kann. Dieser Abschnitt beleuchtet auch die volkswirtschaftliche Betrachtung von geistigen Monopolrechten.
Im fünften und letzten Kapitel werden internationale Abkommen zum Thema geistiges Eigentum, insbesondere das TRIPS-Abkommen, behandelt. Außerdem werden die Positionen der Entwicklungsländer in diesem Kontext erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind "Geistiges Eigentum", "Eigentumsrechte", "Wissensgesellschaft", "Monopolrechte", "Allmendeproblem", "TRIPS-Abkommen" und "Entwicklungsländer". Die Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des Eigentums, der historischen Entwicklung von geistigen Eigentumsrechten, der Problematik der Wissensgesellschaft und der Bedeutung von internationalen Abkommen für die Regulierung von geistigem Eigentum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit zum geistigen Eigentum?
Die Arbeit untersucht, ob Erfindern und Autoren per se Eigentumsrechte an ihren Werken zustehen oder ob der gesellschaftliche Nutzen so groß ist, dass das Individualrecht am Eigentum in den Hintergrund treten muss.
Welche ideengeschichtlichen Ansätze werden im theoretischen Rahmen betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Eigentumstheorien von Thomas Hobbes und John Locke sowie die Perspektiven des Utilitarismus und des Naturrechts.
Was versteht man unter dem Allmendeproblem im Kontext des geistigen Eigentums?
Das Allmendeproblem beschreibt die ökonomische Herausforderung bei der Nutzung von Ressourcen, die allgemein zugänglich sind, und wird hier auf die Verwertung von geistigen Schöpfungen angewendet.
Welche Rolle spielen internationale Abkommen in der Diskussion?
Ein zentraler Punkt der Untersuchung ist das TRIPS-Abkommen, wobei insbesondere die Position und die Problematik der Entwicklungsländer beleuchtet werden.
Warum wird der Begriff „Geistige Monopolrechte“ verwendet?
In der Wissensgesellschaft kann geistiges Eigentum auch als Form von Monopolrechten betrachtet werden, was in der Arbeit volkswirtschaftlich analysiert wird.
- Arbeit zitieren
- Adeline Funke (Autor:in), 2005, Geistiges Eigentum. Eine Diskussion im historischen Kontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232761