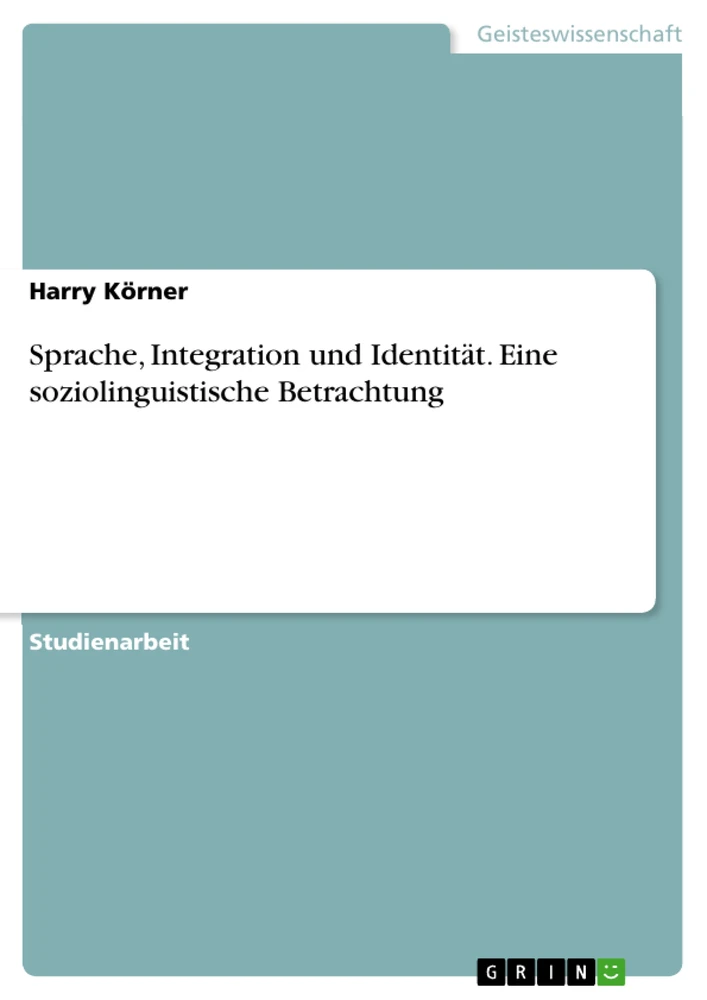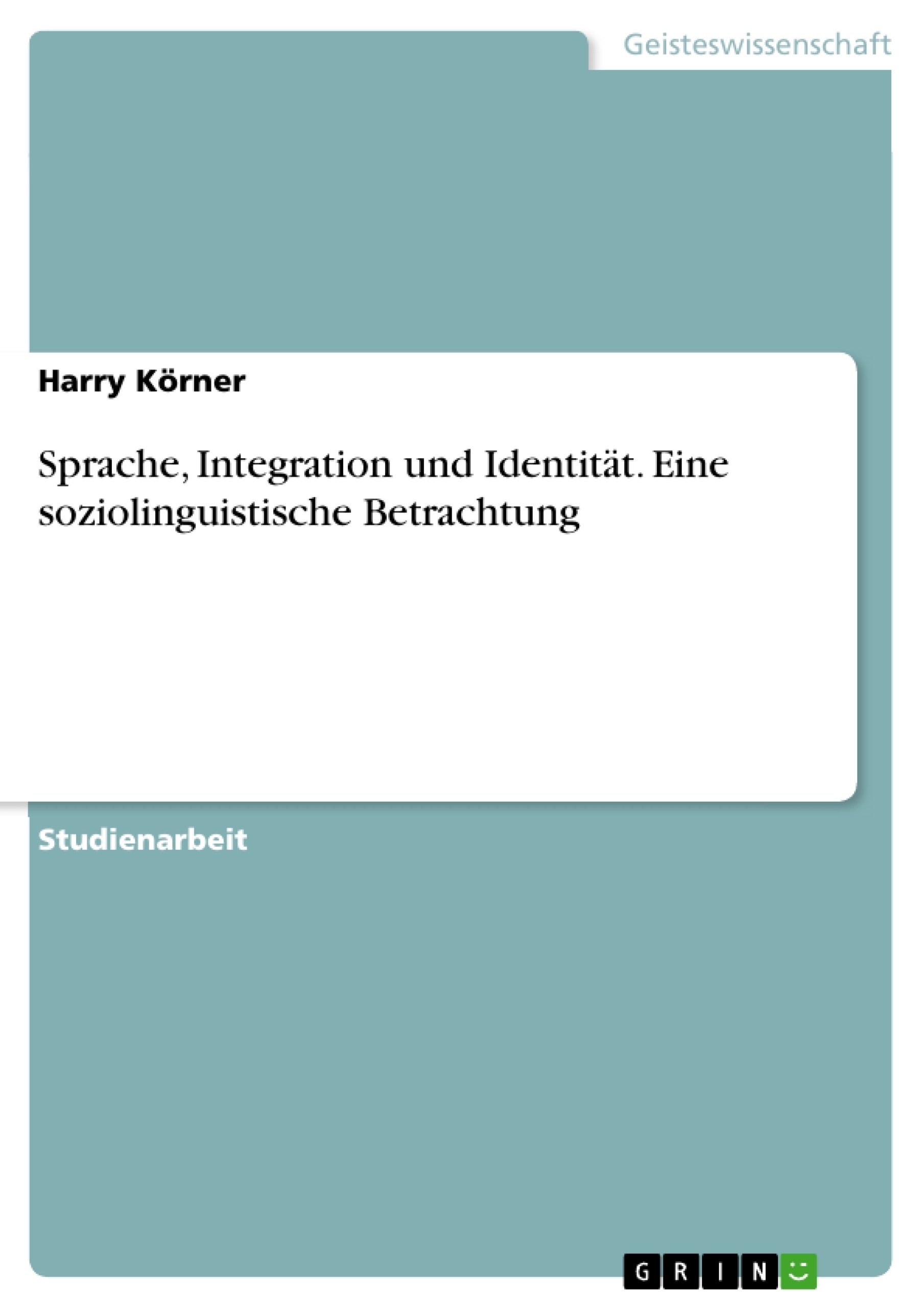In ihrem Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“1, welches in seiner Erstausgabe bereits 1966 auf Englisch erschien, behandeln die beiden deutschsprachigen Autoren Peter L. Berger und Thomas Luckmann in drei Hauptkapiteln verschiedene Aspekte der Sinnwerdung von Realitäten für Individuen und sozialen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft sowie für die Gesellschaft als Ganzes. Hierbei wird hauptsächlich ein Überblick über die Grundlagen von Wissen im Alltag und die Gesellschaft als objektive sowie als subjektive Wirklichkeit gegeben, wobei innerhalb der einzelnen Kapitel verschiedene Teilaspekte abgehandelt werden. So etwa im ersten der drei Hauptkapitel, den Grundlagen, die Thematik, die mit der Sprache bzw. dem daraus generierten Wissen und ihrer Verwendung in der Alltagswelt zu tun hat.2 Hierauf möchte ich in meiner Proseminararbeit näher eingehen: zunächst soll der Inhalt des relevanten Kapitels „Sprache und Wissen in der Alltagswelt“ kurz dargelegt werden, anschließend werde ich mittels verschiedener Thematiken, die direkt mit Sprache zusammenhängen, aus den beiden mehrsprachigen europäischen Ländern Schweiz und Belgien die unterschiedlichen subjektiven wie objektiven Auffassungen der jeweiligen Identitäten dortiger sozialer Kollektive zu ergründen suchen. Im schweizerischen Kontext wird dabei sukzessive auf die linguistische Prägung von Grundschülern in multilingualem Umfeld, durch Migrationsvorgänge hervorgerufene Bilingualität, Fremdarbeiter und deren linguale Assimilation oder Abgrenzung zur Aufnahmegesellschaft und die speziellen Problematiken einer polyglotten Nation überhaupt eingegangen. Was Belgien anbetrifft, so soll hier ebenfalls beispielhaft erläutert werden, wie sich die Sprachverschiebung von Einwanderern und deren Nachwuchs – also auch in Anbetracht des Generationenverhältnisses – auf die Sprecher selbst auswirkt; zunächst am Beispiel italienischer Immigranten in Wallonien, danach mittels eines kurzen Blickes auf junge Türken im Land. Abgerundet werden soll das Ganze noch durch die verschiedenen Identitätskonflikte frankophoner Jugendlicher in den Vereinigten Staaten und die diversen Arten, mit ihnen umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung des Kapitels „Sprache und Wissen in der Alltagswelt“
- Thematiken in der Schweiz
- Grundschüler in Freiburg im Üechtland
- Immigranten in Neuenburg
- Linguistische Anpassung und Abgrenzung
- Die Schweiz als viersprachiges Land
- Thematiken in Belgien
- Italienische Einwandererkinder in Wallonien
- Junge Türken in Belgien
- Kinder französischer Abstammung in den U.S.A.
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Sprache im Kontext von Integration und Identität. Sie analysiert, wie Sprache zur Konstruktion von Wirklichkeit und zur Bildung von sozialen Gruppen beiträgt. Im Fokus stehen dabei die Themen Sprache und Wissen in der Alltagswelt, linguistische Anpassung und Abgrenzung sowie die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit in verschiedenen Gesellschaften.
- Die Rolle von Sprache bei der Konstruktion von Wirklichkeit und Identität
- Die Bedeutung von Sprache im Kontext von Migration und Integration
- Linguistische Anpassung und Abgrenzung als Mittel der Identitätsbildung
- Die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit in verschiedenen Gesellschaften
- Die Rolle von Sprache bei der Weitergabe von Wissen und Erfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Sprache und Wissen in der Alltagswelt“ erläutert, wie Sprache als Mittel der Objektivation zur Konstruktion von Realität beiträgt. Es wird gezeigt, dass Sprache als Zeichen- und Kommunikationssystem nicht nur die subjektiven Empfindungen von Individuen widerspiegelt, sondern auch die gemeinsame Wirklichkeit einer Gesellschaft formt. Sprache schafft „semantische Felder oder Sinnzonen“, die das Verständnis von Sachverhalten und die Interaktion in verschiedenen Kontexten ermöglichen. Der Beitrag geht auch auf die Relevanz von Rezeptwissen im Alltag ein und analysiert, wie Wissen in verschiedenen Vertrautheitsgraden und durch intergenerationale Weitergabe in einer Gesellschaft verbreitet wird.
Die Arbeit untersucht verschiedene Themenbereiche in der Schweiz und Belgien, die die Beziehung zwischen Sprache, Integration und Identität beleuchten. Es wird gezeigt, wie die Sprache von Grundschülern in multilingualem Umfeld, Migranten und Fremdarbeitern die Herausforderungen und Chancen der Integration in mehrsprachigen Gesellschaften widerspiegeln. Die Analyse der Sprachverschiebung von Einwanderern und deren Nachwuchs in Belgien verdeutlicht die Auswirkungen von Migration auf die Identitätsentwicklung und die Sprachgebrauchsgewohnheiten. Die Arbeit betrachtet auch die Identitätskonflikte französischsprachiger Jugendlicher in den USA und die verschiedenen Strategien, mit diesen Konflikten umzugehen.
Schlüsselwörter
Sprache, Integration, Identität, Soziolinguistik, Objektivation, semantische Felder, Mehrsprachigkeit, Migration, Bilingualität, Sprachverschiebung, Identitätskonflikte, Alltagswissen, Rezeptwissen, Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
Häufig gestellte Fragen
Wie trägt Sprache zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit bei?
Sprache dient als Mittel der Objektivation. Sie schafft semantische Felder und Sinnzonen, die es Individuen ermöglichen, Erfahrungen zu teilen und eine gemeinsame Alltagswelt zu formen.
Was ist der Zusammenhang zwischen Sprache und Integration?
Sprache ist ein zentrales Werkzeug der lingualen Assimilation oder Abgrenzung. Sie entscheidet maßgeblich darüber, wie Migranten in eine Aufnahmegesellschaft eingebunden werden.
Welche Herausforderungen bietet die Mehrsprachigkeit in der Schweiz?
Die Arbeit untersucht die linguistische Prägung von Grundschülern und die Problematiken einer polyglotten Nation, in der verschiedene Sprachgruppen ihre Identität behaupten müssen.
Wie wirkt sich Migration auf die Sprachidentität in Belgien aus?
Am Beispiel italienischer und türkischer Einwanderer wird gezeigt, wie Sprachverschiebungen zwischen den Generationen die subjektive Identität der Sprecher verändern.
Was versteht man unter „Rezeptwissen“ im Alltag?
Es handelt sich um pragmatisches Wissen, das in der Alltagswelt als selbstverständlich vorausgesetzt wird und durch Sprache intergenerational weitergegeben wird.
- Citation du texte
- Harry Körner (Auteur), 2008, Sprache, Integration und Identität. Eine soziolinguistische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232771