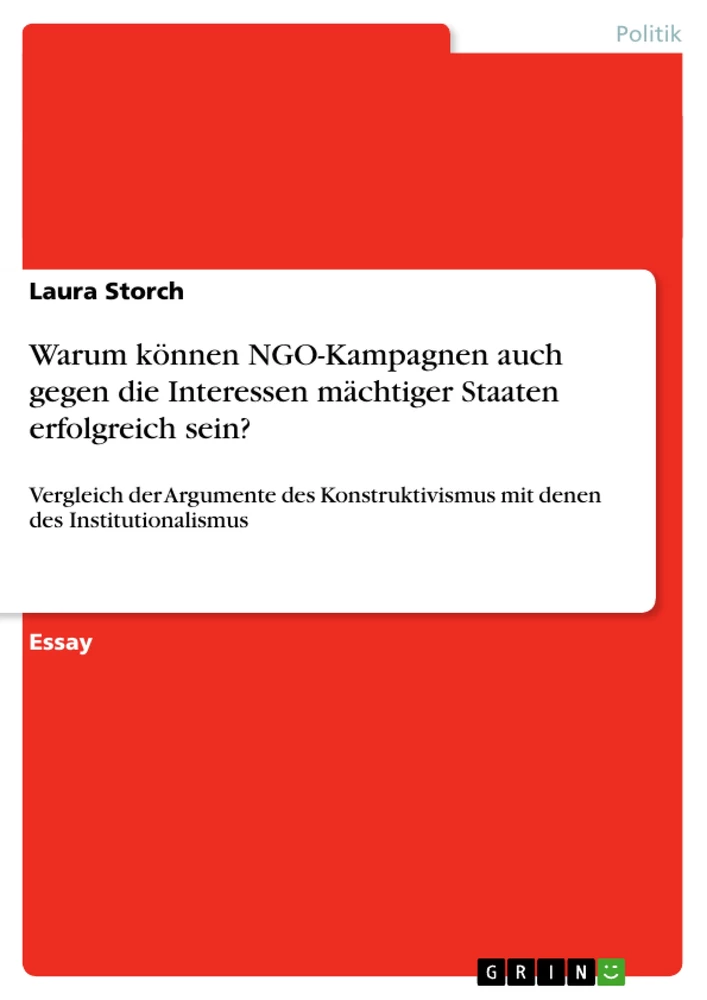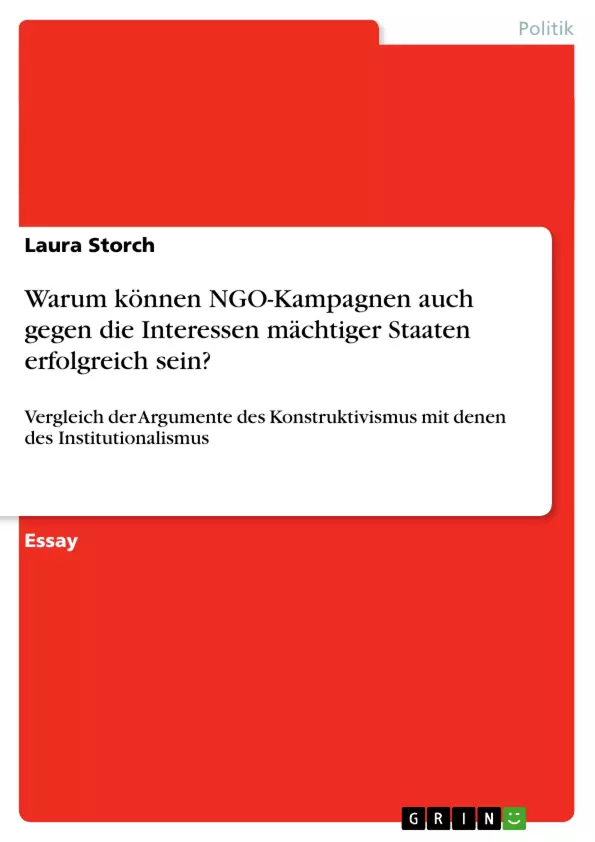Die Hauptakteure im internationalen Geschehen sind die Staaten – „Akteure ohne unmittelbare Persönlichkeit“ (Maull 2000:369). In ihnen bündelt sich zwar ein Großteil, jedoch nicht die ganze soziale Macht:„Traditionell ist der Staat die wichtigste, jedoch keineswegs die einzige Form einer derartigen Bündelung sozialer Macht. Gewicht, Ausmaß und Reichweite der Machtkonzentration hängen von den jeweils verfügbaren Techniken zur Steigerung und Vervielfältigung menschlicher Einwirkungsmöglichkeiten ab“ (ebd.).
Heute ist der Staat nur noch in Ausnahmefällen deckungsgleich mit der Nation, was einen essenziellen Schwachpunkt von Staaten erzeugt, da sie „ihre identitätsstiftende Rolle nur unzureichend auszufüllen vermögen“ (Maull 2000:372). Viele Staaten beharren auf ihren Souveränitätsrechten, was im heutigen Zeitalter einfach nicht mehr auf Dauer umsetzbar ist, da wir in einer globalisierten Welt leben, in der man mit anderen Staaten kooperieren und zum Großteil auf seine Souveränität verzichten muss, „um Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und die Chancen der Beeinflussung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen im eigenen Lande zu verbessern“ (ebd.:373).
Der Soziologe Daniel Bell hat nicht Unrecht mit seiner Aussage, dass der Nationalstaat für „die kleinen Probleme zu groß und für die großen Probleme zu klein“ geworden ist. Es bedarf demnach zwischenstaatlicher Kooperation von grenzüberschreitenden Interdependenzen und der Realisierung von Wohlfahrtspotenzialen: „IGOs können also grundsätzlich überall dort entstehen, wo autonome nationalstaatliche Politiken allein nicht mehr in der Lage sind, nationale Interessen angemessen zu realisieren“ (ebd.: 374).
Die Eigenständigkeit staatlicher Akteure zerfällt zunehmend, staatliche Hoheitsrechte werden auf andere Länder übertragen, es entsteht der „Trend zur Globalisierung“ und die „Forderung nach breiterer Beteiligung der Regierten an der Ausübung von Herrschaft“ (ebd.:375).
Unter NGOs versteht man non-profit Organisationen, die formal unabhängig von staatlichen Kontrollen sind und deklaratorisch Ziele verfolgen, die im Interesse der Öffentlichkeit liegen und die über eine eigene Organisationsstruktur verfügen. Sie fungieren als Sensoren der Gesellschaft, greifen vernachlässigte Themen auf und nutzen der Politik, da sie gesellschaftliche Probleme schon frühzeitig erkennen. [...]
Die Hauptakteure im internationalen Geschehen sind die Staaten –„Akteure ohne unmittelbare Persönlichkeit“( Maull 2000 : 369). In ihnen bündelt sich zwar ein Großteil , jedoch nicht die ganze soziale Macht :„Traditionell ist der Staat die wichtigste, jedoch keineswegs die einzige Form einer derartigen Bündelung sozialer Macht. Gewicht, Ausmaß und Reichweite der Machtkonzentration hängen von den jeweils verfügbaren Techniken zur Steigerung und Vervielfältigung menschlicher Einwirkungsmöglichkeiten ab“(ebd.).
Heute ist der Staat nur noch in Ausnahmefällen deckungsgleich mit der Nation, was einen essenziellen Schwachpunkt von Staaten erzeugt , da sie „ihre identitätsstiftende Rolle nur unzureichend auszufüllen vermögen“(Maull 2000 : 372).Viele Staaten beharren auf ihren Souveränitätsrechten , was im heutigen Zeitalter einfach nicht mehr auf Dauer umsetzbar ist, da wir in einer globalisierten Welt leben , in der man mit anderen Staaten kooperieren und zum Großteil auf seine Souveränität verzichten muss,„um Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und die Chancen der Beeinflussung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen im eigenen Lande zu verbessern“ (ebd. : 373).
Der Soziologe Daniel Bell hat nicht Unrecht mit seiner Aussage, dass der Nationalstaat für „ die kleinen Probleme zu groß und für die großen Probleme zu klein“ geworden ist. Es bedarf demnach zwischenstaatlicher Kooperationvon grenzüberschreitenden Interdependenzen und der Realisierung von Wohlfahrtspotenzialen : „IGOs können also grundsätzlich überall dort entstehen, wo autonome nationalstaatliche Politiken allein nicht mehr in der Lage sind, nationale Interessen angemessen zu realisieren“ (ebd.: 374).
Die Eigenständigkeit staatlicher Akteure zerfällt zunehmend, staatliche Hoheitsrechte werden auf andere Länder übertragen, es entsteht der „Trend zur Globalisierung“ und die „Forderung nach breiterer Beteiligung der Regierten an der Ausübung von Herrschaft“ (ebd.: 375).
Unter NGOs versteht man non-profit Organisationen, die formal unabhängig von staatlichen Kontrollen sind und deklaratorisch Ziele verfolgen, die im Interesse der Öffentlichkeit liegen und die über eine eigene Organisationsstruktur verfügen. Sie fungieren als Sensoren der Gesellschaft, greifen vernachlässigte Themen auf und nutzen der Politik, da sie gesellschaftliche Probleme schon frühzeitig erkennen. Durch ihre weiträumigen Netzwerke und die Präsenz vor Ort können sie Entwicklungen und Fehlentwicklungen unabhängig beobachten. Sie sind Teil einer zunehmend vernetzten, zwischen Staat und Markt angesiedelten Zivilgesellschaft. Sie sind „Akteure der privaten Sphäre“ (Franz/Martens 2006: 24) und „verfolgen primär immaterielle ( und daher nicht profit- orientierte Ziele)“(ebd.).. Das erwirtschaftete Geld muss der „Zielorientierung der Organisationen zu Gute kommen“, denn „wäre dies nicht gewährleistet, würde betroffenen NGOs […] die Gemeinnützigkeit entzogen und sie würden wie profitorientierte Unternehmen steuerlich belastet.“(ebd.).Sie vertreten das Wohl der Allgemeinheit und setzen sich für andere ein, indem sie durch„Unterschriften, Geldspenden, ehrenamtlichen Einsatz etc. unterstützt werden.“ (ebd.).
NGOs besitzen heut zu Tage einen professionalisierten und „festen Stab von bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und operieren keineswegs nur über Freiwillige oder Freizeitaktivisten“(Franz/Martens 2006: 26). Die Gelder, welche die NGOs erwirtschaften müssen „uneingeschränkt in die NGO zurückfließen und ausschließlich für die Arbeit der NGO genutzt werden“ (ebd.), „sie tragen sich allein aus eigenen Mitteln […] und nehmen keine öffentlichen Gelder an. Sie sind aufgrund zivilgesellschaftlicher Initiative entstanden und nicht durch staatliche Aktivität oder staatlichen Anreiz.“(ebd.: 40,41).
Der Bedeutungszuwachs von NGOs beruht auf ihrer Sachkompetenz, ihrer hohen Motivation und dem selbstlosen Idealismus, der die Nichtregierungsorganisationen zum Hoffnungsträger vieler Menschen macht. NGOs haben keine staatlichen Mitglieder, sondern setzen sich aus Privatpersonen und Individuen zusammen. Als private Organisationen stehen sie „nicht unter der Kontrolle von Regierungen, sind also auch finanziell und moralisch unabhängig von ihnen und werden stattdessen nur von ihren eigenen Zielen geleitet.“ (ebd.: 27).
Ihr Ziel ist es nicht etwa „staatliche Macht“ (ebd.) zu erlangen, sondern Einfluss auf die Politik auszuüben. „NGOs sind formale (professionalisierte), unabhängige gesellschaftliche Akteure, deren Ziel es ist, progressiven Wandel und soziale Anliegen auf der nationalen oder der internationalen Ebene zu fördern“ (ebd.: 49-50).Dadurch, dass sie das Wort „Organisation“ beinhalten, unterscheiden sie sich von sozialen Bewegungen, wie z.B. Protesten, da sie nicht nur vorübergehend existieren, sondern von längerer Dauer sind.
Trotzdem konnte bis heute keine „umfassende und allseits anerkannte internationale rechtliche Grundlage für NGOs gefunden werden“ (ebd.: 31).
Die Erfolge der NGOs in der internationalen Politik beruhen auf der Fähigkeit andere mit ihrem Handeln zu überzeugen und„zahlreiche Individuen für gemeinsame Zielvorstellungen zu mobilisieren“(Maull 2006 :383).NGOs übernehmen immer öfter operative Aufgaben in UN- Friedensmissionen, insbesondere in dem immer wichtiger werdenden Bereich der humanitären Hilfe, Menschenrechte und Umweltschutz. UNESCO, UNICEF und die WHO haben eigens Kommunikationskanäle für eine direkte Zusammenarbeit mit den NGOs geschaffen. Sie werden entweder als ziviler Partner oder als strikter Gegner von staatlichen Akteuren angesehen. Man unterscheidet zwischen operativen NGOs , die konkrete Arbeit vor Ort verrichten (Katastrophenhilfe, Nothilfe, Jugend- und Sozialarbeit) und public policy NGOs , die oft durch öffentliche Initiativen und Kampagnen Einfluss auf die politische Agenda, die Problemwahrnehmung und die Entscheidungen nehmen ( z.B. durch Lobbying, Monitoring, advocacy oder Sensibilisierung für Normen bzw. Aufklärung). So fließen Zielsetzungen der NGOs wie ökologische Nachhaltigkeit, Demokratie und soziale Mindeststandards heute sogar in Investitionsentscheidungen mit ein.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum sind NGOs in der globalisierten Welt so erfolgreich?
NGOs agieren als „Sensoren der Gesellschaft“. Ihr Erfolg beruht auf Sachkompetenz, hoher Motivation und der Fähigkeit, Individuen weltweit für gemeinsame Ziele zu mobilisieren.
Was unterscheidet NGOs von Staaten?
Während Staaten oft an Souveränitätsrechten festhalten, sind NGOs private, non-profit Organisationen, die finanziell und moralisch unabhängig von Regierungen agieren.
Können NGOs mächtige Staaten beeinflussen?
Ja, durch Kampagnen, Lobbying und die Sensibilisierung für Normen (z.B. Umweltschutz, Menschenrechte) können sie die politische Agenda von Staaten maßgeblich mitgestalten.
Was ist der Unterschied zwischen operativen und Public Policy NGOs?
Operative NGOs leisten konkrete Hilfe vor Ort (z.B. Katastrophenhilfe), während Public Policy NGOs durch Öffentlichkeitsarbeit und Monitoring politischen Einfluss ausüben.
Wie finanzieren sich NGOs?
Echte NGOs tragen sich aus eigenen Mitteln wie Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Um ihre Unabhängigkeit zu wahren, nehmen viele keine öffentlichen Gelder an.
Welche Rolle spielen NGOs bei den Vereinten Nationen (UN)?
Organisationen wie UNICEF oder die WHO haben eigene Kanäle für die Zusammenarbeit mit NGOs geschaffen, die oft operative Aufgaben in Friedensmissionen übernehmen.
- Quote paper
- Laura Storch (Author), 2012, Warum können NGO-Kampagnen auch gegen die Interessen mächtiger Staaten erfolgreich sein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232934