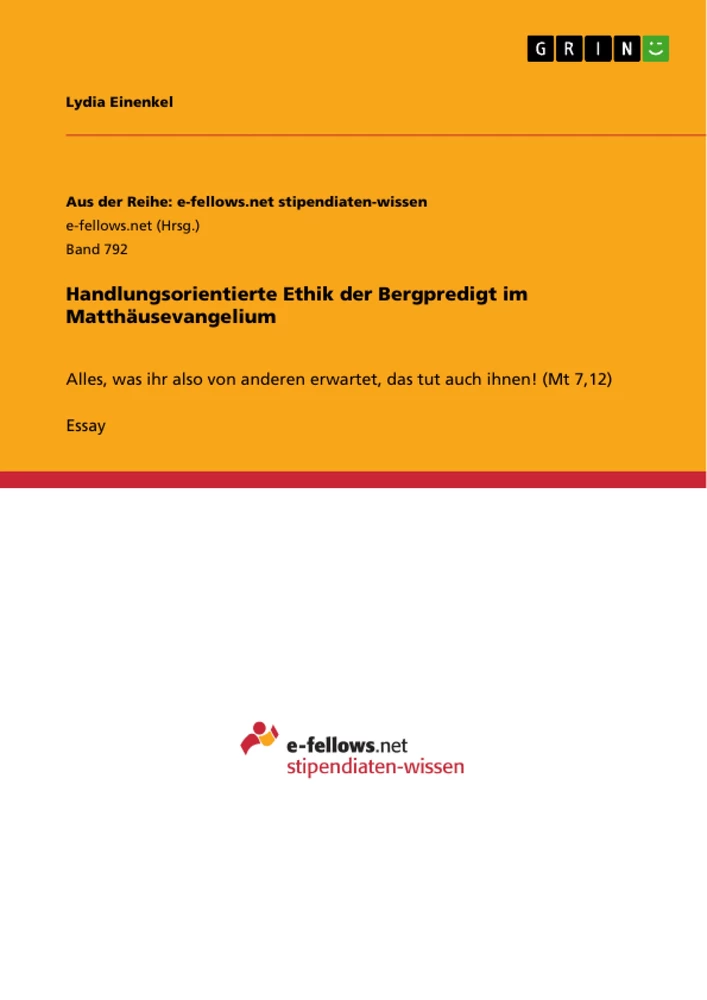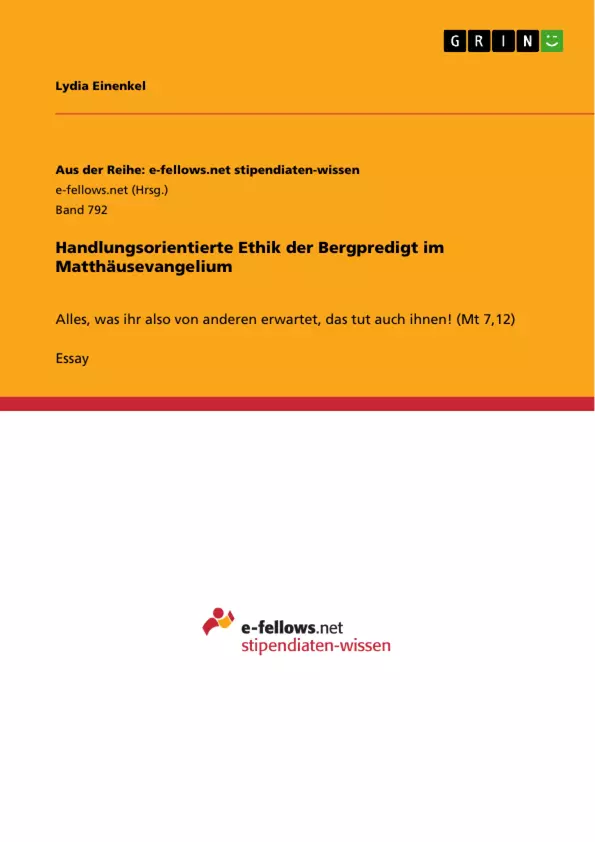Die Bergpredigt gibt als einer der bekanntesten neutestamentarischen Texte vielerlei Anlass zur kritischen Auseinandersetzung. Dieses Essay konzentriert sich auf die ethischen Aspekte und die (Un-)Möglichkeit von deren allgemeingesellschaftliche Anwendung in der Gegenwart.
Ein Grundgedanke dieser ethisch orientierten Arbeit ist das bewusste Ignorieren bibelexegetischer Methoden. Es soll auf explizite exegetische Überlegungen, soweit wie möglich, bewusst verzichtet werden, da das Wissen um die Genese und der redaktionellen Zusammenstellung der Berglehre für das gewählte Thema zunächst unerheblich ist. Ob Jesus von Nazareth einzelne Aussprüche von Mt 5-7 tatsächlich so gesagt hat, sollte bezüglich der Frage, welche praktischen Konsequenzen die Berglehre im Leben eines Gläubigen hat, keine veränderte Betrachtungsweise hervorrufen. „Die historisch kritische Unterscheidung von Textschichten mag für die wissenschaftliche Schulung junger Theologen wichtig sein, aber nicht zwingend für die Schule des Lebens.“
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
3. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Bergpredigt gibt als einer der bekanntesten neutestamentarischen Texte vielerlei Anlass zur kritischen Auseinandersetzung. Im Folgenden werde ich mich auf die ethischen Aspekte und deren allgemeingesellschaftliche Anwendung in der Gegenwart konzentrieren, d.h. auf politische Betrachtungsweisen[1] kann nicht eingegangen werden.
Zudem soll auf explizite exegetische Überlegungen, soweit wie möglich, bewusst verzichtet werden, da das Wissen um die Genese und der redaktionellen Zusammenstellung der Berglehre[2] für das gewählte Thema zunächst unerheblich ist. Ob Jesus von Nazareth einzelne Aussprüche von Mt 5-7 tatsächlich so gesagt hat, sollte bezüglich der Frage, welche praktischen Konsequenzen die Berglehre im Leben eines Gläubigen hat, keine veränderte Betrachtungsweise hervorrufen. „Die historisch kritische Unterscheidung von Textschichten mag für die wissenschaftliche Schulung junger Theologen wichtig sein, aber nicht zwingend für die Schule des Lebens.“[3]
2. Hauptteil
Zwar kann hier nicht im Einzelnen auf die Rezeptionsgeschichte der Berglehre eingegangen werden,doch soll zur eindeutigeren Themenabgrenzung kurz genannt werden, auf welche Auslegungstraditionen sich nicht bezogen wird. So werden Deutungen wie Interimsethik oder eine radikale Gesinnungsethik, zugunsten einer Betrachtungsweise der Berglehre als grundsätzlich erfüllbar, abgelehnt. Ebenso soll auch Luthers Zwei Reiche Lehre oder eine Differenzierung zwischen Berufschrist und Laienchrist im Sinne einer „Zweiklassenkirche“[4] nicht beachtet werden, da hier davon ausgegangen wird, dass sich die Rede Jesu grundsätzlich an alle Christen richtet.„Das Volk Gottes im Reich Gottes ist keine hervorgehobene Elite, sondern umfasst die Masse der Schicksale, die überall anzutreffen sind.“[5]
Wie sollen also die teils sehr radikalen Anweisungen aufgenommen oder gar umgesetzt werden? Ist es nicht realistischer anzunehmen, dass der Evangelist in Anbetracht der überhöhten Ansprüche gar nicht an eine tatsächliche Umsetzung dachte? Man findet in der Berglehre häufig Aufforderungen zu einer konkreten Handlung, die zwar exemplarisch aber nicht bildlich zu verstehen sind. „Christsein ist für Matthäus immer Bekenntnis durch die Tat“[6]. Aussagen, die sich auf eine bestimmte Tat beziehen, finden sich sowohl in den Makarismen, im Herrengebet, als auch in den sogenannten Antithesen, d.h. sie bestimmen die gesamte Bergpredigt.
[...]
[1] z.B. H. Schmidt und M. Weber sahen die Bergpredigt als politisch irrelevant. Vgl. W. Schoberth, Die bessere Gerechtigkeit und realistischere Politik. Ein Versuch zur politischen Ethik, in R. Feldmeier (Hg.), Salz der Erde. Zugänge zur Bergpredigt, Göttingen 1998, S. 108- 113.
[2] Zum Begriff Berglehre: Mt 5,2 „und lehrte sie“.
[3] M. Köhnlein, Die Bergpredigt, Stuttgart 2005, S. 26.
[4] M Stiewe/ F. Vouga, Die Bergpredigt und ihre Rezeption. Als kurze Darstellung des Christentums, Tübingen und Basel 2001, S. 21.
[5] M. Köhnlein, Die Bergpredigt, Stuttgart 2005, S. 15.
[6] R. Feldmeier, Verpflichtende Gnade. Die Bergpredigt im Kontext des ersten Evangeliums, in R. Feldmeier (Hg.), Salz der Erde. Zugänge zur Bergpredigt, Göttingen 1998, S.29.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt dieses Essays zur Bergpredigt?
Der Fokus liegt auf der handlungsorientierten Ethik und der Frage nach der Umsetzbarkeit ihrer radikalen Forderungen in der heutigen Gesellschaft.
Warum verzichtet der Autor bewusst auf bibelexegetische Methoden?
Weil die Entstehungsgeschichte des Textes für die Frage nach den praktischen Konsequenzen im Leben eines Gläubigen als unerheblich angesehen wird.
Wird die Bergpredigt als erfüllbar angesehen?
Ja, Interpretationen wie die Interimsethik oder eine reine Gesinnungsethik werden zugunsten einer grundsätzlichen Erfüllbarkeit für alle Christen abgelehnt.
Was bedeutet „Bekenntnis durch die Tat“ bei Matthäus?
Es bedeutet, dass Christsein für den Evangelisten untrennbar mit konkretem Handeln und der Umsetzung der Lehre im Alltag verbunden ist.
Gilt die Bergpredigt nur für eine religiöse Elite?
Nein, die Arbeit geht davon aus, dass sich die Rede Jesu an alle Christen richtet und keine „Zweiklassenkirche“ legitimiert.
- Citar trabajo
- M.Phil Lydia Einenkel (Autor), 2008, Handlungsorientierte Ethik der Bergpredigt im Matthäusevangelium, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232946