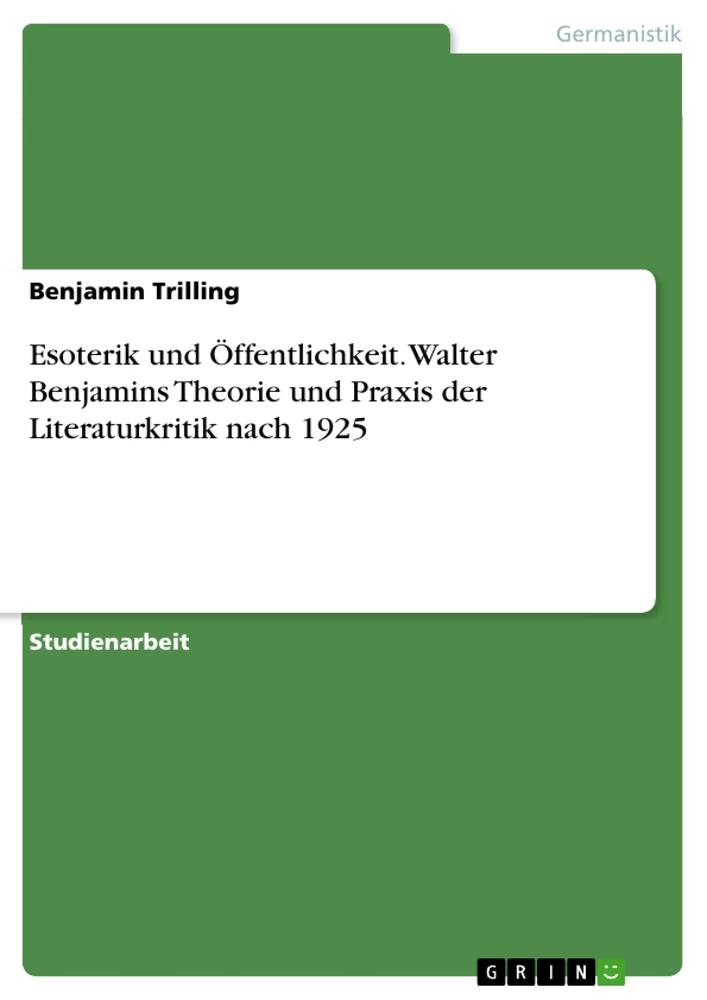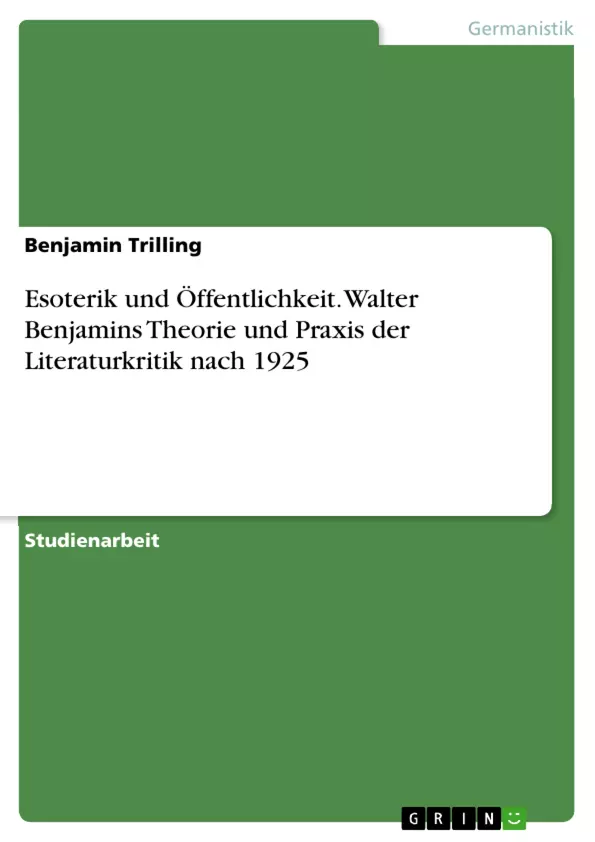Walter Benjamin schrieb in den 1920 bis zu seiner Emigration für verschiedene Tageszeitungen Literaturkritiken.
Sein Ruf als Literaturkritiker ist aber nicht unbestritten. Vor allem Marcel Reich-Ranicki kritisierte, dass Walter Benjamin ein schlechter Literaturkritiker war.
Diese Arbeit stellt zunächst die sozialhistorischen Bedingungen der literaturkritischen Öffentlichkeit dar, die für ein Verständnis der Literaturkritik Walter Benjamins, in der Prämissen der Romantik aufgeknüpft und im Kontext einer "Politisierung der Intelligenz" umfunktionalisiert werden, unerlässlich sind. Trotz seiner Hinwendung zum Marxismus bleibt Benjamins esoterischer Gestus evident, sodass anschließend Benjamins grundlegender geschichtsphilosophischer, erkenntnistheoretischer und selbstreflexiver Modus der Literaturkritik analysiert wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Die Bedingungen der Literaturkritik. Die Krise der Kritik als Kritik der Krise
2.2 „[D]ie erkenntnismafiige Verwertung von Buchem“. Der erkenntnistheoretische Gehalt der Kritik
2.3 „Funktionale Kritik“: Literaturkritik als Selbstverstandigung der literarischen Intelligenz
2.4 „Magische Kritik“: Die Berucksichtigung des historischen Gehalts der Werke in der Kritik
3. Schluss
4. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie bewertete Marcel Reich-Ranicki die Literaturkritik von Walter Benjamin?
Reich-Ranicki kritisierte Benjamin scharf und bezeichnete ihn als einen schlechten Literaturkritiker.
Was versteht Benjamin unter „magischer Kritik“?
Dieser Modus berücksichtigt den historischen Gehalt der Werke und verknüpft ihn mit geschichtsphilosophischen Erkenntnissen.
Welchen Einfluss hatte der Marxismus auf Benjamins Kritiken?
Trotz seiner Hinwendung zum Marxismus nach 1925 behielt Benjamin einen oft „esoterischen“ Gestus in seinen Texten bei.
Was bedeutet die „Politisierung der Intelligenz“ in diesem Kontext?
Es beschreibt den Prozess, in dem literarische Kritik als Mittel der gesellschaftlichen Selbstverständigung und politischen Positionierung genutzt wurde.
Für welche Medien schrieb Walter Benjamin in den 1920er Jahren?
Benjamin verfasste Literaturkritiken für verschiedene namhafte Tageszeitungen bis zu seiner Emigration.
- Quote paper
- Benjamin Trilling (Author), 2013, Esoterik und Öffentlichkeit. Walter Benjamins Theorie und Praxis der Literaturkritik nach 1925, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232956