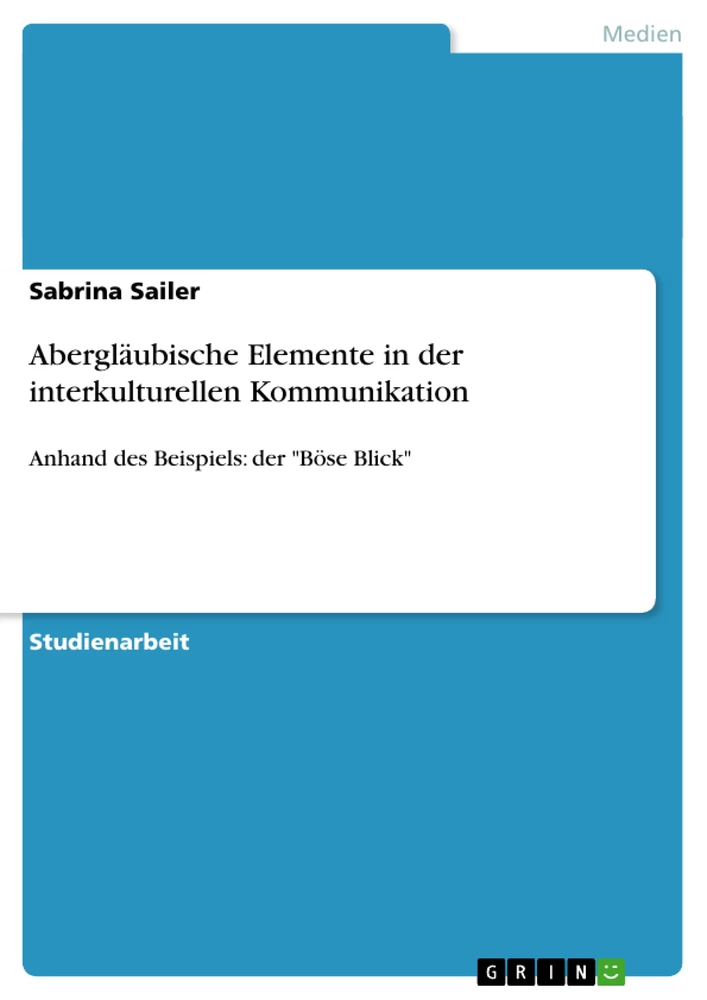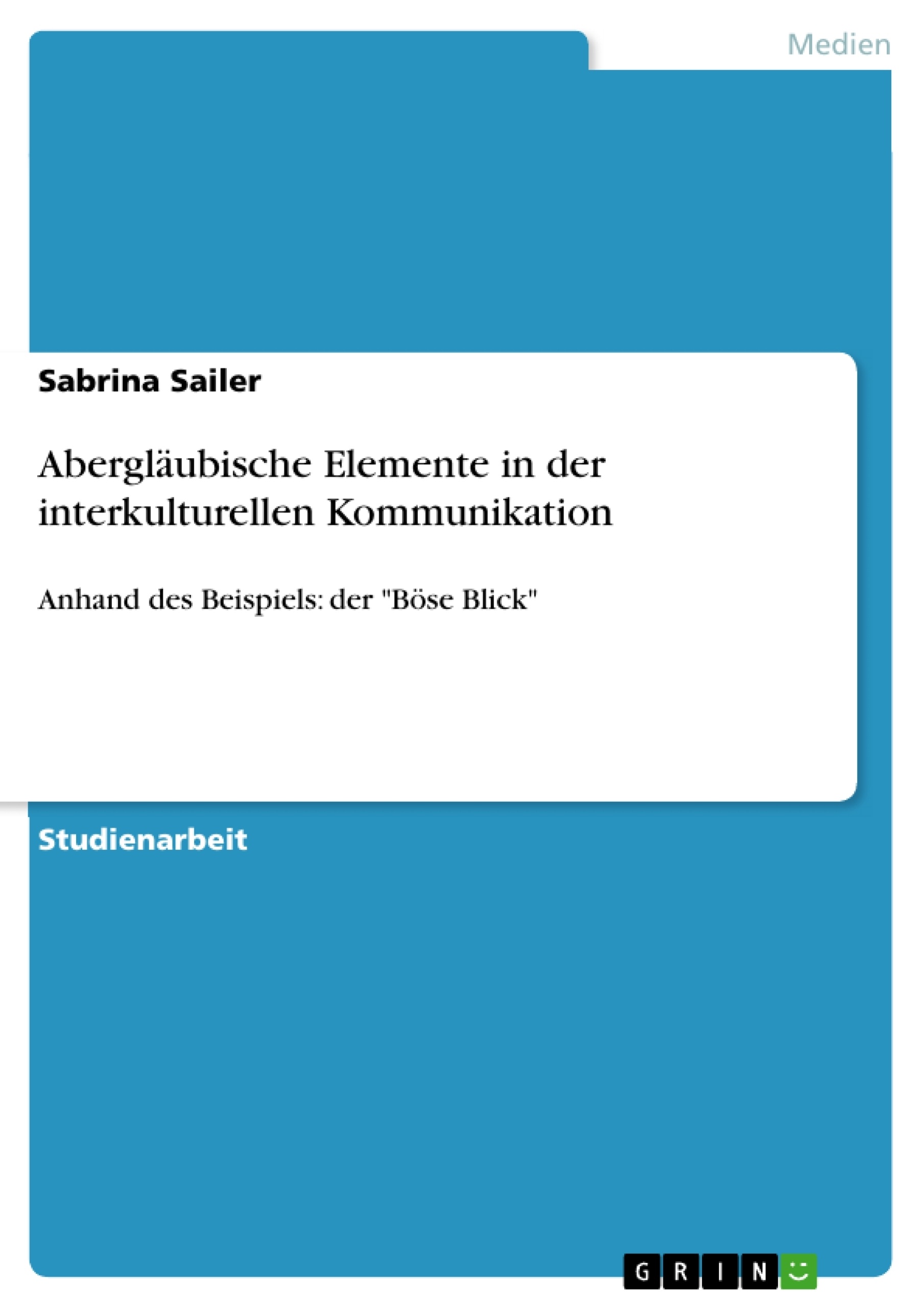Auf Holz klopfen, nachts kein Wasser vor die Türe schütten, die
Handtasche keinesfalls in der Straßenbahn auf den Boden stellen: Beispiele
dafür, woran ein Mensch Glück oder Unglück festzumachen versucht. Jede
Kultur und jede Epoche kennt dabei eigene Versionen eines
„Aberglaubens“.
In der interkulturellen Kommunikation ist das kein Humbug, sondern ein wichtiger Bestandteil der Forschung. Anhand des "bösen Blicks" lässt sich die Relevanz im aufgeklärten Alltag des mittleren Europas nachvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegung - Umgrenzung
- Beispiele für abergläubische Elemente
- Der Böse Blick (Beispiele + Abwehr)
- Erklärung und Herkunft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht abergläubische Elemente in der interkulturellen Kommunikation, wobei der „Böse Blick“ als zentrales Beispiel dient. Ziel ist es, Aberglauben zu definieren, seine Manifestationen in verschiedenen Kulturen (Deutschland, Türkei, Italien, Griechenland) zu beleuchten und die kulturellen Wurzeln dieser Glaubensvorstellungen zu analysieren. Die Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation werden ebenfalls betrachtet.
- Definition und Abgrenzung von Aberglauben
- Kulturelle Unterschiede im Aberglauben
- Der „Böse Blick“ als Beispiel interkulturellen Aberglaubens
- Historische und kulturelle Wurzeln des Aberglaubens
- Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema abergläubische Elemente in der interkulturellen Kommunikation ein und benennt den „Bösen Blick“ als zentralen Fokus. Sie umreißt den Forschungsansatz, der die Definition von Aberglauben, die Darstellung von Beispielen aus verschiedenen Kulturen und die Analyse der kulturellen Wurzeln umfasst. Die Arbeit wird auf die Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation eingehen und benennt die zentralen Quellen.
Vorüberlegung - Umgrenzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Überlieferung von Aberglauben. Es wird die historische Entwicklung des Begriffs „Aberglaube“ beleuchtet, beginnen mit der ursprünglichen lateinischen Bedeutung bis zu seiner heutigen Konnotation im Gegensatz zur wissenschaftlichen Rationalität. Der Text veranschaulicht mit dem Beispiel des Knoblauchs als Vampirschutz die oft unbewussten Wurzeln und die Übertragung von Wissen und Glauben. Die unterschiedlichen Perspektiven auf Aberglauben in verschiedenen Kulturen werden angedeutet.
Beispiele für abergläubische Elemente: Dieses Kapitel präsentiert Beispiele für abergläubische Elemente aus verschiedenen Kulturen, mit einem Schwerpunkt auf dem „Bösen Blick“. Es werden konkrete Beispiele und deren Abwehrmechanismen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten vorgestellt. Das Kapitel dient als empirische Basis für die spätere Analyse der kulturellen Hintergründe.
Erklärung und Herkunft: Dieses Kapitel geht auf die Ursachen und historischen Hintergründe des Aberglaubens, insbesondere des „Bösen Blicks“, ein. Es analysiert die Wurzeln verschiedener Volksglauben und untersucht deren Entwicklung im Laufe der Zeit. Die Analyse wird die kulturellen und historischen Zusammenhänge aufzeigen, die zu diesen Glaubensvorstellungen geführt haben.
Schlüsselwörter
Aberglaube, interkulturelle Kommunikation, Volksglaube, „Böser Blick“, Kulturvergleich, historische Wurzeln, wissenschaftliche Rationalität, magisches Wissen, interkulturelle Missverständnisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Abergläubische Elemente in der Interkulturellen Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht abergläubische Elemente in der interkulturellen Kommunikation, wobei der „Böse Blick“ als zentrales Beispiel dient. Sie analysiert Aberglauben, seine Manifestationen in verschiedenen Kulturen (Deutschland, Türkei, Italien, Griechenland) und die kulturellen Wurzeln dieser Glaubensvorstellungen. Die Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation werden ebenfalls betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Aberglauben, kulturelle Unterschiede im Aberglauben, der „Böse Blick“ als Beispiel interkulturellen Aberglaubens, historische und kulturelle Wurzeln des Aberglaubens und die Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung: Einführung in das Thema und Forschungsansatz. Vorüberlegung - Umgrenzung: Entstehung und Überlieferung von Aberglauben, historische Entwicklung des Begriffs und unterschiedliche kulturelle Perspektiven. Beispiele für abergläubische Elemente: Beispiele aus verschiedenen Kulturen, Schwerpunkt „Böse Blick“ und Abwehrmechanismen. Erklärung und Herkunft: Ursachen und historische Hintergründe des Aberglaubens, insbesondere des „Bösen Blicks“, Analyse der kulturellen und historischen Zusammenhänge. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche konkreten Beispiele für Aberglauben werden genannt?
Ein zentrales Beispiel ist der „Böse Blick“, sowie weitere Beispiele abergläubischer Elemente aus verschiedenen Kulturen (Deutschland, Türkei, Italien, Griechenland), inklusive deren Abwehrmechanismen. Das Beispiel Knoblauch als Vampirschutz wird zur Veranschaulichung der Übertragung von Wissen und Glauben verwendet.
Welche kulturellen und historischen Hintergründe werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die historischen Wurzeln des Begriffs „Aberglaube“, beginnend mit der lateinischen Bedeutung bis zur heutigen Konnotation. Sie analysiert die kulturellen und historischen Zusammenhänge, die zu den untersuchten Glaubensvorstellungen geführt haben, insbesondere beim „Bösen Blick“.
Welche Auswirkungen auf die interkulturelle Kommunikation werden beleuchtet?
Die Arbeit untersucht, wie Aberglauben und unterschiedliche Glaubensvorstellungen zu interkulturellen Missverständnissen führen können. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen dieser kulturellen Unterschiede auf die Kommunikation zwischen Menschen verschiedener Kulturen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aberglaube, interkulturelle Kommunikation, Volksglaube, „Böser Blick“, Kulturvergleich, historische Wurzeln, wissenschaftliche Rationalität, magisches Wissen, interkulturelle Missverständnisse.
- Quote paper
- Sabrina Sailer (Author), 2009, Abergläubische Elemente in der interkulturellen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233021