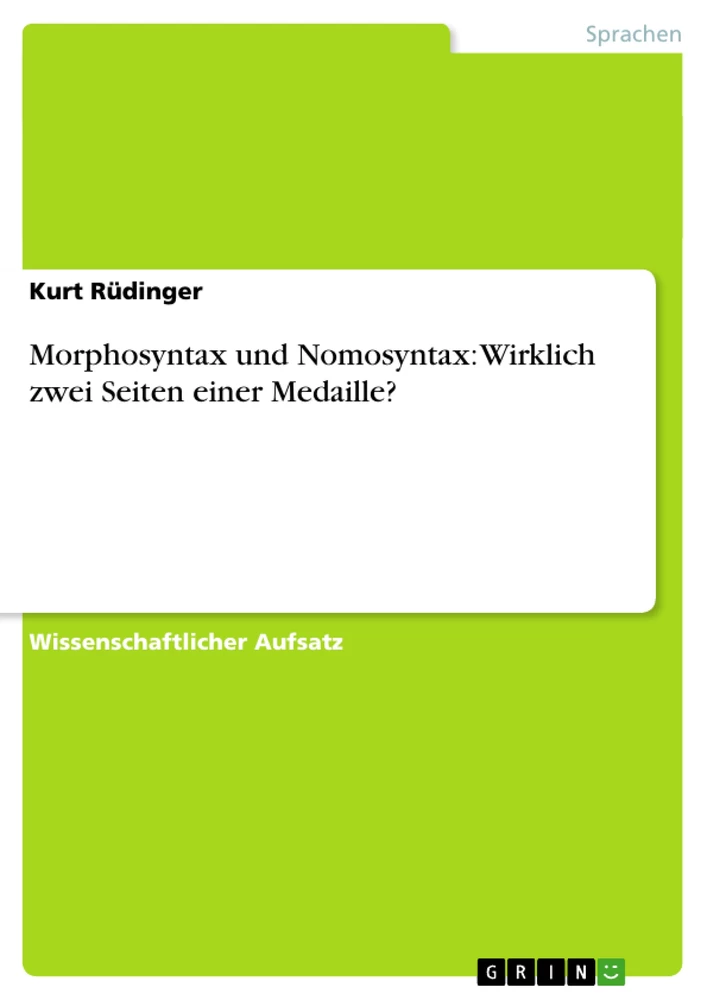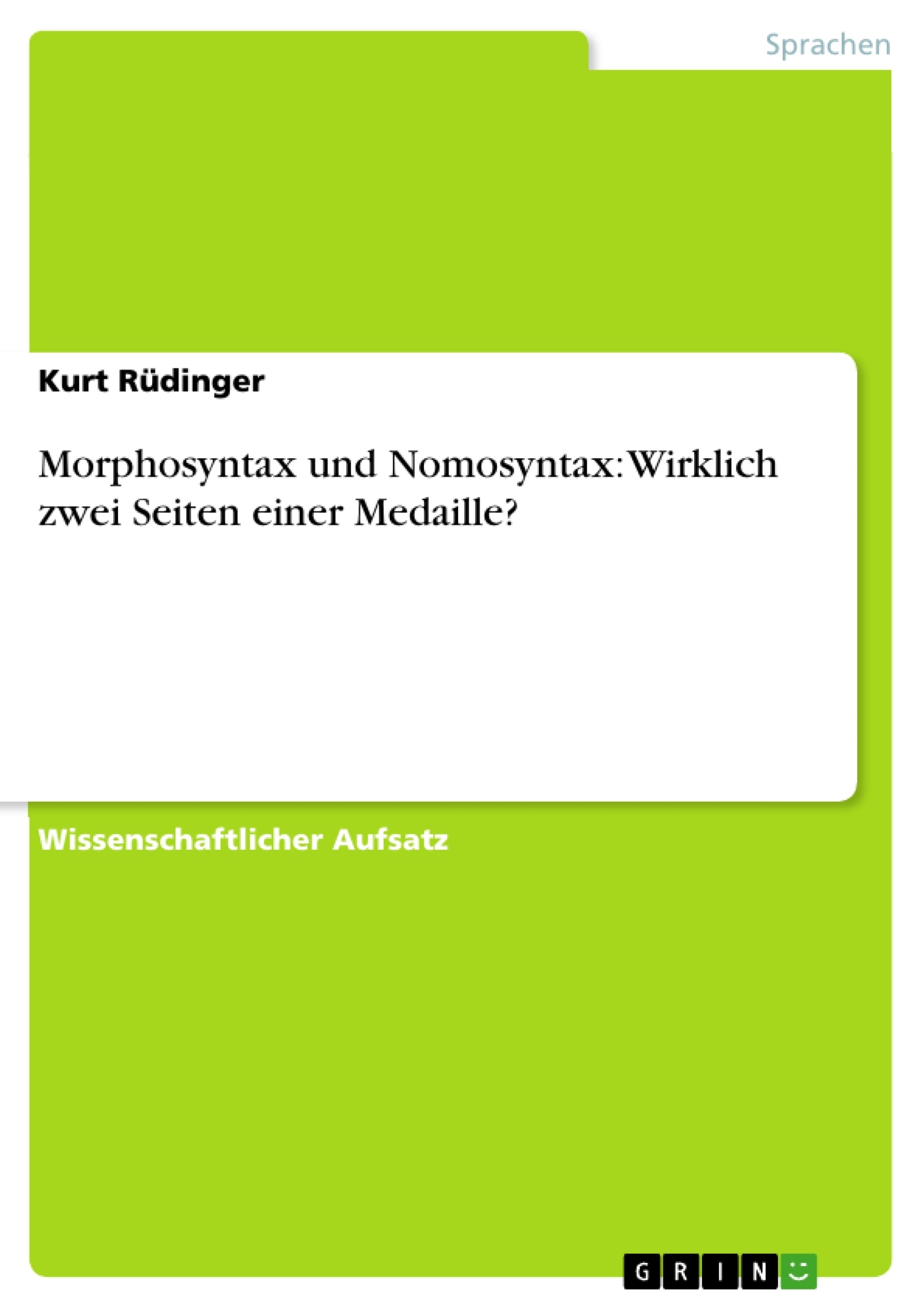Zusammenfassung
Wenn generischen Definitionen zu Folge Morphosyntax die Wiedergabe syntaktischer Funktionen durch morphologische Mittel als Disziplin beschreibt, bzw. als Phänomen einfach ist, so stellt sich nicht erst seit heute die Frage, was eigentlich angesichts eines beständig zu beobachtenden Formenschwunds aus den entsprechenden syntaktischen Funktionen wird. Verschwinden sie gleich mit oder sind sie, wenn auch nur noch implizit, weiterhin vorhanden, wie z.B rein semantisch inspirierte Kasustheorien (Fillmore u.a.) suggerieren möchten? Welche alternativen Vermittlungsmöglichkeiten zwischen einer rein referentiell-semantischen Ebene und ihrer morphologischen (Nicht) -Repräsentation bieten sich gegebenenfalls an? Dieser Frage soll in dem Vortrag an Hand von Beispielen aus dem Deutschen, Spanischen und Englischen auf den Grund gegangen werden und ein Ausweg aus einem offenkundig beständig evolutionierenden Beschreibungsdilemma aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkungen
- I.1 Anknüpfung an frühere Überlegungen zum Thema
- I.2 Aufgabenstellung: Resituierung morphologischer Details in Bezug auf ihren Kommunikationsbeitrag
- II. Begriffsklärung: Morphosyntax vs. Nomosyntax
- III. Faktencheck
- III.1 Niveau 4: Identifikation/Wiedererkennungswert
- III.2 Niveau 3: Unterstützungsfunktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag untersucht die Funktionalität morphologischer Markierungen in historischen Sprachen, insbesondere im Deutschen. Die zentrale Frage ist, ob die vermeintliche Funktionalität dieser Markierungen aus einer essentiellen Rolle im Sprachsystem resultiert oder eher eine unterstützende bzw. dekorative Funktion einnimmt. Der Beitrag beleuchtet das Verhältnis zwischen Morphosyntax und einem neu eingeführten Konzept der Nomosyntax, um einen strukturierten Ansatz zur Beschreibung des evolutionären Wandels morphologischer Strukturen zu finden.
- Funktionalität morphologischer Markierungen in der Sprache
- Das Verhältnis von Morphosyntax und Nomosyntax
- Evaluierung morphologischer Markierungen anhand verschiedener Funktionalitätsniveaus
- Analyse von Beispielen aus dem Deutschen, Spanischen und Englischen
- Der Wandel morphologischer Strukturen im Laufe der Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkungen: Dieser Abschnitt führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verständnis von Funktionalität im Sprachbereich und dem Ausmaß des "Funktionalismus" in morphologischen Einheiten historischer Sprachen. Es wird die These aufgestellt, dass die Behauptung von Funktionalität oft mit der Konnotation von Essentialität verbunden ist, deren Berechtigung im weiteren Verlauf untersucht werden soll. Eine Klassifizierung von Funktionalitätstypen (Polyfunktionalität, Sine-qua-non-Teilfunktion, Unterstützungsfunktion, Identifikationsfunktion) wird anhand von Beispielen aus der dinglichen Welt eingeführt und anschließend auf morphologische Markierungen in der Sprache übertragen.
II. Begriffsklärung: Morphosyntax vs. Nomosyntax: Dieses Kapitel führt das Konzept der Nomosyntax ein, ein kaum bekannter Begriff, der als strukturierter Ansatz für die Debatte über den Status der Morphologie innerhalb des Kommunikationssystems Sprache gesehen wird. Im Gegensatz zur Morphosyntax, die einen atomar-additiven Sprachbau annimmt, geht die Nomosyntax von einem Sinnganzen aus und bewertet die Einzelkomponenten in Bezug auf ihren Beitrag zum Gesamtsinn. Die Morphosyntax wird als untergeordnetes Instrumentarium der Nomosyntax betrachtet, mit unterschiedlicher Wertigkeit ihrer Einzelphänomene. Der Abschnitt legt den Grundstein für einen Faktencheck, der die Tragfähigkeit dieser Hypothese überprüfen soll.
III. Faktencheck: Dieser Abschnitt untersucht die Funktionalität morphologischer Markierungen auf verschiedenen Ebenen. Abschnitt III.1 befasst sich mit der Identifikationsfunktion, wobei gezeigt wird, dass morphologische Mittel den Nachweis der Besonderheiten einer Sprache darstellen und zur Abgrenzung verschiedener Sprachen und Sprachniveaus dienen. Es werden Beispiele aus verschiedenen Sprachen und auch Fehleranalysen bei nicht-muttersprachlichen Sprechern herangezogen. Abschnitt III.2 betrachtet die Unterstützungsfunktion morphologischer Markierungen im Kontext der Isomorphie von syntaktischer und semantischer Struktur und der linearen Argumentdistribution. Es wird diskutiert, ob morphologische Kennzeichnungen nur eine sekundäre, unterstützende Funktion haben und ob ihre ontologische Persistenz unsicher ist.
Schlüsselwörter
Morphosyntax, Nomosyntax, Funktionalität, morphologische Markierungen, Sprachwandel, Kommunikation, Sprachsystem, Funktionalitätsniveaus, Identifikationsfunktion, Unterstützungsfunktion, Deutsches, Spanisches, Englisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Beitrag: Funktionalität morphologischer Markierungen
Was ist das zentrale Thema des Beitrags?
Der Beitrag untersucht die Funktionalität morphologischer Markierungen in historischen Sprachen, insbesondere im Deutschen. Die Kernfrage ist, ob die vermeintliche Funktionalität dieser Markierungen aus einer essentiellen Rolle im Sprachsystem resultiert oder eher eine unterstützende bzw. dekorative Funktion einnimmt.
Welche Konzepte werden im Beitrag vorgestellt und verglichen?
Der Beitrag vergleicht Morphosyntax und Nomosyntax. Morphosyntax beschreibt den Sprachbau als atomar-additiv, während Nomosyntax von einem Sinnganzen ausgeht und Einzelkomponenten in Bezug auf ihren Beitrag zum Gesamtsinn bewertet. Die Nomosyntax wird als übergeordnetes Konzept zur Morphosyntax eingeführt.
Welche Funktionalitätsniveaus werden unterschieden?
Der Beitrag unterscheidet verschiedene Funktionalitätsniveaus morphologischer Markierungen: Identifikationsfunktion (Niveau 4: Wiedererkennungswert, Abgrenzung von Sprachen und Sprachniveaus) und Unterstützungsfunktion (Niveau 3: Unterstützung der Isomorphie von syntaktischer und semantischer Struktur).
Welche Sprachen werden als Beispiele herangezogen?
Der Beitrag analysiert Beispiele aus dem Deutschen, Spanischen und Englischen, um die Funktionalität morphologischer Markierungen zu veranschaulichen.
Wie ist der Beitrag aufgebaut?
Der Beitrag gliedert sich in Vorbemerkungen (Einleitung und Begriffsklärung), eine Begriffsklärung (Morphosyntax vs. Nomosyntax) und einen Faktencheck (Untersuchung der Identifikations- und Unterstützungsfunktion morphologischer Markierungen). Die Vorbemerkungen führen in die Thematik ein und stellen die zentrale Forschungsfrage dar. Die Begriffsklärung definiert wichtige Konzepte und legt den Grundstein für die Analyse. Der Faktencheck untersucht empirisch die Funktionalität anhand verschiedener Ebenen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Beitrag?
Schlüsselwörter sind: Morphosyntax, Nomosyntax, Funktionalität, morphologische Markierungen, Sprachwandel, Kommunikation, Sprachsystem, Funktionalitätsniveaus, Identifikationsfunktion, Unterstützungsfunktion, Deutsches, Spanisches, Englisch.
Was ist die These des Beitrags?
Der Beitrag argumentiert, dass die Behauptung der Funktionalität morphologischer Markierungen oft mit der Konnotation von Essentialität verbunden ist, deren Berechtigung kritisch hinterfragt wird. Es wird untersucht, ob morphologische Markierungen eine essentielle oder eher eine unterstützende Rolle im Sprachsystem spielen.
Welche Methodik wird angewendet?
Der Beitrag kombiniert konzeptionelle Überlegungen mit empirischen Analysen. Es werden verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Sprachen herangezogen, um die Funktionalität morphologischer Markierungen zu belegen und zu diskutieren.
- Citation du texte
- Doktor Kurt Rüdinger (Auteur), 2013, Morphosyntax und Nomosyntax: Wirklich zwei Seiten einer Medaille?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233061