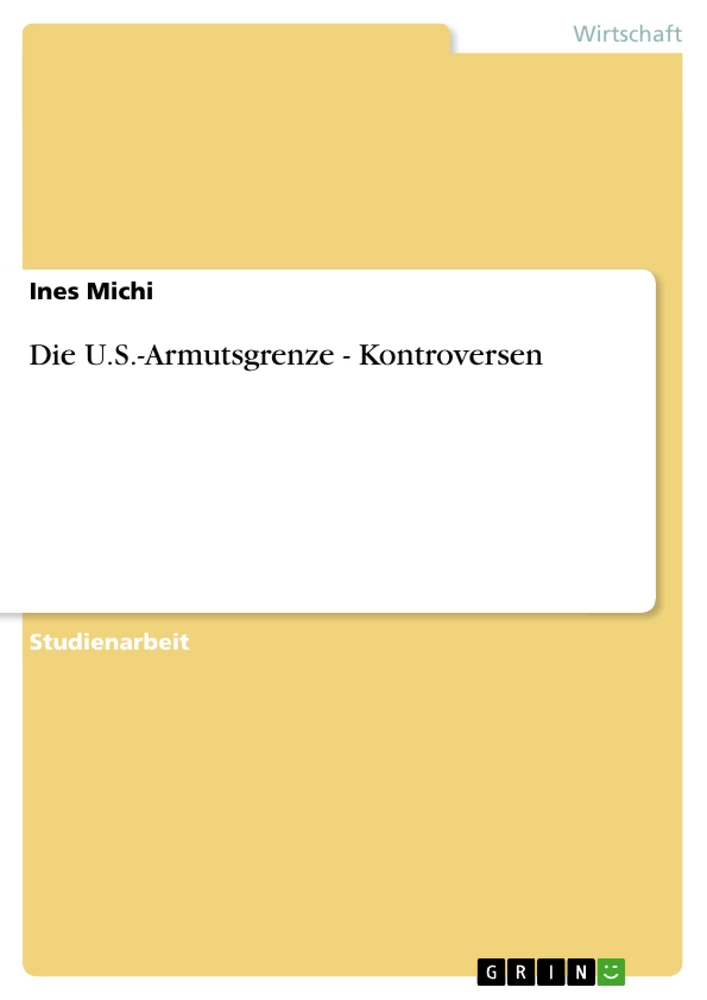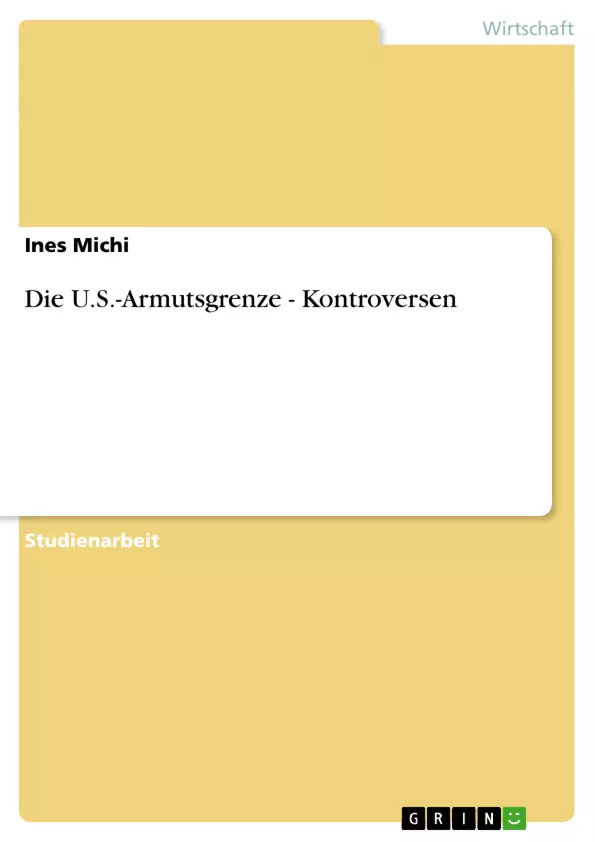Als die U.S. Regierung in den 60er Jahren begann sich genauer mit der Armutsmessung zu
befassen, wurde das damalige Maß als eine vorübergehende Lösung betrachtet, die der Vorläufer
für die Entwicklung von weiteren und verbesserten Strategien sei. Doch obwohl die
Fundiertheit der Konzeption und der Methodologie dieses Maßes von Anfang an bezweifelt
wurden bildet es heutzutage immer noch die Grundlage der offiziellen U.S.-Armutsmessung.1
Nichtsdestotrotz erfüllte dieses Maß in den 60er Jahren, sehr wohl seinen Zweck. Die von
Mollie Orshansky entwickelten Armutsgrenzen waren bemerkenswert übereinstimmend mit
einem alternativen Ansatz, der als Grenze 50 Prozent des Durchschnittseinkommens verwendete
und entsprachen ebenso der öffentlichen Meinung über ein minimal adäquates Maß an
Gütern und Dienstleistungen für eine typische Familie.2 Jedoch neigen Armutsmessungen
dazu, nur ihre eigene Zeit und deren äußere Umstände widerzuspiegeln (vgl. Citro und
Michael, Measuring Poverty, S. 26). Die offizielle U.S.-Armutsgrenze wurde jedoch seit
1963, abgesehen von minimalen Veränderungen und jährlich jeweils nur um die Inflationsrate
bereinigt, im Großen und Ganzen beibehalten. Gerade deswegen herrscht auch allgemein Einigkeit
über die Tatsache, daß das Armutsmaß geändert werden muß.3
1990 veröffentlichte Patricia Ruggles ihr Buch, Drawing the line, welches den Anstoß zu
mehreren Kongreß-Anhörungen des Joint Economic Committee gab. Auf Anfrage dieses
Kongresses wurde dann im Jahre 1992 von der National Academy of Sciences (NAS) ein
Studien-Ausschuß gebildet, welcher sich mit einer umfassenden Untersuchung der offiziellen
Armutsmessung beschäftigte. Dieser Ausschuß veröffentlichte 1995 seinen Bericht:
Measuring Poverty: A New Approach (Citro und Michael, 1995).4 In den darauffolgenden
Jahren wurden zahlreiche Anstrengungen dahingehend unternommen, die Umsetzbarkeit
dieser Empfehlungen zu prüfen. Deshalb werde auch ich mich hauptsächlich auf die darin
empfohlenen wesentlichen Änderungen und Punkte beschränken.
1 Vgl. Revising the poverty measure, in: Focus Vol. 19, Nr. 2 vom Frühjahr 1998, S. 1
2 Vgl. Poverty: Improving the Measure after Thirty Years, in: Focus Vol. 20, Nr. 2 vom Frühjahr 1999, S. 51
3 Vgl. Poverty: Improving the Measure after Thirty Years, in: Focus Vol. 20, Nr. 2 vom Frühjahr 1999, S. 51
4 Vgl. Short und Iceland, Who is better off than we thought?, S. 1
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Kritik an der Offiziellen U.S.-Armutsgrenze
- Alternative Konzepte und Definitionen
- Definition einer Armutsgrenze
- Die Armutsgrenze als absolutes, relatives oder subjektives Maß
- Konzeption
- Aktualisierung der Armutsgrenze
- Definition der Resourcen
- Verschiedene Ansätze im Vergleich
- Einkommensmesssung
- Definition einer Armutsgrenze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der offiziellen Armutsmessung in den USA und beleuchtet die Kritikpunkte an der aktuellen Methode. Es wird ein Überblick über alternative Konzepte und Definitionen der Armutsmessung gegeben, mit Fokus auf die Definition der Ressourcen und die Einkommensmesssung. Die Arbeit strebt danach, ein besseres Verständnis der Probleme und Herausforderungen der Armutsmessung in den USA zu vermitteln.
- Kritik an der konzeptionellen Entwicklung der U.S.-Armutsgrenze
- Kritik an der Einkommensdefinition in der Armutsmessung
- Alternative Konzepte und Definitionen der Armutsmessung
- Definition von Ressourcen und deren Einbezug in die Armutsmessung
- Einkommensmesssung und ihre Bedeutung für die Armutsmessung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der U.S.-Armutsmessung und beleuchtet den historischen Hintergrund der Entwicklung des offiziellen Armutsmaßes. Es zeigt auf, dass die ursprüngliche Konzeption der Armutsgrenze als eine vorübergehende Lösung betrachtet wurde und dass die Fundiertheit des Maßes von Beginn an in Frage gestellt wurde. Nichtsdestotrotz erfüllte das Maß in den 60er Jahren seinen Zweck und entsprach der öffentlichen Meinung über ein minimal adäquates Maß an Gütern und Dienstleistungen für eine typische Familie.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Kritik an der offiziellen U.S.-Armutsgrenze. Es werden verschiedene Punkte aufgezeigt, die die Messgenauigkeit und Aussagekraft des Maßes in Frage stellen. Dazu zählen unter anderem die mangelnde Anpassung an gestiegene Lebensstandards und Verbrauchsmuster, die Nichtberücksichtigung von Sachleistungen und Steuern sowie die fehlende Berücksichtigung von Ausgaben in Verbindung mit einem Arbeitsplatz.
Schlüsselwörter
U.S.-Armutsgrenze, Armutsmessung, Kritik, alternative Konzepte, Definition, Ressourcen, Einkommensmesssung, Lebensstandard, Verbrauchsmuster, Sachleistungen, Steuern, Arbeitskosten, Medizinische Versorgung.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht die offizielle US-Armutsgrenze in der Kritik?
Die Berechnungsmethode stammt weitgehend aus dem Jahr 1963 und berücksichtigt kaum moderne Lebensstandards, Sachleistungen oder Steuern.
Wer entwickelte die ursprüngliche US-Armutsgrenze?
Die Armutsgrenzen wurden in den 1960er Jahren von Mollie Orshansky entwickelt.
Was ist der Unterschied zwischen absoluten und relativen Armutsmaßen?
Ein absolutes Maß definiert ein Minimum an Gütern, während ein relatives Maß die Armut im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen der Bevölkerung setzt.
Welche Rolle spielt die Einkommensdefinition bei der Armutsmessung?
Die Definition entscheidet darüber, ob nur Bareinkommen oder auch staatliche Unterstützungen (Sachleistungen) und notwendige Ausgaben (z.B. Arbeitskosten) eingerechnet werden.
Was empfahl die National Academy of Sciences (NAS) 1995?
Der NAS-Ausschuss empfahl einen neuen Ansatz zur Armutsmessung, der Ressourcen und Bedürfnisse genauer definiert und regelmäßig aktualisiert wird.
- Quote paper
- Ines Michi (Author), 2002, Die U.S.-Armutsgrenze - Kontroversen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23319