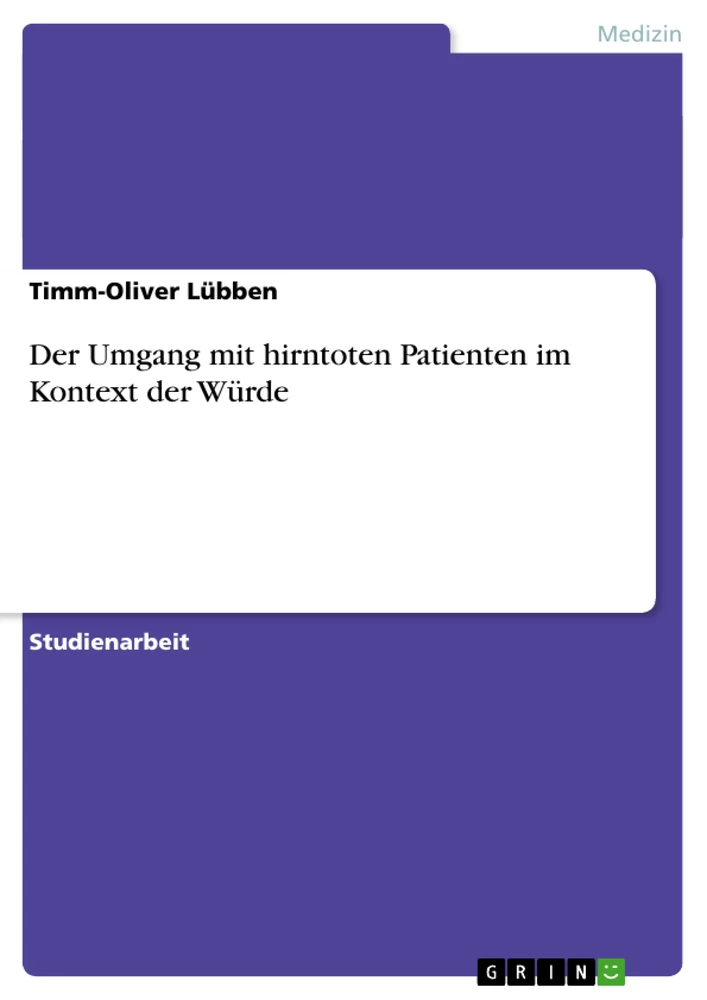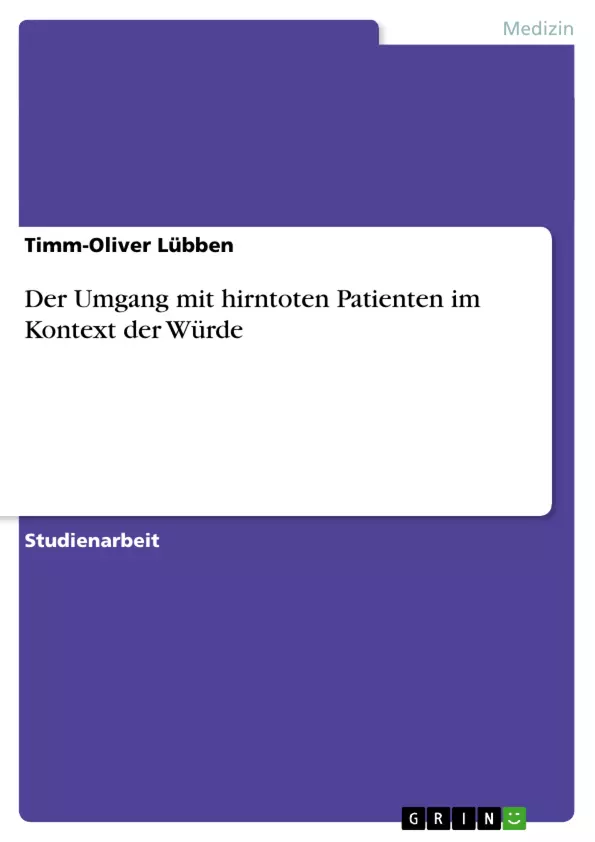In ihrem Arbeitsalltag müssen Pflegende wie auch Ärzte moralische Entschei-dungen treffen. Moral bezeichnet dabei „die Verhaltensnormen der gesamten Gesellschaft oder einer Gruppe, die aufgrund von Tradition akzeptiert und stabili-siert werden“ (Körtner 2004). So hat laut Körtner (2004) auch jede Berufsgruppe ihre Moral. Pflegende, Mediziner und Angehörige können bei hirntoten Patienten, gerade bei Organentnahmen, aber auch moralisch an ihre Grenzen stoßen. Staatliche Gesetze können zwar Entscheidungen vorgeben und ein Handeln in eine gewisse Richtung erzwingen, sind aber nicht für jedermann moralisch kor-rekt. Wer darf entscheiden, ob Organe entnommen werden sollen? Sollte man den Patienten als sterbend oder tot ansehen? Ist es moralisch vertretbar, wenn Chirurgen zynische Witze über den Patienten von sich geben, während sie seine Organe entnehmen oder ist dies ihm gegenüber unwürdig? Diese wissenschaftli-che Ausarbeitung soll diesen Fragen nachgehen und verschiedene Perspektiven aufzeigen. Dabei soll zuerst der Begriff Würde näher erläutert werden. Hinterher wird die Frage beleuchtet, ob Hirntote Menschen als sterbend oder tot anzusehen sind. Dabei wird der Fokus überwiegend auf die politische Diskussion von 1997 gelegt. Im letzten Kapitel soll dann anhand mehrerer philosophischer Perspektiven der Frage nach der Existenz von Würde bei Hirntoten nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Was ist Würde?
2 Sind Hirntote als sterbend oder tot anzusehen?
3 Haben Hirntote Würde?
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Einleitung
In ihrem Arbeitsalltag müssen Pflegende wie auch Ärzte moralische Entscheidungen treffen. Moral bezeichnet dabei „die Verhaltensnormen der gesamten Gesellschaft oder einer Gruppe, die aufgrund von Tradition akzeptiert und stabilisiert werden“ (Körtner 2004). So hat laut Körtner (2004) auch jede Berufsgruppe ihre Moral. Pflegende, Mediziner und Angehörige können bei hirntoten Patienten, gerade bei Organentnahmen, aber auch moralisch an ihre Grenzen stoßen. Staatliche Gesetze können zwar Entscheidungen vorgeben und ein Handeln in eine gewisse Richtung erzwingen, sind aber nicht für jedermann moralisch korrekt. Wer darf entscheiden, ob Organe entnommen werden sollen? Sollte man den Patienten als sterbend oder tot ansehen? Ist es moralisch vertretbar, wenn Chirurgen zynische Witze über den Patienten von sich geben, während sie seine Organe entnehmen oder ist dies ihm gegenüber unwürdig? Diese wissenschaftliche Ausarbeitung soll diesen Fragen nachgehen und verschiedene Perspektiven aufzeigen. Dabei soll zuerst der Begriff Würde näher erläutert werden. Hinterher wird die Frage beleuchtet, ob Hirntote Menschen als sterbend oder tot anzusehen sind. Dabei wird der Fokus überwiegend auf die politische Diskussion von 1997 gelegt. Im letzten Kapitel soll dann anhand mehrerer philosophischer Perspektiven der Frage nach der Existenz von Würde bei Hirntoten nachgegangen werden.
In vorliegender Arbeit wird durchgehend die männliche Schreibweise gewählt.
Dieses soll lediglich der besseren Lesbarkeit dienen und nicht als Diskriminierung
verstanden werden.
1 Was ist Würde?
Der Begriff Würde wird täglich von uns benutzt. Sei es in den Medien, wenn von einem würdevollen Abschied oder unwürdigem Verhalten die Rede ist. Oder auch in der alltäglichen Sprache, wenn es heißt: „Das war absolut würdelos!“ Selbst im Grundgesetz ist der Begriff, wie allseits bekannt, fest verankert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ (Art.1 Abs. 1 GG 1949). Sollte es da nicht gerechtfertigt sein, zu hinterfragen, was das Wesen der Würde ausmacht? Wovon reden wir eigentlich, wenn wir das Wort Würde verwenden?
Nach der deontologischen Ethik von Immanuel Kant existiert der Mensch „als Zweck an sich und nicht nur als Mittel zum Gebrauch eines beliebigen Willens“ (Pfabigan 2004). Dabei gehört die Würde zu den Zwecken, hat jedoch den besonderen Status, dass sie als innerer Wert unverkäuflich ist: „[…] was dagegen über jeden Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde […]“ (Kant 1961). Nach Pfabigan (2004) schreibt Kant einem Menschen aufgrund seiner Autonomie Würde zu. Unter Autonomie versteht er ein Vernunftswesen, also ein Lebewesen, dass seinem Handeln selbstständig Gesetze geben kann.
Kant unterscheidet hier die zwei wesentlichen Merkmale der Würde. Zum einen besitzt der Mensch die Würde als inneren, unverkäuflichen Wert. Also kraft seines Menschseins und von Geburt an, man spricht auch von einem Wesensmerkmal oder einer Seinsbestimmung. Zum anderen muss er jedoch auch vernünftig handeln, was zwar auch eine menschliche, angeborene Fähigkeit darstellt, jedoch genauso einem Gestaltungsauftrag gleichkommt. Dabei hängt es von einem Menschen selbst ab, ob es Würde gibt. Er muss unter der Achtung von Gesetzen leben und sich dementsprechend verhalten.
Diese beiden Eigenschaften werden jedoch nicht nur von Kant miteinander verknüpft. Wetz (1998) und, unter dessen Verwendung, auch Pfabigan (2008) verweisen darauf, dass schon Marcus Tullius Cicero von einer Würde aus Gestaltungsauftrag und Wesensmerkmal sprach. Jedoch setzte sich dieses Würdeverständnis erst später im mittelalterlichen Christentum und unter Einfluss dessen Weltanschauung durch. Das Wesensmerkmal der Würde ist demnach die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, sie wird durch Gott dem Menschen verliehen und hebt ihn von anderen Lebewesen ab (Wetz undatiert). Der Gestaltungsauftrag ist nach dem christlichen Verständnis die lebenslange Pflege dieser Würde. Ohne die ihr entgegengebrachte Achtung, bei einem selbst oder bei anderen, würde sie verkümmern (Wetz 1998).
Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass quer durch die letzten Jahrhunderte bis in die Neuzeit Würde als etwas beschrieben wurde, dass aus einem Gestaltungsauftrag und einem Wesensmerkmal besteht. Diese beiden Eigenschaften stehen jedoch nicht isoliert, sondern werden stets miteinander verknüpft.
2 Sind Hirntote als sterbend oder tot anzusehen?
Um hirntoten Menschen Würde zuzusprechen bzw. abzusprechen muss sich nicht zuletzt die Frage gestellt werden, ob diese als tot oder sterbend anzusehen sind. Daraus resultiert auch die Diskussion um ein Hirntodkonzept. Diese Fragen wurden in den 1990ern in der Gesellschaft heiß diskutiert, woraus auch eine Debatte im Bundestag entstand. Kritiker des Hirntodkonzeptes, waren der Organtransplantation nicht generell abgeneigt, bemängelten jedoch, dass die Lebenserhaltung eines hirntoten Patienten nur dem unbekannten Dritten und der Transplantationsmedizin dienen würde. Sie orientiere sich nicht an der Würde des Sterbenden, sondern sei eher als utilitaristisch anzusehen. Befürworter hielten dem entgegen, dass wenn man Hirntod und Tod des Menschen nicht gleichsetze, eine Legitimation zur Organentnahme niemals gegeben sei und daraus das Ende der Transplantationsmedizin resultiere. Gesetzlich wurde 1997 letztendlich beschlossen, dass der Hirntod auch gleichzeitig der Tod des Menschen bedeute und als Kriterium zur Organentnahme rechtsgültig sei (Manzei 1997). Außerdem wurde das Hirntodkonzept gesetzlich festgelegt. Demnach muss nach aktuellem medizinisch-wissenschaftlichen Stand festgestellt werden, dass vor der Organentnahme „der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms“ eingetreten ist (§3 Satz 2 Nr. 2 TPG 1997a).
Nach Manzei (1997) liegen die ursprünglichen Probleme in den Fragen nach der Todesdefinition sowie der Zustimmung zur Organentnahme. Letzteres beinhaltet die Frage, ob nur der Spender selbst zu Lebzeiten über eine Organentnahme am Lebensende entscheiden soll oder ob es auch die Angehörigen dürfen, wenn der Ernstfall eingetreten ist. Eine dritte Möglichkeit wäre eine gesetzliche Sozialpflicht, z.B. die Widerspruchslösung. Dabei geht man vom generellen Willen zur Organspende aus, sodann nicht vorher ausdrücklich widersprochen wurde. Jedoch kann hierbei nicht mehr von Freiwilligkeit zum Schutz der Würde gesprochen werden.
Will man den Tod definieren, so Manzei (1997), bewegt man sich auf drei Argumentationsebenen. Zum einen gibt es die Ebene der Definition oder Begriffsbestimmung. Manzei glaubt, dass man zuerst das menschliche Wesen definieren muss, bevor der Begriff Tod bestimmt werden kann. Das menschliche Leben geht demnach dem Tod voraus und schafft sozusagen seine Basis. Doch ihrer Meinung nach kann man das komplexe menschliche Verhalten nicht definieren, ohne normativ zu begründen. Sobald dieses jedoch geschieht, werden Menschen aus der Definition ausgeschlossen, die dieser Norm nicht entsprechen. Menschen sind eben Individuen, keiner gleicht dem anderen. Die zweite Ebene bezieht sich auf die Bedeutung und das Verständnis des Todes. Ob die Medizin, verschiedene Religionen oder Kulturen: alle haben ein anderes Verständnis vom Tod und dessen Bedeutung. Um eine Allgemeingültigkeit zu erzielen, müssten alle Gruppen einer Gesellschaft über Bedeutung und Verständnis diskutieren und sich einigen, was per se noch nicht geschehen ist. Die dritte Ebene schließt hier an. Sie verlangt nach Kriterien der Todesfestlegung. Ein Arzt kann nur nach seinen medizinischen Kriterien vorgehen, welche jedoch ebenfalls nicht allgemeingültig sein können, weil andere Sichtweisen außer Acht gelassen werden. Denn der Tod „ist ein kulturrelatives Phänomen, das von unterschiedlichsten Formen der Wahrnehmung und Deutung unserer Wirklichkeit abhängig ist“ (Hoff, In der Schmitten 1994).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Haben hirntote Patienten noch Menschenwürde?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand philosophischer Perspektiven (u. a. Kant) und diskutiert, ob Würde an Bewusstsein gebunden ist oder als Wesensmerkmal fortbesteht.
Gilt der Hirntod in Deutschland als der Tod des Menschen?
Ja, gesetzlich wurde 1997 im Transplantationsgesetz festgelegt, dass der Hirntod mit dem Tod des Menschen gleichzusetzen ist, was die Organentnahme legitimiert.
Was ist der Unterschied zwischen „tot“ und „sterbend“ in der Debatte?
Kritiker des Hirntodkonzepts argumentieren, dass Hirntote organisch noch lebendig wirken (Herzschlag, Wärme) und daher eher als Sterbende denn als Leichen zu behandeln seien.
Was verstand Immanuel Kant unter Würde?
Für Kant besitzt der Mensch Würde aufgrund seiner Autonomie und Vernunftbegabung; er darf niemals bloß als Mittel zum Zweck (z. B. als bloßer Organlieferant) benutzt werden.
Was ist die „Widerspruchslösung“ bei der Organspende?
Es ist ein Modell, bei dem jeder automatisch als Spender gilt, es sei denn, er hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Die Arbeit diskutiert dies im Kontext der Freiwilligkeit.
- Citation du texte
- Timm-Oliver Lübben (Auteur), 2013, Der Umgang mit hirntoten Patienten im Kontext der Würde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233211