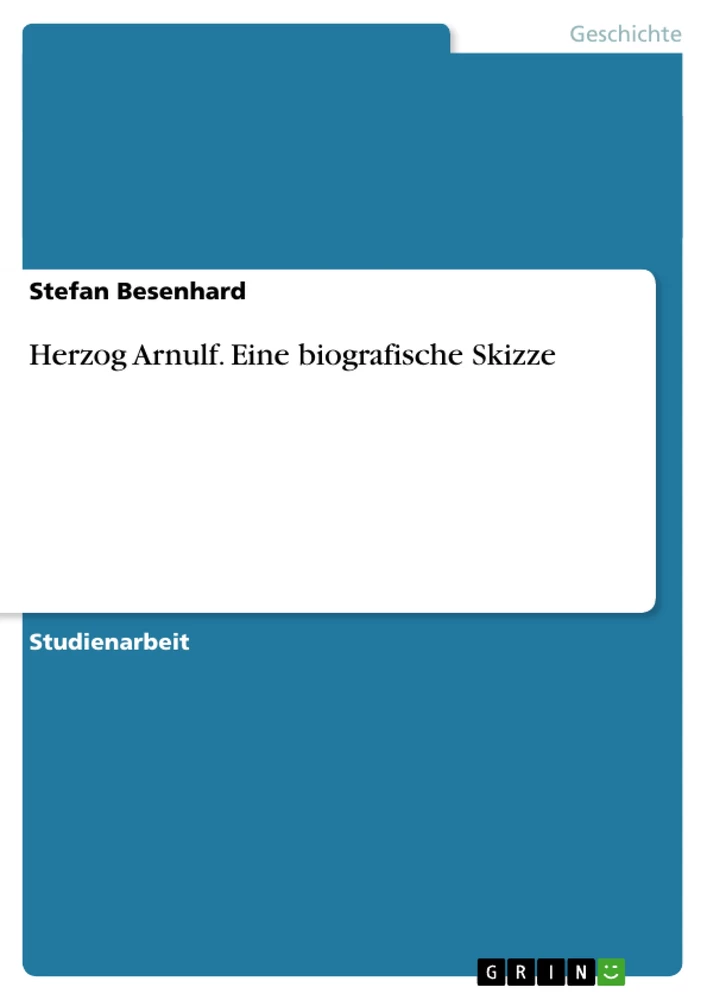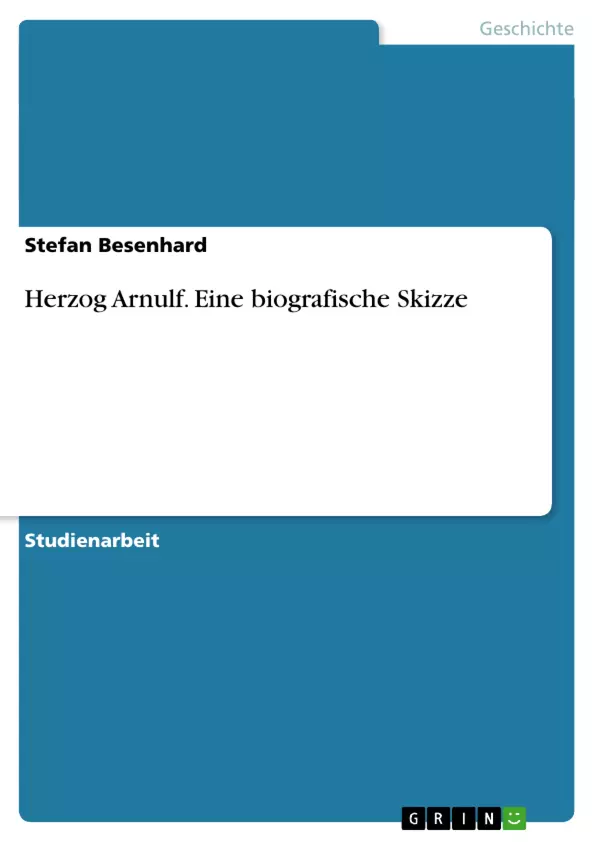In dieser Arbeit wird versucht, die wesentlichen Stationen von Arnulfs Leben als bayerischer Herzog nachzuzeichnen. Der Begriff "biografische Skizze" ist dabei bewusst gewählt, da auf Grund der mangelhaften Quellenlage eine umfangreiche, lückenlose Biographie aus heutiger Sicht nicht möglich ist. Neben den historischen Tatsachen wird sich auch bemüht, die Bewertung der Person Arnulfs in der Forschungsliteratur aufzugreifen und zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Herzog Arnulf – Fluch oder Segen für Bayern?
2. Leben und Wirken von Herzog Arnulf
2.1 Vorgeschichte und Regierungsantritt Herzog Arnulfs
2.2 Der Kampf gegen die ungarischen Aggressoren
2.3 Arnulfs Verhältnis zum Königtum
2.4 Interessen in Böhmen und Italien
2.5 Herzog Arnulfs Nachfolge und letzte Jahre seiner Regentschaft
3. Resümee
4. Literaturverzeichnis
1. Herzog Arnulf – Fluch oder Segen für Bayern?
Arnulf kommt als erstem Herrscher in Bayern, der wieder den Herzogtitel seit dem Sturz von Tassilo III im Jahre 788 trägt, eine besondere Bedeutung zu. Sein Bild in der Geschichte scheint aber mehr als negativ geprägt zu sein. Bereits der Beiname „de[r] Böse[…]“[1], der auch heute noch gängig ist, zeigt die eindeutig negative Wertung, die sich auch in manchen älteren historischen Forschungsarbeiten wieder finden lässt. Doch spiegelt sich dieser Beiname auch wirklich in Arnulfs charakterlichen Eigenschaften und politischem Wirken der damaligen Zeit wieder? Oder lassen sich solche und ähnliche Ansichten im Lichte eines neueren Forschungsstandes abmildern, oder sogar widerlegen?
Im Folgenden möchte ich von Arnulfs Leben eine biografische Skizze erstellen und daran Arnulfs Persönlichkeit und seine Handlungen ergründen um eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Der Begriff Skizze ist hier bewusst gewählt, da auf Grund der nicht ausreichenden Quellenlage eine umfangreiche, lückenlose Biographie aus heutiger Sicht nicht möglich ist.[2]
2. Leben und Wirken von Herzog Arnulf
2.1 Vorgeschichte und Regierungsantritt Herzog Arnulfs
Nach der desaströsen militärischen Niederlage Bayerns gegen die Ungarn vor Pressburg im Jahre 907, in der auch Arnulfs Vater Luitpold durch eine Verwundung den Tod fand, wie auch diverse andere bayerische Würdenträger, schien die Stellung Bayerns gefährdet. Führerlos und durch die ungarischen Aggressoren bedroht, wäre es nur allzu leicht anzunehmen, dass ein Zerfall des bayerischen Reiches folgen könnte. Stattdessen fand das Land in Arnulf, dem Sohn Luitpolds, einen selbstbewussten und tatkräftigen Nachfolger, der es verstehen sollte, das Land zu lenken.[3]
Im Gegensatz zu seinem Vater ereignete sich aber ein bedeutender Wandel. Hatte Luitpold noch im Auftrag der Karolinger gehandelt und keine selbstständige Herrscherposition eingenommen, so trat Arnulf seine Herrschaft aus eigener Machtvollkommenheit an. Weder der König, noch das Volk hatte dabei Einfluss darauf. Dennoch ist anzunehmen, dass Arnulfs Erhebung zum Herrscher mit dem Wohlwollen des bayerischen Adels einherging, ohne dessen ein solcher Machtantritt wohl kaum möglich gewesen wäre.[4] Zu welchem Zeitpunkt Arnulf den Titel „dux“[5], also Herzog vertrat, ist umstritten und es soll auch hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Indizien sprechen aber dafür, dass er den Titel bereits kurz nach Regierungsantritt führte.
2.2 Der Kampf gegen die ungarischen Aggressoren
Um das geschwächte bayerische Heer wieder zu stärken und die Bedrohung von außen durch die Ungarn einzudämmen, die nach der Niederlage 907 größer denn je zu sein schien, führte Arnulf in den Jahren 907-914 umfangreiche Säkularisationen kirchlicher Güter in Bayern durch, um Geldmittel für die Aushebung neuer Truppen zu erlangen. Dieses Handeln brachte Arnulf in der geistlichen Geschichtsschreibung den Beinamen „de[r] Böse[…]“[6] ein, der auch heute noch in Verbindung mit seinem Namen gebräuchlich ist.[7] Den Hass, den er sich von der Geistlichkeit zuzog wird in folgenden zeitgenössischen Quellen aus der Chronik von Scheyern und der Chronicon Schlierseense sichtbar:
Künick Chunrat der starb und ward erwelet künick Heinrich, wider den kom hertzog Arnold gen Bayrn von Ungern und stelltnach dem reiche und ward wundervaren, allso das hertzog Arnold und sein erben, dy sollten haben den saz an den pistummen, wann zu den zeiten allew pistum von dem reich wurden gelichen, des übernam sich der vorgenant Arnold, und verderbet pistumm und clöster un tet vil ybels, Sant Ulreich hett in erhoben auzz der tauff. Sein strauff half an im nitt, er tet vil ybels […][8]
Item auch ist zw merchn, das ain Bischoff zw Freysing gewesn ist genant Ott der ander des nams, und der czwayczgist Bischoff, der selbig nach der zerstörung des Gotzhaws zu Wessenhoven, auch layder ander vil und maniger Gotzhawser in Bayrn von einem , der dann zw den selbigen zeittn regierät als ain Tyrann wider dye kristenhait, und nach dem selbigen sind dye Gotzhäwser von den Sarracenern ganz verwüest und verprennt warden[9].
Trotz der damals verständlichen, radikal schlechten Sicht der Geistlichen auf Arnulf als Reaktion auf seine Säkularisationen, muss dieses Urteil, das damals gefällt wurde, heutzutage relativiert werden. Herzog Arnulf befand sich in einer Zwangslage und sah die einzige Möglichkeit zum Schutz seines Reiches in der Beschaffung von liquiden Mitteln, um sein bis dahin relativ schwaches Heer wieder zu stärken. Diese Geldquelle sah er in der Veräußerung der Kirchengüter, die wohl als notwendiges Übel zu bezeichnen ist, das er eingehen musste.
909 konnte Arnulf die Ungarn mit seinem wieder erstarkten Heer an der Rott schlagen, als diese nach einem Kriegszug in Schwaben und einer erfolglosen Belagerung Freisings auf ihn trafen. 910 setzte Arnulf seine militärischen Erfolge fort, als er das ungarische Heer bei Neuching erneut schlug, nachdem dieses bereits einen Sieg über das fränkische Heer unter Ludwig dem Kind errungen hatte. Den bedeutendsten Sieg errang der Herzog Bayerns jedoch erst im Jahre 913 am Inn über die Ungarn. Der sorgfältig geplante Kriegszug fand mit der Unterstützung schwäbischer Truppen unter den beiden Oheimen Arnulfs, dem Grafen Erchanger und Berthold statt. Diese geradezu vernichtende Niederlage für die Ungarn führte dazu, dass die folgenden vierzehn Jahre keine kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und den Bayern zu verzeichnen waren. Ein Waffenstillstandsvertrag zwischen beiden Völkern ist wahrscheinlich, kann jedoch nicht belegt werden. Bereits im eigenmächtigen Vorgehen, wie auch in der angenommenen Schließung des Waffenstillstandes ist eine gewisse außenpolitische Autarkie Bayerns zu erkennen, die von Arnulf vertreten wird und auch von seiner großen Machtfülle und seinem starken Durchsetzungsvermögen zeugt. Durch den Sieg über die Ungarn hatte Arnulf seine Feuertaufe als Herrscher bestanden und seine Position als Machtinhaber in Bayern erfolgreich konsolidiert.[10]
2.3 Arnulfs Verhältnis zum Königtum
Inzwischen war König Ludwig das Kind am 24. September 911 als letzter ostfränkischer Karolinger ohne Nachkommen verstorben.[11] Die Erbfolge der Karolinger war unterbrochen und führte so zu einer völlig neuen Art der Ernennung eines Nachfolgers.[12] In der Wahlversammlung in Forchheim im November 911 nahmen alle im ostfränkischen Reich vereinigten Stämme, also die Franken, Sachsen, Schwaben und Bayern teil. Überraschenderweise stellten nur die Franken und Sachsen mit ihren Stammesführern Konrad und Heinrich Kandidaten für die Königswahl zur Verfügung, obgleich Arnulf gemäß seiner Abstammung und großen Machtfülle als Königskandidat legitimiert gewesen wäre. Vermutlich erschien Arnulf das Amt des ostfränkischen Königs als zu unsicher, um es in Erwägung zu ziehen. Genoss er doch zur gleichen Zeit fast über königsgleiche Privilegien und Macht in seinem eigenen bayerischen Herzogtum. Sein rationales Verhalten zeigt, dass Arnulf nicht nur als Militär, sondern auch als Staatsmann intelligent agieren konnte.[13]
Stattdessen wurde Konrad I im Jahre 911, wie auch aus der folgenden Quelle aus der Chronik von den Fürsten aus Bayern von Ritter Hans Ebran von Wildenberg hervorgeht zum neuen ostfränkischen König gekrönt.
Nach dem sterben Ludbig understuendt sich hertzog Arnolf von Beirn des reichs als der nachst erib; dawider waren all tewtzsch fürsten, die im des reichs nit günden, dann sie sorg hetten auf sein pöss siten, und darumb erforderten sie zu romischem konig hertzog Otten von Saxsen, der sich des nit wolt annemen von alter und schwachheit seins leibs, und nach rate des itzgedachten Otten ward Conradus, der landgraf von Hessen, zu romischem konig erwelt[14].
[...]
[1] Schmid, Das Bild des Bayernherzogs Arnulf (907-937) in der deutschen Geschichtsschreibung von seinen Zeitgenossen bis zu Wilhelm von Giesebrecht, S.171
[2] Holzfurtner, Gloriosus Dux, S. 1-8.
[3] Holzfurtner, Dux, S. 32/33
[4] Reindel, Bayern unter den Luitpoldingern, S.280
[5] Stoll, Mythos Bayern. Die literarische Erfindung einer Chimäre, S. 253
[6] Schmid, Bild, S.171
[7] Reindel, Bayern, S. 281/282
[8] Reindel, Die bayerischen Luitpoldinger 893-989, S.82
[9] Reindel, Luitpoldinger, S.82
[10] Holzfurtner, Dux, S.48-50
[11] Reindel, Bayern, S.282
[12] Ludwig Holzfurtner, Dux, S. 112
[13] Reindel, Bayern, S.282/283
[14] Reindel, Luitpoldinger 893-989, S.99
Häufig gestellte Fragen
Wer war Herzog Arnulf von Bayern?
Arnulf (reg. 907–937) war ein bayerischer Herzog aus dem Haus der Luitpoldinger, der nach einer schweren Niederlage gegen die Ungarn die Macht in Bayern konsolidierte.
Warum erhielt Arnulf den Beinamen "der Böse"?
Den Beinamen verdankte er der kirchlichen Geschichtsschreibung, da er Kirchengüter säkularisierte, um die Mittel für den Aufbau eines Heeres gegen die Ungarn zu beschaffen.
Wie erfolgreich war Arnulf im Kampf gegen die Ungarn?
Sehr erfolgreich. Er schlug die Ungarn 909 an der Rott und 913 am Inn so vernichtend, dass Bayern für die folgenden vierzehn Jahre vor weiteren Angriffen geschützt war.
Welches Verhältnis hatte Arnulf zum ostfränkischen Königtum?
Arnulf agierte sehr autark und verfügte über fast königsgleiche Privilegien. Er verzichtete 911 auf eine eigene Königskandidatur, vermutlich um seine Machtbasis in Bayern nicht zu gefährden.
War Arnulf ein Tyrann oder ein Retter Bayerns?
Moderne Forschung relativiert das negative Bild der Kirche. Arnulf gilt heute eher als tatkräftiger Herrscher, der Bayern in einer existenziellen Krise stabilisierte und schützte.
- Citation du texte
- Stefan Besenhard (Auteur), 2008, Herzog Arnulf. Eine biografische Skizze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233417