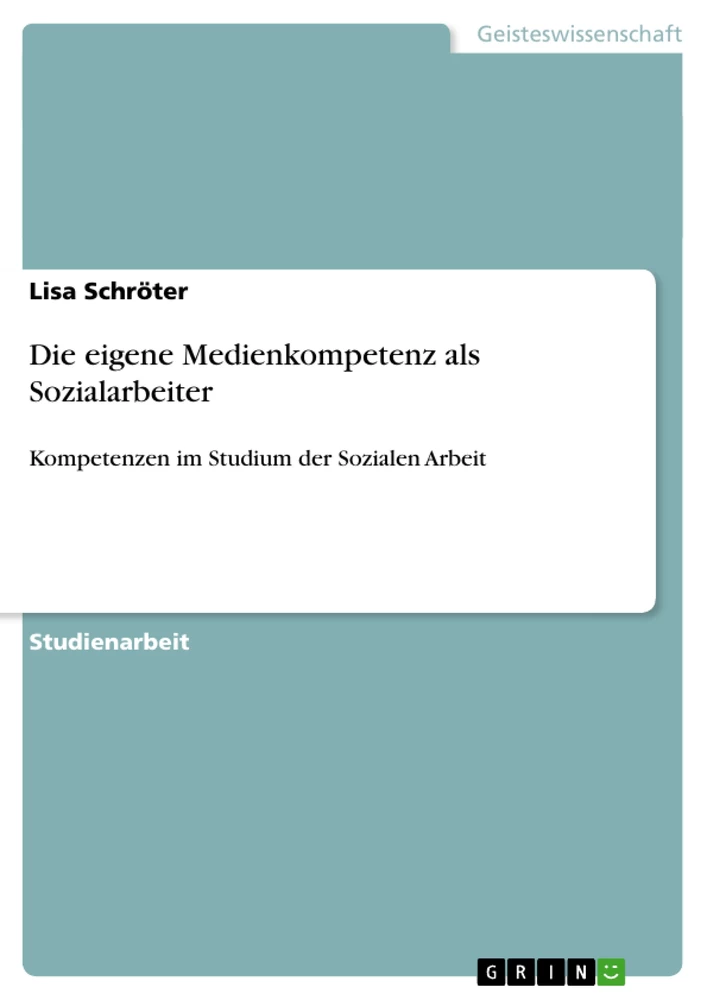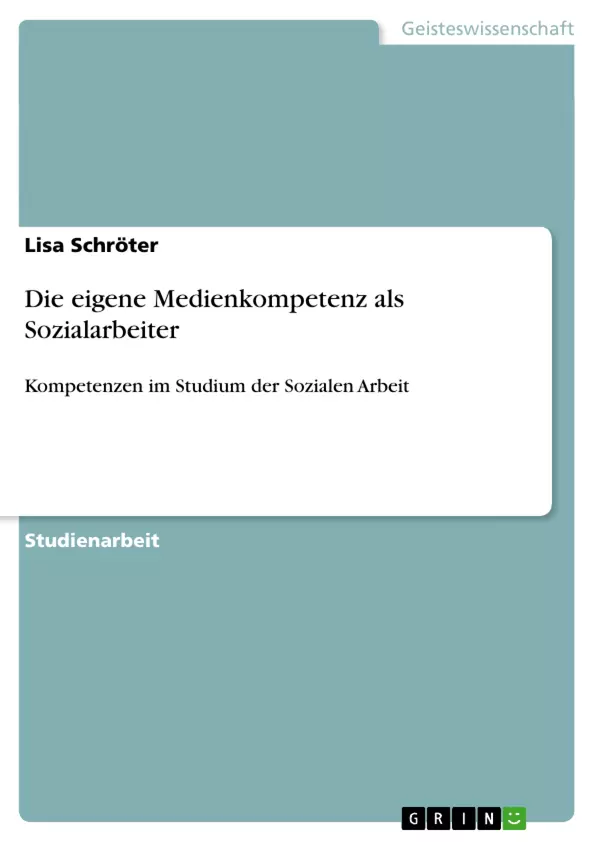Eine thematisch-spezialisierte Arbeit zum im Rahmen des Gesamtkomplexes "Kompetenzen im Studium der Sozialen Arbeit".
In diesem Text findet sich auch ein praktisches Beispiel über den medienkompetenten Sozialarbeiter als Vermittler zwischen "Digital Natives" und "Digital Immigrants".
1. Einleitung
Gleich im ersten Semester des Studiums der Sozialen Arbeit werden, nicht nur hier in Cottbus, sondern deutschlandweit an sämtlichen Hochschulen, Vorlesungen zum Thema Medienpädagogik abgehalten. Zahlreiche Universitäten betonen auf ihren Internetpräsenzen immer wieder, dass sie im Studium der Sozialen Arbeit die Medienkompetenz fördern und unterstützen.
„Darüber hinaus fördert das Studium die Medienkompetenz der Studierenden“, heißt es beispielsweise auf der Homepage der FH Potsdam (Internetquelle 1), denn „Medienkompetenz wird heutzutage im Bereich der Sozialen Arbeit selbstverständlich vorausgesetzt“.
„Medienkompetenz ist eine wichtige berufspraktische Qualifikation für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, sei es für die aktive und rezeptive Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen, sei es in der Elternberatung in Medienfragen, sei es zwecks Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Institution, sei es als allgemeine technisch-kommunikative und kritisch-rezeptive Fertigkeit“, wird dies auf der Website der FH Dortmund begründet (Internetquelle 2).
Dennoch konnten und können viele Erstsemestler nicht verstehen, warum auf diese Vortragsreihe und auf das Erwerben von Medienkompetenz so viel Wert gelegt wird; erschließt sich die Wichtigkeit von Vorlesungen zum Beispiel über Soziale Beratung oder Suchtprävention doch viel schneller.
Die Pflicht des Anfertigens eines Portfolios für den Themenbereich Medienpädagogik warf bei mir die Frage auf, warum es denn so wichtig ist, dass das Studium der Sozialen Arbeit den Studierenden Medienkompetenz vermitteln will. Schließlich wird, wie bereits erwähnt, von den Hochschulen eine Menge Wert darauf gelegt. Nachdem mein Interesse durch das Lesen von Fachzeitschriften geweckt wurde und ich meine Literaturrecherche begann erschloss sich mir, warum.
2. Die eigene Medienkompetenz als Sozialarbeiter
Zunächst eine Definition des Begriffes Medienkompetenz als einer der wichtigsten Bestandteile der Medienpädagogik. Ein Unterfangen, welches sich als schwierig erweist, da der Begriff noch relativ jung ist und sich die Medienpädagogen über die genauen Funktionen, welche die Medienkompetenz haben soll, noch nicht einig sind. Lediglich in einem Punkt sind die Autoren gleich gestimmt:
„Der Begriff Medienkompetenz soll die Fähigkeiten begrifflich bündeln, die das Individuum innerhalb einer Medien- oder Informationsgesellschaft benötigt“ (Bernd Schorb in „Grundbegriffe Medienpädagogik“, 1997, S.234-240).
Ein medienkompetenter Mensch weiß also, wie er Medien für sich nutzen und benutzen kann, beherrscht die Technik und geht kritisch-reflexiv mit den Medien und deren Inhalten um. Das genau dieses im Studium vermittelt wird, soll zur Folge haben, dass die späteren Sozialarbeiter in ihrer Berufspraxis aus ihrem erlangten Wissen einen Nutzen für sich und ihre Klienten erzielen können. Sie können somit beraten, erklären und aufklären.
Es lässt sich tatsächlich auch sagen, dass der Sozialarbeiter anhand der Medienkompetenz seiner Klienten und wie sie Medien nutzen viel über sie in Erfahrung bringen und sie dementsprechend auch für die künftige Zusammenarbeit genauer analysieren kann. Das Vorhanden-Sein beziehungsweise das Nicht-Vorhandensein von „Digitaler Kompetenz, Nutzungsvielfalt unddie Einstellung zu den neuen Medien“ (Tendenz, S.8), kann beispielsweise Aufschluss über die Neugier und Offenheit beziehungsweise Angst vor Veränderungen und Verschlossenheit eines Klienten bringen.
Bei jener Analyse in Sachen Medienumgang muss aber auch auf das Konzept der Generationgestalten eingegangen werden. Dabei geht es um das Aufwachsen der Menschen einer Generation, deren Umwelt sowie deren Ausgangssituation sich durch politische, kulturelle und soziale Entwicklungen gegenüber den früheren Generationen verändert hat (vgl. Süss, Lampert, Wijnen; 2010; S. 15). Darunter fällt natürlich auch, dass die jüngeren Generationen mit völlig neuen Medien aufwachsen ebenso wie sich die prägenden Leitmedien gegenüber den älteren Generationen verändert haben.
Die Leitmedien, das sind jene Medien, welche weit verbreitet sind, viele Funktionen haben, stark genutzt werden und zu denen ein Großteil der Menschen eine hohe Bindung aufgebaut hat (vgl. Süss, Lampert, Wijnen; 2010; S. 15). Das bedeutet im Genaueren: Der Mensch hat sich durch den hohen Nutzen und die Funktion jenes Mediums stark an dieses gebunden, sodass es zum Leitmedium wurde. Das Leitmedium früher war der Fernseher, noch weiter in der Vergangenheit war es die Zeitung, mittlerweile ist es das Handy sowie der Computer. Da das Medium Internet in der heutigen Zeit unter den Menschen stets eine polarisierende Wirkung erzielt, werde ich daher in meinen Aufzeichnungen speziell auf das Medium Internet sowie Medienkompetenz in Sachen digitale Medien eingehen.
Hier können Generationskonflikte entstehen: Die älteren Jahrgänge (die Großeltern- und Elterngeneration einer Familie beispielsweise) verstehen oft den Nutzen und die Funktionsweise neuer Medien, wie dem Internet nicht, hinterfragen es kritisch und lassen sich von Berichten über „Killerspiele“ oder Online-Kreditkartenbetrug abschrecken. „Vor allem ältere Menschen […] hätten häufig Angst vor dem Netz“ (Tendenz; 2010, S.8), wissen auch Experten auf dem Gebiet der Medienbildung. Die Kinder dieser Jahrgänge missverstehen dieses Ängstigen meist. Sie glauben, die Älteren hätten kein Interesse am Nutzen dieser Medien, würden sie ablehnen und vermuten, die Erwachsenen würden ihnen einen zu lockeren Umgang mit den eigenen Daten, vielleicht sogar kriminelle Machenschaften unterstellen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Medienkompetenz für Sozialarbeiter wichtig?
Medienkompetenz wird heute in der Sozialen Arbeit vorausgesetzt, um Klienten in Medienfragen zu beraten, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und digitale Teilhabe zu fördern.
Was versteht man unter „Digital Natives“ und „Digital Immigrants“?
Digital Natives sind mit digitalen Medien aufgewachsen, während Digital Immigrants diese erst im Erwachsenenalter erlernt haben. Sozialarbeiter vermitteln oft zwischen diesen Generationen.
Wie definiert Bernd Schorb Medienkompetenz?
Er bündelt darunter die Fähigkeiten, die ein Individuum benötigt, um sich in einer Informationsgesellschaft zurechtzufinden, Medien kritisch zu reflektieren und produktiv zu nutzen.
Welche Rolle spielen Leitmedien in der Sozialen Arbeit?
Leitmedien wie das Smartphone prägen den Alltag der Klienten massiv. Sozialarbeiter nutzen das Wissen über den Medienumgang, um Rückschlüsse auf die Lebenswelt ihrer Klienten zu ziehen.
Wie können Generationskonflikte durch Medien entstehen?
Ältere Generationen haben oft Ängste vor neuen Medien (z.B. Internetkriminalität), während Jüngere dies als Ablehnung ihres Lebensstils missverstehen, was Vermittlungsarbeit erfordert.
- Citation du texte
- Lisa Schröter (Auteur), 2012, Die eigene Medienkompetenz als Sozialarbeiter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233527