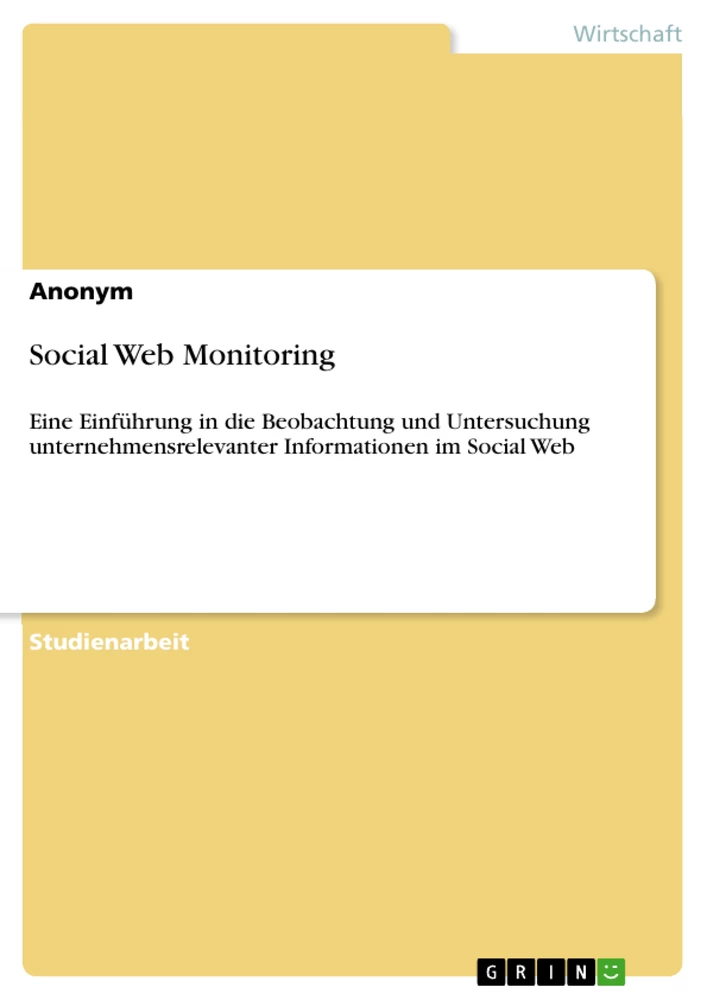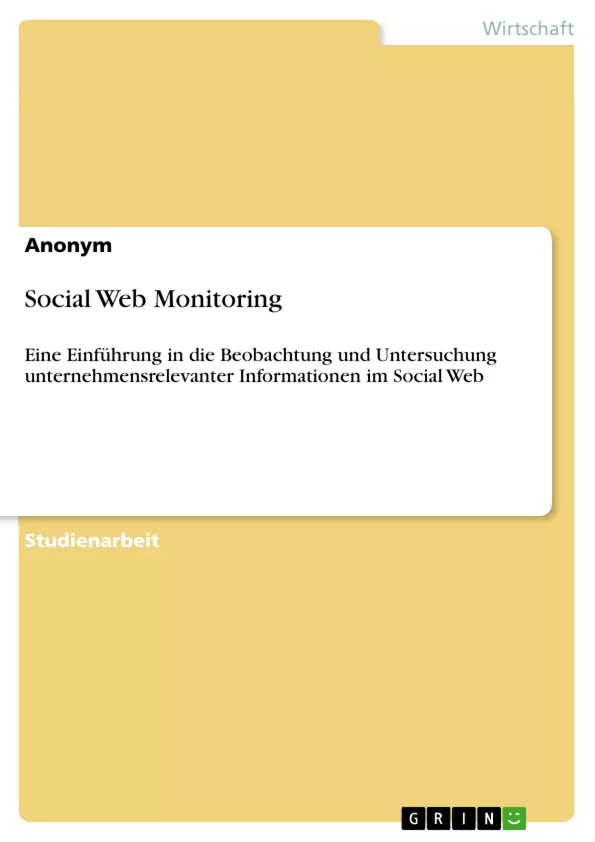Die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten haben sich im Internet in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Die klassische One-Way-Kommunikation bei der Unternehmen ausschließlich über "offizielle" Kanäle wie (Unternehmens-)Webseiten oder Massenmedien, wie beispielsweise Fernsehen, Radio oder Print, ihren Kunden Informationen bereitstellten, ist abgelöst worden von einer interaktiven, multimedialen Kommunikation.
Heutzutage sind die Nutzer im Informationsprozess nicht mehr nur passive
Rezipienten, sondern gleichzeitig auch aktive Produzenten, die digitale Inhalte mitgestalten und erweitern. Dabei nimmt jeder Nutzer als aktiver, gestaltender Prosument mit eigenen Kommentaren, Bewertungen, Videos etc. am interaktiven Kommunikationsprozess im Social Web teil. Der sogenannte User Generated Content (kurz: UGC; dt.: nutzergenerierte Inhalte; auch als Consumer Generated Media oder User Created Content bezeichnet) enthält ungefilterte, authentische Aussagen und Meinungen zu Produkten, Dienstleistungen, Marken oder gesamten Märkten. Gleichzeitig ist das Social Web eine der wichtigsten Informationsquellen für Kaufentscheidungen. Laut einer Studie der BITKOM liest jeder zweite (48%) Internetnutzer in Deutschland vor einer Kaufentscheidung die Bewertung anderer Kunden. Zudem gibt jeder dritte (31%) Nutzer an, dass die Meinung anderer Verbraucher im Social Web die eigene Kaufentscheidung beeinflusst hat.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Aufbau der Arbeit
2 Begrifflichkeiten und Definitionen
2.1 Social Web
2.2 Social Web Monitoring
3 Möglichkeiten und Chancen des Social Web Monitoring
3.1 Reputationsmanagement
3.2 Produkt- und Innovationsmanagement
3.3 Wettbewerbsbeobachtung
3.4 Kampagnenanalyse
3.5 Meinungsführeridentifikation und Customer Relationship Management
4 Schwierigkeiten und Grenzen des Social Web Monitoring
4.1 Zugangsgeschützte Quellen
4.2 Kosten
4.3 Beachten spezieller Richtlinien
4.4 Zuständigkeiten im Unternehmen
4.5 Hohes Beitragsaufkommen
5 Marktübersicht
5.1 Vorstellung ausgewählter Monitoring-Anbieter
5.1.1 Attensity Europe GmbH
5.1.2 Brandwatch Germany
5.1.3 complexium GmbH
5.1.4 infospeed GmbH
6 Zukünftige Entwicklung und Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Social Web Monitoring?
Social Web Monitoring ist die systematische Beobachtung und Analyse von nutzergenerierten Inhalten (User Generated Content) im Internet, um Meinungen über Marken, Produkte oder Wettbewerber zu identifizieren.
Warum ist User Generated Content für Unternehmen so wichtig?
Nutzergenerierte Inhalte enthalten ungefilterte und authentische Meinungen. Da fast jeder zweite Internetnutzer vor einem Kauf Bewertungen liest, beeinflusst dieser Content maßgeblich die Kaufentscheidungen.
Welche Chancen bietet Monitoring im Reputationsmanagement?
Unternehmen können frühzeitig auf Kritik reagieren, Krisen (Shitstorms) abwenden und ein positives Markenimage durch aktiven Dialog mit den Kunden aufbauen.
Wie hilft Monitoring im Innovationsmanagement?
Durch die Analyse von Kundenwünschen und Problemen im Social Web können Unternehmen wertvolle Impulse für die Produktentwicklung und Verbesserung ihrer Dienstleistungen gewinnen.
Was sind die Grenzen des Social Web Monitorings?
Schwierigkeiten liegen in der Analyse zugangsgeschützter Quellen (z. B. private Facebook-Profile), den hohen Kosten für professionelle Tools und der Verarbeitung sehr großer Datenmengen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Social Web Monitoring, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233696