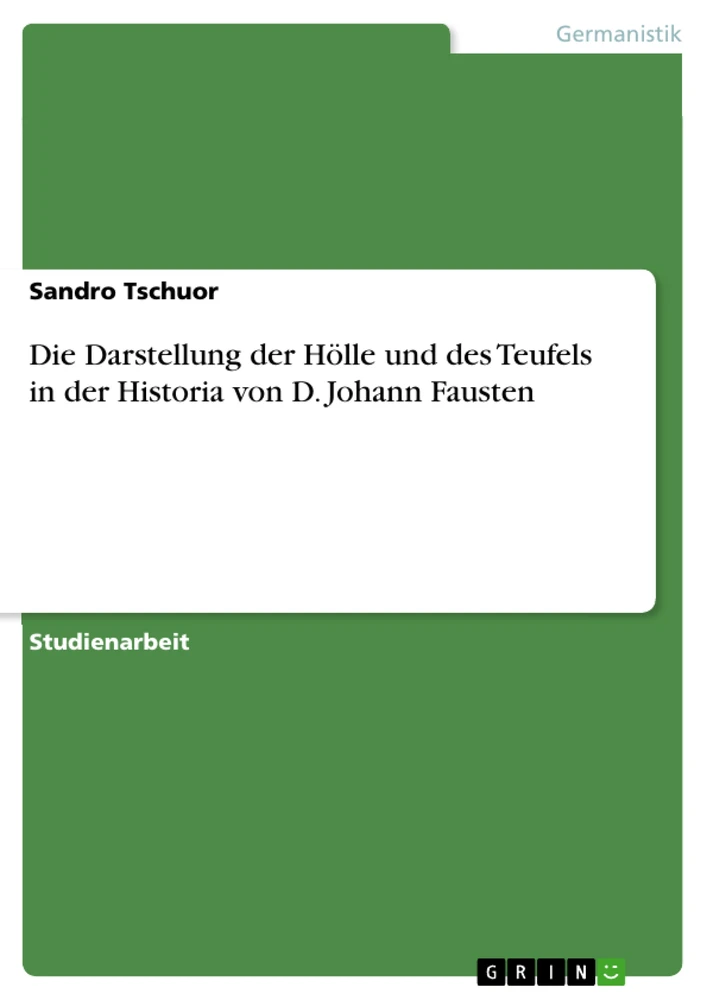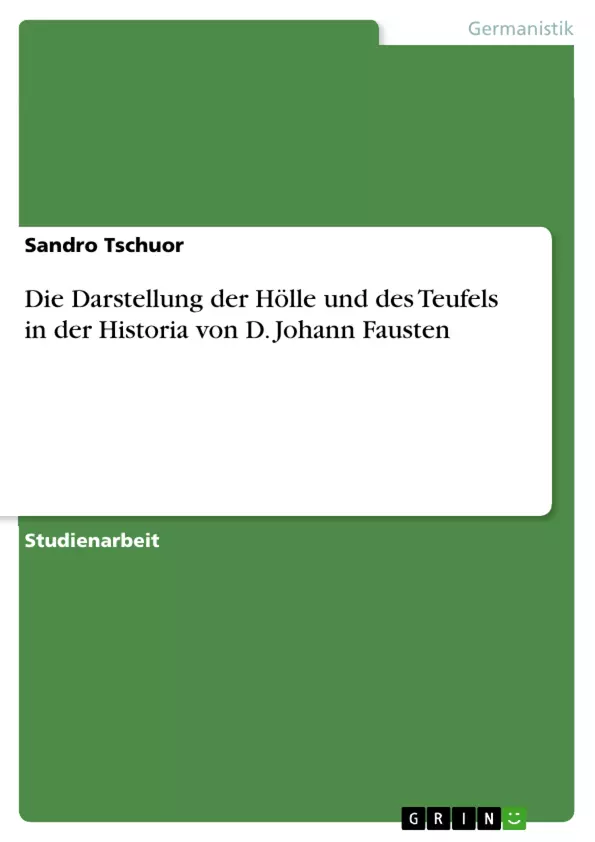Es scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein, Ordnung in seine unmittelbar erfahrbare Umwelt bringen zu wollen. Das Christentum mit seiner Einteilung der eschatologischen Grundeinheiten, wie Himmel und Hölle, ist nicht losgelöst von anderen Traditionen entstan-den, sondern muss als Bündelung verschiedenster Einflüsse älterer Kulturen betrachtet wer-den. Fundamentalen Einfluss auf die christlichen Vorstellungen nahmen sicherlich die Auf-fassungen der antiken Griechen und Römer sowie diejenigen der Bewohner des alten Meso-potamiens (Babylonier, Assyrer, Sumerer usw.) und Ägypter. Die Bibel ist in diesem Zusam-menhang, als „Schmelztiegel“ verschiedener Kulturen und Vorstellungen zu sehen. Dabei ist der biblische Kanon, wie er sich heute präsentiert, über längere Zeit und von verschiedenen Autoren kompiliert worden. Dieser Prozess begann circa im 1.Jh. v. Chr. und fand im 4.Jh. n. Chr. seinen Abschluss. Durch Übersetzungen vom hebräischen Text in die griechische Koiné (Septuaginta) und später wiederum deren Umschrift ins Lateinische (Vulgata) bewirkte zum Teil Verschiebungen von Wortbedeutungen oder es wurden Wörter aus einem Kulturkreis, welche kein Pendant in der anderen Sprache hatten, einfach beibehalten, so dass wir für ge-wisse Dinge (z.B. den Teufel) mehrere Bezeichnungen haben.
In meiner Arbeit möchte ich analysieren, wie der Raum der Hölle in dem reformierten Volks-buch der Historia von D. Johann Fausten dargestellt wird. In einem Vergleich zwischen sakra-len und profanen Texten sowie der Bibel selbst möchte ich auf etwaige Differenzen vom Fausttext aufmerksam machen und einige Thesen zu deren Erklärung anbieten, sofern man denn Differenzen ausmachen kann. Die Grundfragen wären demnach: Wie wird der Raum der Hölle im Faustbuch beschrieben? Wie wird die Figur des Teufels rein äusserlich dargestellt? Gibt es Unterschiede zur Bibel oder anderen wichtigen Werken, welche die Hölle darzustellen versuchen? Mein Ansatz ist vorwiegend ein relativer. Durch den Vergleich von breitgestreu-ten Texten werden möglicherweise gewisse epochale Tendenzen oder historische Erkenntnis-se zusätzlich gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Antike und ältere Kulturen
- 3. Die Bibel
- 3.1. Altes Testament
- 3.1.1. Die Hölle im AT
- 3.1.2. Der Teufel im AT
- 3.2. Neues Testament
- 3.2.1. Hölle im NT
- 3.2.2. Der Teufel im NT
- 3.2.3. Die Offenbarung des Johannes
- 3.1. Altes Testament
- 4. Apokryphe Apokalyptik
- 5. Profane Visionsliteratur
- 5.1. Visio tnugdali
- 5.2. Dantes Höllentrichtermotiv
- 6. Historia von D. Johann Fausten
- 6.1. Die Hölle bei Faust
- 6.1.1. Die grobe Einteilung der Hölle mit ihren Regimentern
- 6.1.2. Die Quelle für die zehn Regimente der Hölle
- 6.2. Fausts konkrete Fragen zur Hölle an Mephistophiles
- 6.3. Faustus` imaginierte Höllenfahrt
- 6.4. Der Teufel bei Faust
- 6.1. Die Hölle bei Faust
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Hölle und des Teufels in der "Historia von D. Johann Fausten" im Vergleich zu anderen Texten, beginnend mit antiken Vorstellungen bis hin zur profanen Literatur des Mittelalters. Das Hauptziel besteht darin, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Hölle und des Teufels aufzuzeigen und mögliche Einflüsse auf die Darstellung im Faustbuch zu analysieren.
- Entwicklung der Höllenvorstellungen von antiken Kulturen bis zum Mittelalter
- Vergleich der Höllen- und Teufelsdarstellung im Alten und Neuen Testament
- Einfluss apokrypher Literatur auf die Vorstellung von Hölle und Teufel
- Rezeption sakraler Motive in profaner Visionsliteratur (Visio Tnugdali, Dante)
- Analyse der Darstellung von Hölle und Teufel in der "Historia von D. Johann Fausten"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale Forschungsfrage: Wie wird die Hölle im Faustbuch dargestellt und wie unterscheidet sie sich von biblischen und anderen literarischen Traditionen? Der Autor betont den interkulturellen und diachronen Ansatz, der antike, biblische und mittelalterliche Texte umfasst, um epochale Tendenzen in der Höllenvorstellung zu analysieren. Die methodische Vorgehensweise, beginnend mit antiken Vorstellungen über die Unterwelt und weiterführend über die Bibel, apokryphe Schriften, profane Visionsliteratur bis hin zum Faustbuch, wird erläutert. Die Arbeit verfolgt den Anspruch, eine diachrone Entwicklung der Höllenmotivik aufzuzeigen.
2. Antike und ältere Kulturen: Dieses Kapitel untersucht die Unterweltsvorstellungen in antiken Kulturen. Im Gegensatz zu späteren transzendentalen Auffassungen wird die Unterwelt als real und konkret existierender Ort unter der Erde beschrieben. Mesopotamische (Gilgamesch-Epos) und ägyptische Vorstellungen werden kontrastiert. Während in frühen ägyptischen Vorstellungen die Unterwelt positiv besetzt war, entwickelte sich später eine negative Konnotation mit moralischen Strafen. Der griechische Hades und Tartaros werden als Vorläufer der christlichen Hölle analysiert, wobei die moralische Komponente hervorgehoben wird.
3. Die Bibel: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Hölle und des Teufels im Alten und Neuen Testament. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Darstellungen beleuchtet und auf die Entwicklung der Konzepte im Laufe der biblischen Überlieferung eingegangen. Die Offenbarung des Johannes wird als besonders relevanter Text für die spätere Höllenvorstellung hervorgehoben. Die Rolle der Übersetzungen (Septuaginta, Vulgata) bei der Entwicklung der Terminologie und der Konzepte wird ebenfalls diskutiert.
4. Apokryphe Apokalyptik: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung der Hölle und des Teufels in apokryphen Texten, speziell der Paulus-Apokalypse. Der Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Texte für die mittelalterliche Vorstellung von Hölle und Teufel, trotz ihrer geringeren Wertschätzung nach der Kanonisierung der Bibel. Die Rolle apokrypher Schriften im Verständnis der Höllenbeschaffenheit wird betont.
5. Profane Visionsliteratur: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption sakraler Motive in der profanen Literatur des Mittelalters, anhand von "Visio Tnugdali" und Dantes "Komödie". Die Analyse konzentriert sich darauf, wie die sakralen Vorstellungen von Hölle und Teufel in die profane Kultur aufgenommen und möglicherweise erweitert wurden. Die Kapitel analysieren, inwieweit Elemente der sakralen Vorstellung in diesen Werken modifiziert oder weiterentwickelt wurden.
6. Historia von D. Johann Fausten: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Hölle und des Teufels im Faustbuch. Es untersucht die spezifischen Charakteristika der Höllenbeschreibung, die Figur des Mephistopheles und deren Beziehung zum Konzept der Hölle im Faustbuch im Vergleich zu den vorher behandelten Texten. Untersucht werden die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten mit den zuvor behandelten sakralen und profanen Darstellungen, um die Innovationen oder Wiederholungen alter Erzählmuster zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Hölle, Teufel, Historia von D. Johann Fausten, Bibel, Antike, Mittelalter, Apokryphe Apokalyptik, Visionsliteratur, Unterwelt, Höllenvorstellungen, Teufelsdarstellung, religiöse Vorstellungen, profane Kultur, Vergleichende Literaturanalyse, diachrone Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur "Historia von D. Johann Fausten" und der Darstellung von Hölle und Teufel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Hölle und des Teufels in der "Historia von D. Johann Fausten" im Vergleich zu anderen Texten. Sie untersucht die Entwicklung der Höllenvorstellungen von der Antike bis zum Mittelalter und vergleicht die Darstellungen in der Bibel, apokrypher Literatur und profaner Visionsliteratur mit dem Faustbuch.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht ein breites Spektrum an Texten, darunter antike Mythen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland), das Alte und Neue Testament, apokryphe Schriften (insbesondere die Paulus-Apokalypse), profane Visionsliteratur ("Visio Tnugdali", Dantes "Komödie") und schließlich die "Historia von D. Johann Fausten".
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wird die Hölle im Faustbuch dargestellt und wie unterscheidet sie sich von biblischen und anderen literarischen Traditionen?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen interkulturellen und diachronen Ansatz. Sie untersucht die Entwicklung der Höllenvorstellungen über verschiedene Epochen und Kulturen hinweg, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und mögliche Einflüsse auf die Darstellung im Faustbuch zu analysieren. Es wird eine vergleichende Literaturanalyse durchgeführt.
Wie werden Hölle und Teufel in der Antike dargestellt?
In antiken Kulturen wurde die Unterwelt oft als real und konkret existierender Ort unter der Erde beschrieben. Die Vorstellungen variierten zwischen Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland). Während frühe ägyptische Vorstellungen positiv besetzt waren, entwickelte sich später eine negative Konnotation mit moralischen Strafen. Der griechische Hades und Tartaros werden als Vorläufer der christlichen Hölle angesehen.
Wie werden Hölle und Teufel in der Bibel dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Hölle und Teufel im Alten und Neuen Testament, beleuchtet Unterschiede und Gemeinsamkeiten und geht auf die Entwicklung der Konzepte im Laufe der biblischen Überlieferung ein. Die Offenbarung des Johannes wird als besonders relevanter Text für die spätere Höllenvorstellung hervorgehoben. Die Rolle von Übersetzungen (Septuaginta, Vulgata) wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielen apokryphe Texte?
Apokryphe Texte, insbesondere die Paulus-Apokalypse, werden als wichtige Einflussfaktoren auf die mittelalterliche Vorstellung von Hölle und Teufel untersucht, obwohl sie nach der Kanonisierung der Bibel eine geringere Wertschätzung erfuhren.
Wie werden sakrale Motive in der profanen Literatur des Mittelalters rezipiert?
Die Arbeit analysiert die Rezeption sakraler Motive in profaner Literatur am Beispiel von "Visio Tnugdali" und Dantes "Komödie". Der Fokus liegt darauf, wie sakrale Vorstellungen von Hölle und Teufel in die profane Kultur aufgenommen und möglicherweise erweitert oder modifiziert wurden.
Wie wird die Hölle in der "Historia von D. Johann Fausten" dargestellt?
Das Kapitel zur "Historia von D. Johann Fausten" analysiert die spezifischen Charakteristika der Höllenbeschreibung, die Figur des Mephistopheles und deren Beziehung zum Konzept der Hölle. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den zuvor behandelten sakralen und profanen Darstellungen untersucht, um Innovationen oder Wiederholungen alter Erzählmuster zu identifizieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hölle, Teufel, Historia von D. Johann Fausten, Bibel, Antike, Mittelalter, Apokryphe Apokalyptik, Visionsliteratur, Unterwelt, Höllenvorstellungen, Teufelsdarstellung, religiöse Vorstellungen, profane Kultur, Vergleichende Literaturanalyse, diachrone Entwicklung.
- Citar trabajo
- Bachelor Sandro Tschuor (Autor), 2011, Die Darstellung der Hölle und des Teufels in der Historia von D. Johann Fausten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233697