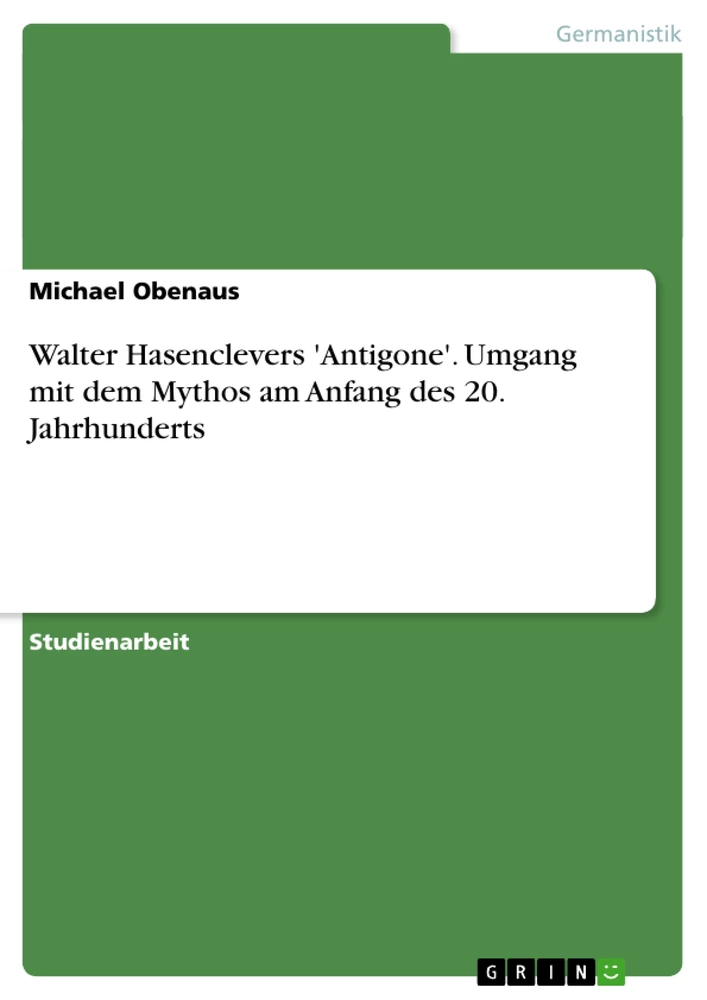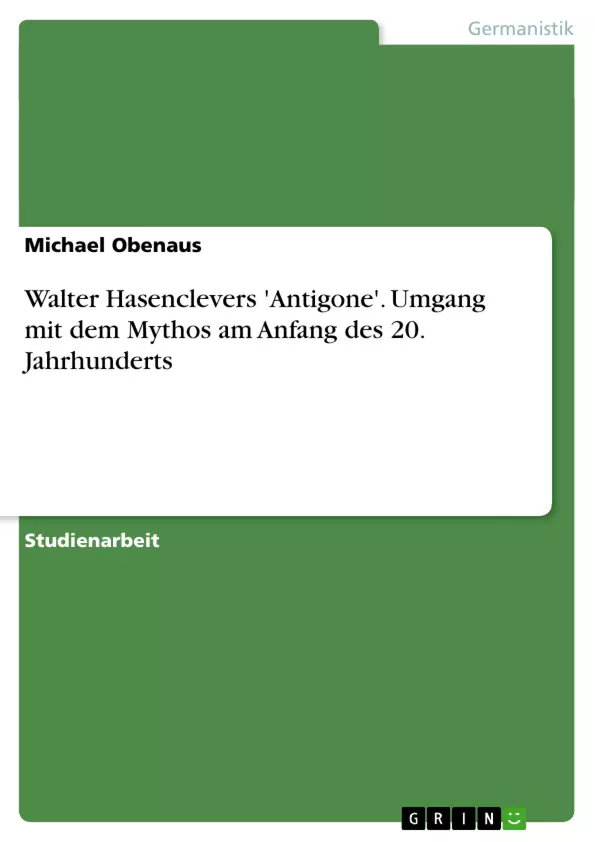Walter Hasenclever schrieb sein Drama Antigone im Jahre 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Es erschien 1917 in mehreren Auflagen. Die erste Aufführung war für 1917 geplant, unterlag aber einem Verbot der Zensur und fand möglicherweise erst 1919 statt. Das Stück wurde vom Publikum begeistert aufgenommen, unterlag aber ab 1920 erneut öffentlichen Sanktionen 1 . Diese Rezeption des Antigone-Mythos, angelehnt an die antike Vorlage Sophokles‘, fand also starke Resonanz beim Publikum seiner Zeit: Begeisterung von der einen, Verbote von der anderen Seite. Hasenclevers Antigone scheint den wunden Punkt seiner Zeit genau getroffen zu haben - kaum etwas anderes ist solch ein präziser Seismograph für die kritische Aktualität eines Textes wie das Verbot durch die Zensur, einem Instrument staatlicher Gewalt und Kontrolle. Wir haben in u nserem Referat über Hasenclevers Antigone (17./24. 06. 99) versucht, den Umgang mit einem Mythos am Beginn des 20. Jahrhunderts in Verschränkung mit Bezügen zur Aktualität, zur Wirklichkeitserfahrung dieser Zeit darzustellen. Dazu bedurfte es der Synthese zweier Perspektiven auf den Text: Zum einen der Analyse der literarischen Methoden und Mittel einer Mythosrezeption, die in das antike Muster vielschichtige Diskurstraditionenen deutet. Zum anderen der Einbettung des Werkes in sein literaturgeschichtliches, historisches, intellektuelles Umfeld, um so auch die Fluchtpunkte der Aktualisierung des Mythos einzubinden. Ich möchte mich in den folgenden Ausführungen auf die erstere Perspektive, also die Umdeutung bzw. literarische Rezeption des antiken Mythos konzentrieren, und verweise für den zweiten Aspekt unserer Darstellungen auf die Ausführungen meiner Mitreferentin, Annegret Hoffmann. Ich werde mich für Belege meiner Thesen und Interpretationen aus Gründen des Umfangs auf exemplarische Zitate, auf Szenenverweise und Motivkomplexe beschränken müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Tragischer Konflikt
- 1.1 Kreon und Antigone: Ethische Entscheidung und Schuld
- 1.2 "Das Volk“: Masse und Trieb
- 2. Umdeutung der Figuren
- 2.1 Antigone
- 2.2 Das Volk
- 2.3 Teiresias
- 3. Tragische Schuldkonzeption
- 4. Wirkungskonzept des Dramas: Katharsis versus Apokalypse
- 5. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Walter Hasenclevers "Antigone" (1916/17) und beleuchtet die Umdeutung des antiken Mythos in der literarischen Rezeption des 20. Jahrhunderts. Das Werk wird in Bezug auf seine literaturgeschichtliche, historische und intellektuelle Einbettung betrachtet.
- Rezeption des Antigone-Mythos im Kontext des frühen 20. Jahrhunderts
- Literarische Methoden und Mittel der Mythosrezeption
- Umdeutung tragischer Konzepte in Hasenclevers Drama
- Der Einfluss von Diskurszusammenhängen auf die Interpretation des Mythos
- Das Verhältnis von antiker Tragödie und moderner Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entstehung und Rezeption von Hasenclevers "Antigone" im Ersten Weltkrieg dar. Sie betont den Konflikt zwischen Begeisterung und Verbot des Stücks als Ausdruck der kritischen Aktualität des Themas.
Kapitel 1 fokussiert auf den "tragischen Konflikt" des Stücks, der nicht nur zwischen den Figuren Kreon und Antigone, sondern auch als innerer Konflikt innerhalb der Figuren selbst angelegt ist. Der Text analysiert die Umdeutung des klassischen Konflikts zwischen göttlichem und menschlichem Gesetz in Hasenclevers Stück und stellt die ethische Entscheidung als zentrale Triebfeder des Handelns der Figuren heraus.
Kapitel 2 untersucht die Umdeutung der Figuren im Stück. Hier werden die Charaktere Antigone, das Volk und Teiresias in ihrer neuen Rolle und Bedeutung analysiert.
Kapitel 3 widmet sich der "tragischen Schuldkonzeption" in Hasenclevers Drama. Die moralische Verantwortung und das Wissen über die eigene Schuld werden als wesentliche Elemente des Handelns der Figuren hervorgehoben.
Kapitel 4 vergleicht die Wirkungskonzepte der antiken Tragödie und Hasenclevers "Antigone". Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Katharsis und Apokalypse als dramaturgische Elemente diskutiert.
Schlüsselwörter
Walter Hasenclever, Antigone, Mythosrezeption, Tragödie, Tragischer Konflikt, Ethische Entscheidung, Schuld, Menschlichkeit, Humanismus, Gewaltlosigkeit, Nächstenliebe, Machtstreben, Tyrannen, Katharsis, Apokalypse, Diskurszusammenhänge, Historische Einbettung, Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie deutet Walter Hasenclever den Antigone-Mythos um?
Hasenclever transformiert den antiken Stoff in ein expressionistisches Stationendrama, das aktuelle Themen wie Pazifismus, Humanismus und den Kampf gegen Tyrannei betont.
Welchen Einfluss hatte der Erste Weltkrieg auf das Drama?
Das Stück entstand 1916 mitten im Krieg und spiegelt die Erschütterung der Zeit sowie die Sehnsucht nach Gewaltlosigkeit und Menschlichkeit wider.
Warum wurde Hasenclevers "Antigone" verboten?
Wegen seiner kritischen Haltung gegenüber staatlicher Gewalt und Machtstreben unterlag das Stück mehrfach der Zensur, da es den "wunden Punkt" der damaligen Zeit traf.
Wie wird die Figur des Kreon dargestellt?
Kreon verkörpert den machtbesessenen Tyrannen, dessen Handeln im krassen Gegensatz zu Antigones ethischer Entscheidung für die Menschlichkeit steht.
Was unterscheidet das Wirkungskonzept von der antiken Tragödie?
Während die Antike auf Katharsis (Reinigung) zielt, nutzt Hasenclever apokalyptische Bilder, um die Notwendigkeit einer geistigen Erneuerung der Gesellschaft aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Michael Obenaus (Autor), 1999, Walter Hasenclevers 'Antigone'. Umgang mit dem Mythos am Anfang des 20. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23530