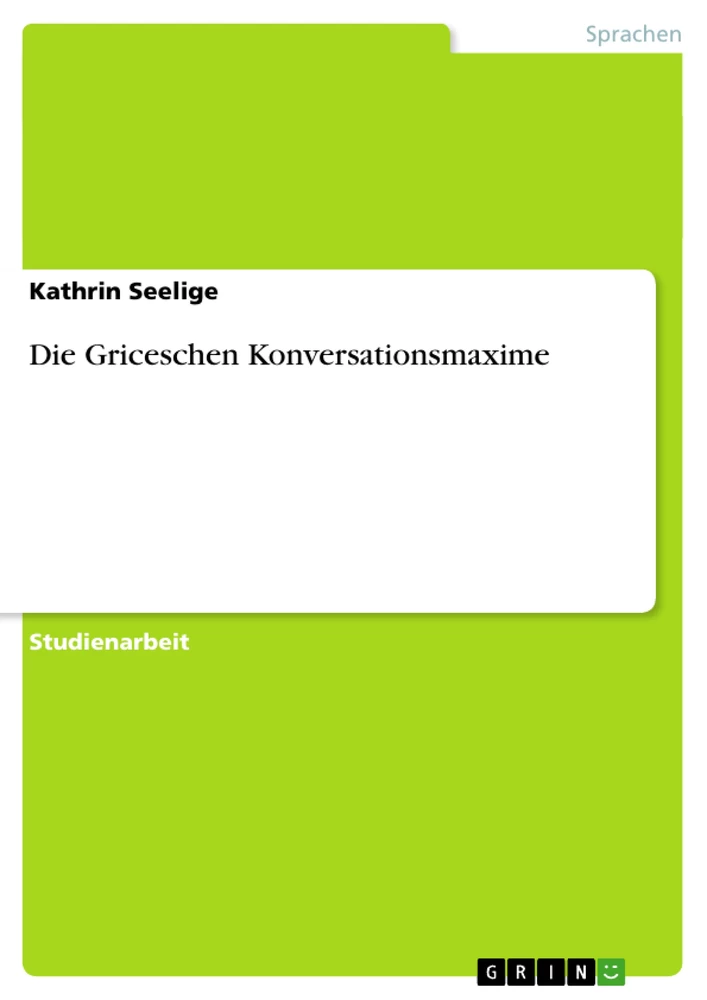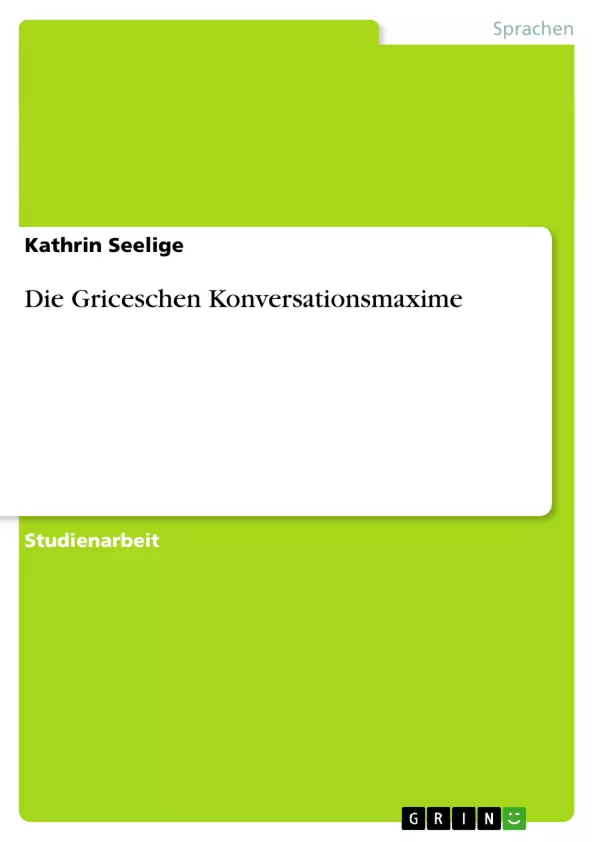H. Paul Grice (1913-1988) hat einige wichtige Anstöße in der sprachwissenschaftlichen
Forschung gegeben. Durch die ,Erfindung’ des Begriffs Implikatur, der später
ausführlicher erklärt werden soll, begründete er eine damals neue Art der
Kommunikationstheorie. Grice beschränkte seine Forschungen erstmals nicht mehr nur
auf das wörtlich Gesagte, sondern unterschied zwischen Gesagtem und tatsächlich
Gemeintem.
Diese Hausarbeit soll nun nicht die Theorie der Implikatur ausführlich analysieren.
Vielmehr soll ein bestimmter Aspekt, nämlich die von Grice aufgestellten sogenannten
Konversationsmaxime, erstens in diese Theorie eingeordnet und zweitens seine
tatsächliche Bedeutung herausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck werde ich als erstes
die Konversationsmaxime, die Grice als Leitlinien für eine maximal informative
Unterhaltung konzipiert hat, erklären. Da es nicht möglich ist, die Konversationsmaxime
ohne ihre Einordnung in die Theorie der Implikatur zu verstehen, werde ich dann kurz
diese Theorie mit Blick auf die Maxime erläutern.
Der Begriff der Implikatur macht erst dann Sinn, wenn die Konversationsmaxime in
einem Gespräch nicht eingehalten werden. Da dies oft der Fall ist, ,scheitern’ die
Griceschen Maxime in alltäglichen Konversationen. Dieses ,Scheitern’, was nicht als
negativ zu verstehen ist, soll in einem weiteren Abschnitt der Hausarbeit anhand von
Beispielen aus alltäglichen Unterhaltungen veranschaulicht werden.
Im letzten Teil der Arbeit soll die Bedeutung der Konversationsmaxime in konfliktären
Gesprächen herausgearbeitet werden. Dies geschieht anhand der Untersuchung eines
Korpus eines Streitgespräches. Abschließend werde ich im Schlussteil die Ergebnisse der
Untersuchungen des Einhaltens bzw. der Verstöße gegen die Konversationsmaxime
zusammenfassen und versuchen, ihre tatsächliche Bedeutung zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Griceschen Konversationsmaxime
- 2.1 Das kooperative Prinzip
- 2.2 Die Maxime der Quantität
- 2.3 Die Maxime der Qualität
- 2.4 Die Maxime der Relation
- 2.5 Die Maxime der Art und Weise
- 3. Die Theorie der Implikatur
- 4. Das Scheitern der Griceschen Konversationsmaxime
- 5. Die Bedeutung der Griceschen Konversationsmaxime in konfliktären Gesprächen
- 5.1 Untersuchung des Korpus „Köln vergessen“ aus Carmen Spiegels Buch „Streit“
- 5.1.1 Beschreibung der Gesprächssituation
- 5.1.2 Analyse des Korpus „Köln vergessen“
- 5.1 Untersuchung des Korpus „Köln vergessen“ aus Carmen Spiegels Buch „Streit“
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Griceschen Konversationsmaximen im Kontext von Gesprächen, insbesondere konfliktären. Ziel ist es, die Maxime in die Theorie der Implikatur einzuordnen und ihre Bedeutung, sowohl im alltäglichen als auch im konfliktären Gesprächsverlauf, herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert ein konkretes Streitgespräch, um die Anwendung und das mögliche Scheitern der Maxime zu illustrieren.
- Die Griceschen Konversationsmaximen und das kooperative Prinzip
- Die Theorie der Implikatur und ihr Bezug zu den Maximen
- Das Scheitern der Maximen in alltäglichen Konversationen
- Die Rolle der Maximen in konfliktären Gesprächen
- Analyse eines konkreten Streitgesprächs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Griceschen Konversationsmaximen ein und erläutert den Fokus der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung von Grices Beitrag zur Kommunikationswissenschaft hervor, insbesondere die Unterscheidung zwischen wörtlichem und tatsächlich Gemeintem. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Konversationsmaximen und deren Rolle in alltäglichen und konfliktären Gesprächen, wobei ein konkretes Streitgespräch als Fallbeispiel dient.
2. Die Griceschen Konversationsmaxime: Dieses Kapitel stellt die vier Griceschen Konversationsmaximen vor: Quantität, Qualität, Relation und Art und Weise. Es wird das übergeordnete kooperative Prinzip erläutert, welches die Grundlage für die Maximen bildet. Die Maxime sollen einen maximal informativen und verständlichen Gesprächsverlauf gewährleisten. Der Text betont die Bedeutung der Kooperation der Gesprächspartner für den Erfolg der Kommunikation.
3. Die Theorie der Implikatur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie der Implikatur, einem zentralen Konzept in Grices Kommunikationsmodell. Die Implikatur entsteht, wenn die Konversationsmaximen nicht explizit eingehalten werden, dennoch aber eine Bedeutung vermittelt wird, die über den wörtlichen Inhalt hinausgeht. Dieses Kapitel erklärt, wie die Maximen die Grundlage für das Verständnis von Implikaturen bilden.
4. Das Scheitern der Griceschen Konversationsmaxime: Dieses Kapitel behandelt das "Scheitern" der Konversationsmaximen im alltäglichen Sprachgebrauch. Es wird argumentiert, dass dieses Scheitern kein negatives Phänomen darstellt, sondern ein integraler Bestandteil von Kommunikation ist und oft zu interessanten Interpretationen und Implikaturen führt. Der Text illustriert dies anhand von Beispielen aus Alltagssituationen.
5. Die Bedeutung der Griceschen Konversationsmaxime in konfliktären Gesprächen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Griceschen Konversationsmaximen in Streitgesprächen. Es wird ein spezifisches Korpus ("Köln vergessen") aus Carmen Spiegels Buch "Streit" untersucht, um zu zeigen, wie die Maximen eingehalten oder verletzt werden und wie diese Verletzungen zum Konflikt beitragen oder ihn sogar verstärken können. Die Analyse umfasst die Beschreibung der Gesprächssituation und eine detaillierte Auswertung des Korpus.
Schlüsselwörter
Grice, Konversationsmaxime, Kooperationsprinzip, Implikatur, Kommunikation, Gesprächsanalyse, Konflikt, Streitgespräch, Informationsaustausch, Wahrhaftigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Gricesche Konversationsmaximen in Konfliktgesprächen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Griceschen Konversationsmaximen und ihre Rolle in Gesprächen, insbesondere in konfliktären Situationen. Sie analysiert, wie die Maximen zur Implikatur beitragen und wie ihr (scheinbares) Scheitern die Kommunikation beeinflusst. Ein konkreter Streitgesprächs-Auszug dient als Fallbeispiel.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Griceschen Konversationsmaximen (Quantität, Qualität, Relation, Art und Weise) im Kontext des kooperativen Prinzips. Sie erläutert die Theorie der Implikatur und untersucht das Scheitern der Maximen im alltäglichen und konfliktären Gesprächsverlauf. Ein detaillierte Analyse eines Streitgesprächs-Abschnitts aus Carmen Spiegels Buch "Streit" (Korpus "Köln vergessen") bildet den praktischen Schwerpunkt.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Darstellung der Griceschen Konversationsmaximen, Erläuterung der Implikatur, Analyse des Scheiterns der Maximen, Analyse des Streitgesprächs-Korpus "Köln vergessen" und abschließendes Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Themen.
Was sind die Griceschen Konversationsmaximen?
Die Griceschen Konversationsmaximen sind vier Prinzipien, die nach Paul Grice einen erfolgreichen und effizienten Informationsaustausch in Gesprächen ermöglichen sollen. Sie umfassen die Maxime der Quantität (informativ, aber nicht zuviel), der Qualität (wahrheitsgemäß), der Relation (relevant) und der Art und Weise (klar, prägnant, ordentlich).
Was ist die Implikatur?
Die Implikatur beschreibt die Bedeutung, die über den wörtlichen Inhalt einer Äußerung hinausgeht. Sie entsteht oft durch die bewusste oder unbewusste Verletzung der Griceschen Konversationsmaximen. Das Verständnis von Implikaturen ist essentiell für die erfolgreiche Interpretation von Gesprächen.
Welche Rolle spielen die Maximen in Konfliktgesprächen?
Die Hausarbeit analysiert, wie die Griceschen Konversationsmaximen in Streitgesprächen angewendet oder verletzt werden. Die Verletzung der Maximen kann zum Konflikt beitragen oder ihn verstärken. Die Analyse des Korpus "Köln vergessen" illustriert diese Zusammenhänge.
Welche Methode wird in der Analyse des Streitgesprächs angewendet?
Die Analyse des Korpus "Köln vergessen" aus Carmen Spiegels Buch "Streit" beinhaltet eine Beschreibung der Gesprächssituation und eine detaillierte Auswertung des Gesprächsverlaufs im Hinblick auf die Einhaltung oder Verletzung der Griceschen Konversationsmaximen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Grice, Konversationsmaximen, Kooperationsprinzip, Implikatur, Kommunikation, Gesprächsanalyse, Konflikt, Streitgespräch, Informationsaustausch, Wahrhaftigkeit.
- Citar trabajo
- Kathrin Seelige (Autor), 2003, Die Griceschen Konversationsmaxime, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23551